J O H a N N E S Z I M M E R M A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
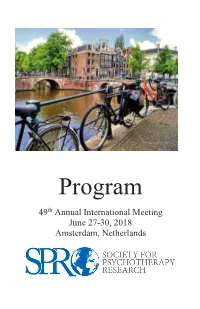
Conference Program
Program 49th Annual International Meeting June 27-30, 2018 Amsterdam, Netherlands Final Program Society for Psychotherapy Research 49th Annual International Meeting Amsterdam, Netherlands June 27-30, 2018 2 President Paulo P.P. Machado Past President J. Christopher Muran President Elect Mariane Krause General Vice-President Bruce Wampold Executive Officer Marna S. Barrett Regional Chapter Presidents Latin America Fernanda Serralta United Kingdom Felicitas Rost North America Shelley McMain Europe Stig Poulsen Program Planning Committee Mariane Krause (Program Chair), Jack Dekker (Local Host), Carolina Altimir, Paulina Barros, Claudia Capella, Marcelo Cárcamo, Louis Castonguay, Paula Dagnino, Kim de Jong, Gary Diamond, Ulrike Dinger, Daniel Espinosa, Fredrik Falkenström, Shigeru Iwakabe, Clara Hill, Claudio Martínez, Shelley McMain, Nick Migdley, Mahaira Reinel, Nelson Valdés, Daniel Vásquez, Sigal Zilcha-Mano. Local Organizing Committee Jack Dekker (Chair Local Organizing Committee), Kim de Jong. Web & IT Sven Schneider Meetingsavvy.com Brad Smith Copyright @ 2018 Society for Psychotherapy Research www.psychotherapyresearch.org 3 Preface Dear Colleagues, The members of the Conference Program Planning Committee and Local Organizing Committee warmly welcome you to Amsterdam for the 49th International Meeting of the Society for Psychotherapy Research. Amsterdam is known worldwide for being a diverse, open, and tolerant city that combines a strong culture with modern and sustainable development. In keeping with our host city, the theme for SPR’s 49th Annual International meeting is "Integrating Diversity into Psychotherapy Research". As part of our commitment to making our society even more inclusive and international, diversity gives us the chance to foster integration and inclusion while at the same time enriching our discipline. The program of this new version of our annual meeting reflects this diversity. -

Religion, Mission and National Development
Page 1 of 6 Original Research Religion, mission and national development: A contextual interpretation of Jeremiah 29:4–7 in the light of the activities of the Basel Mission Society in Ghana (1828–1918) and its missiological implications Author: We cannot realistically analyse national development without factoring religion into the analysis. 1 Peter White In the same way, we cannot design any economic development plan without acknowledging Affiliation: the influence of religion on its implementation. The fact is that, many economic development 1Department of Science of policies require a change from old values, attitudes, beliefs and behaviour patterns of the Religion and Missiology, citizenry to those that are supportive of the new policy. Christianity has become a potent social University of Pretoria, force in every facet of Ghanaian life, from family life, economic activities, occupation, and South Africa health to education. In the light of the essential role of religion in national development, this Correspondence to: article discusses the role the Basel Mission Society played in the development of Ghana and Peter White its missiological implications. This article argues that the Basel Mission Society did not only present the gospel to the people of Ghana, they also practicalised the gospel by developing Email: [email protected] their converts spiritually, economically, and educationally. Through these acts of love by the Basel Mission Society, the spreading of the Gospel gathered momentum and advanced. Postal address: Private Bag X20, Hatfield Intradisciplinary and/or interdisciplinary implications: The article contributes to the 0028, South Africa interdisciplinary discourse on religion and development with specific reference to the role of the Basel Mission Society’s activities in Ghana (1828–1918). -

The Impact of Basel Mission Ideology on the Thought of Carl Christian Reindorf Heinz Hauser-Renner
“Obstinate” Pastor and Pioneer Historian: The Impact of Basel Mission Ideology on the Thought of Carl Christian Reindorf Heinz Hauser-Renner n 1895, after twenty-five years of historical and ethnological Reindorf’s Western Education Iresearch, Carl Christian Reindorf, a Ghanaian pastor of the Basel Mission, produced a massive and systematic work about Reindorf’s Western education consisted of five years’ attendance the people of modern southern Ghana, The History of the Gold at the Danish castle school at Fort Christiansborg (1842–47), close Coast and Asante (1895).1 Reindorf, “the first African to publish to Osu in the greater Accra area, and another six years’ training at a full-length Western-style history of a region of Africa,”2 was the newly founded Basel Mission school at Osu (1847–55), minus a born in 1834 at Prampram/Gbugblã, Ghana, and he died in 1917 two-year break working as a trader for one of his uncles (1850–52). at Osu, Ghana.3 He was in the service of the Basel Mission as a At the Danish castle school Reindorf was taught the catechism and catechist and teacher, and later as a pastor until his retirement in arithmetic in Danish. Basel missionary Elias Schrenk later noted 1893; but he was also known as an herbalist, farmer, and medi- that the boys did not understand much Danish and therefore did cal officer as well as an intellectual and a pioneer historian. The not learn much, and he also observed that Christian principles intellectual history of the Gold Coast, like that of much of Africa, were not strictly followed, as the children were even allowed to is yet to be thoroughly studied. -

The Evolution of Christianity and German Slaveholding in Eweland, 1847-1914 by John Gregory
“Children of the Chain and Rod”: The Evolution of Christianity and German Slaveholding in Eweland, 1847-1914 by John Gregory Garratt B.A. in History, May 2009, Elon University A Dissertation submitted to The Faculty of The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy January 31, 2017 Andrew Zimmerman Professor of History and International Affairs The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University certifies that John Gregory Garratt has passed the Final Examination for the degree of Doctor of Philosophy as of December 9, 2016. This is the final and approved form of the dissertation. “Children of the Chain and Rod”: The Evolution of Christianity and German Slaveholding in Eweland, 1847-1914 John Gregory Garratt Dissertation Research Committee: Andrew Zimmerman, Professor of History and International Affairs, Dissertation Director Dane Kennedy, Elmer Louis Kayser Professor of History and International Affairs, Committee Member Nemata Blyden, Associate Professor of History and International Affairs, Committee Member ii © Copyright 2017 by John Garratt All rights reserved iii Acknowledgments The completion of this dissertation is a testament to my dissertation director, Andrew Zimmerman. His affability made the academic journey from B.A. to Ph.D more enjoyable than it should have been. Moreover, his encouragement and advice proved instrumental during the writing process. I would also like to thank my dissertation committee. Dane Kennedy offered much needed writing advice in addition to marshalling his considerable expertise in British history. Nemata Blyden supported my tentative endeavors in African history and proffered early criticism to frame the dissertation. -

2016-06-16 Report Team Visit Ghana 2015 Final
EMS “Mission Moves” Team Visit I Presbyterian Church of Ghana (PCG) / September 2015 “Mission Moves”: Akwaaba! Eye me anigyie se ma ba Ghana. [Welcome! I am glad to be in Ghana.] Team Visit to Ghana as a common journey of discovering mission history, discussing the understanding of mission today and reflecting upon mission challenges for tomorrow. Table of Contents: 1. Introduction: The Team Visit Concept . Page 2 2. The Character of our Team and the Participants . Page 3 3. Mission starts with “A” like Abokobi, Abetifi, Akropong, Akuapem: Itinerary . Page 4 4. Motivation for the Team Visit and Understanding of Mission . Page 7 5. The PCG - A Tanker of Faith with Deep Roots in the Whole Country. Page 10 6. Addressing the Questions. Discovering the challenges for today . Page 11 7. Word of Thanks . Page 25 8. Appendix I: A Short Mission History Written by Strangers and Lay People . Page 26 9. Appendix II Final Questions for our Evaluation . Page 38 „Mission Moves“ Team Visit I / PCG EMS “Mission Moves” Team Visit I Presbyterian Church of Ghana (PCG) Page 1 of 43 Sunday 20 th of September 2015 Thanksgiving Service at the Osu Ebenezer Congregation in Osu (Accra) celebrating 200 years of Basel Mission. From right: Emmanuel Tettey (Ghana) Rev. Lee, JungGon (Korea), Clement Sam-Dadjie(Ghana), Friederike Faller (Germany, Berlin), Zillah Odjelua, Schulamit Kriener (Germany / German East-Asia Mission / London, GB),Rev. Heike Bosien (Germany, Stuttgart), Ms. Philipa Odjelua, Rev. Samuel Odjelua, Aphiwe Mpeka (South Africa), Rev. Asao Mochizuki (Japan), Rahel Anne Römer (Germany, Mannheim). 1. Introduction: The Element of Strangeness and the View of Unprejudiced People rather than that of Ghana-Experts. -

Uncovering Multiple Conversion Avenues for Effective Evangelism Tim Buechsel George Fox University
Digital Commons @ George Fox University Doctor of Ministry Seminary 1-1-2013 One size fits all? uncovering multiple conversion avenues for effective evangelism Tim Buechsel George Fox University This research is a product of the Doctor of Ministry (DMin) program at George Fox University. Find out more about the program. Recommended Citation Buechsel, Tim, "One size fits all? uncovering multiple conversion avenues for effective evangelism" (2013). Doctor of Ministry. Paper 44. http://digitalcommons.georgefox.edu/dmin/44 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Seminary at Digital Commons @ George Fox University. It has been accepted for inclusion in Doctor of Ministry by an authorized administrator of Digital Commons @ George Fox University. GEORGE FOX UNIVERSITY ONE SIZE FITS ALL? UNCOVERING MULTIPLE CONVERSION AVENUES FOR EFFECTIVE EVANGELISM A DISSERTATION SUBMITTED TO GEORGE FOX EVANGELICAL SEMINARY IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MINISTRY BY TIM BUECHSEL PORTLAND, OREGON MARCH 2013 George Fox Evangelical Seminary George Fox University Portland, Oregon CERTIFICATE OF APPROVAL ________________________________ DMin Dissertation ________________________________ This is to certify that the DMin Dissertation of Tim Buechsel has been approved by the Dissertation Committee on March 14, 2013 for the degree of Doctor of Ministry in Leadership and Global Perspectives. Dissertation Committee: Primary Advisor: Clifford Berger, DMin Secondary Advisor: Roger Helland, DMin Lead Mentor: Jason Clark, DMin Copyright -

The Colonial Clergy of the Middle Colonies New York, New Jersey, and Pennsylvania 1628-1776
The Colonial Clergy of the Middle Colonies New York, New Jersey, and Pennsylvania 1628-1776 BY FREDERICK LEWIS WEIS EDITOR'S NOTE NE of the most useful tools in the chest of the bibliog- O rapher, historian, and librarian is the series of little volumes by Dr. Weis on the colonial clergy. The gap in this series, the volume on the clergy of the Middle Colonies, was proving such a great hindrance to our revision of Evans' American Bibliography, that we have decided to print this volume for our own use, and to publish it in order to share it with others. The first volume of this series. The Colonial Clergy and the Colonial Churches of New England (Lancaster, 1936), is out of print. The Colonial Clergy of Maryland, Delaware, and Georgia (Lancaster, 1950), and The Colonial Clergy of Virginia, North Carolina, and South Carolina (Boston, 1955) may be obtained of the author (at Dublin, New Hampshire) for $3 a volume. The institutional data which is provided at the end of the New England volume is for the other colonies issued in a separate volume. The Colonial Churches and the Colonial Clergy in the Middle and Southern Colonies (Lancaster, 1938), which is still available from the author. The biographical data on the clergy of the Middle Colonies here printed is also available in monograph form from the American Antiquarian Society. C. K. S. i68 AMERICAN ANTIQUARIAN SOCIETY [Oct., BENJAMIN ABBOTT, b. Long Island, N.Y., 1732; member of the Philadelphia Conference of Methodists, 1773-1789; preached at Penns- neck, N. -

Jamaica Journal Index with Abstracts 1990 – 2008
Jamaica Journal Index with abstracts 1990 – 2008 Compiled by : Cheryl Kean and Karlene Robinson University of the West Indies, Mona. Preface Coverage The purpose of this index is to articles that have been published in the Jamaica Journal since 1997. It covers the following issues:- Vol 23 no. 1 (1990) to Volume 31 nos. 1 & 2 (2008). All articles, book reviews, poems and short stories are included in the index. Arrangement The index is arranged in two sections. The first section is a general List of abstracts arranged alphabetically by the first named author or title. This is a list of all articles that are included in this index with an abstract provided for each article with the exception of book reviews, stories and poems. All entries are numbered. The second section is an Author and keyword list. The number that is listed beside each term corresponds to the number that is given to each entry in the general list of abstracts. Library of Congress Subject Headings were used to generate the list of keywords for all the entries in the index with the exception of a few cases where no appropriate terms existed to capture the subject material. List of Abstrtacts 1. The Altamont DaCosta Institute. Jamaica Journal 2000; 27(1):Back cover. Abstract: This article presents a brief biography of Altamont DaCosta, former mayor and custos of Kingston. The Institute was the former dwelling house of Mr. DaCosta and was willed to the people of Jamaica in 1935. 2. The Calabash tree (crescentia cujete). Jamaica Journal 2008; 31(1-2):Back cover. -

In My Father's House: Two Tales of Jewish Origin
IN MY FATHER’S HOUSE: TWO TALES OF JEWISH ORIGIN AMONG THE GA-ADANGME OF ACCRA IN 2015 Dr. Daniel Lis ABSTRACT: In Accra, two houses represent two distinct places that portray memories of a Jewish origin. One of them is the stool house of the royal Nikolai family. On a mural the wanderings of the Ga- Adangme ancestors from Israel into West Africa is portrayed. The other house holds the burial place of Wulff Joseph Wulff, a Danish Jew who settled in Osu in 1836. In this article, I will compare the two narratives and reflect on how both contribute to a contemporary Jew- ish myth of the origin of the Ga-Adangme-speaking peoples of Ghana. In the hustle and bustle of Ghana’s capital city, Accra, two houses a few miles apart represent two distinct places that portray mem- ories of a Jewish or Hebrew/Israelite origin among the Ga- Adangme-speaking peoples. One of them, in Ussher Town, one of Accra’s oldest neighbour- hoods is the stool house of the royal Nikolai family of the Asere Division. On a mural in the courtyard of the compound, the wan- derings of the Ga-Adangme ancestor, Ayi Kushie, from Israel to Ethiopia and of Nikolai (Ni Koi Olai), the patriarch of the Asere, from Kush (Sudan) into West Africa in 1424 are portrayed. From there, one of his descendants, Nii Nikolai Ashaley I, led his peo- ple to the coastal area, where they settled at Ga Mashie, present- day Accra, in 1660. The other house, a 30-minute walk along the coast to the east on Castle Drive in Osu, Christiansborg (present-day Accra) and op- posite the old Danish cemetery, holds the burial place of Wulff Joseph Wulff, a Danish Jew who settled in Osu (present-day Ac- cra) in 1836.Through his relationship with a local woman, Wulff established the line of the Wulffs within Osu’s prominent fami- lies. -

Encounters in Quest of Christian Womanhood Studies in Christian Mission
Encounters in Quest of Christian Womanhood Studies in Christian Mission General Editors Marc R. Spindler, Leiden University Heleen L. Murre-van den Berg, Leiden University Editorial Board Peggy Brock, Edith Cowan University James Grayson, University of Sheffield David Maxwell, Keele University VOLUME 39 Encounters in Quest of Christian Womanhood The Basel Mission in Pre- and Early Colonial Ghana By Ulrike Sill LEIDEN • BOSTON 2010 Cover illustration: Archive Mission 21/Basel Mission QD-30.016.0009 “Indigenous teachers. In the centre of the front row: Mrs Lieb.” Ghana Taken Between 1.01.1881 and 31.12.1900 This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Sill, Ulrike. Encounters in quest of Christian womanhood : the Basel Mission in pre- and early colonial Ghana / by Ulrike Sill. p. cm. — (Studies in Christian mission, 0924-9389 ; v. 39) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-18450-3 (hardback : alk. paper) 1. Missions—Ghana—History—19th century. 2. Christian women—Ghana— History—19th century. 3. Evangelische Missionsgesellschaft in Basel—History—19th century. 4. Ghana—Church history—19th century. I. Title. II. Series. BV3625.G6S56 2010 266’.0234940667082—dc22 2010011777 ISSN 0924-9389 ISBN 978 90 04 18888 4 Copyright 2010 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Hotei Publishing, IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and VSP. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. -

XV ISSPD Congress Personality Disorder, Functioning and Health
International Society for the Study of Personality Disorders XV ISSPD Congress Personality disorder, functioning and health September 25 – 28, 2017 | Heidelberg, Germany FINAL PROGRAM www.isspd2017.com Table of Contents Congress President Page Sabine Herpertz, Germany President ISSPD 3 Welcome Address Chair of the Scientific Committee Katja Bertsch, Germany 4 About ISSPD Organisational Committee Katja Bertsch, Germany 5 Floor Plan Andrew Chanen, Australia Sabine Herpertz, Germany Steven Huprich, USA 6 Format Descriptions, Elsa Ronningstam, USA Topics and Program Structure Ulrich Schwenger, Germany 7 Pre-Conference Workshops Scientific Committee Anthony Bateman, United Kingdom Monday, September 25, 2017 Katja Bertsch, Germany Martin Bohus, Germany Scientific Program Andrew Chanen, Australia Marianne Goodman, USA 8 Tuesday, September 26, 2017 Steven Huprich, USA Michael Kaess, Germany 14 Wednesday, September 27, 2017 Elsa Ronningstam, USA 21 Thursday, September 28, 2017 Christian Schmahl, Germany Eric Simonsen, Denmark Stephanie Stepp, USA 28 Poster Presentations Johannes Zimmermann, Germany 33 Congress Information Congress and Exhibition Office 37 List of Chairpersons Office Hamburg and Presenters Hanser & Co GmbH Zum Ehrenhain 34 | D-22885 Barsbüttel, Germany Email: [email protected] www.isspd2017.com Organizer The International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) 341 Science Complex Eastern Michigan University Psychology Department Ypsilanti, MI 48197-6229 USA Congress Venue Kongresshaus Stadthalle Heidelberg -

Europe Prize : Additional Information Concerning the Application by the Municipality of Gerlingen, Baden-Württemberg, Federal R
COUNCIL OF EUROPE • — — CONSEIL DE Ls EUROPE CONFIDENTIAL Strasbourg -1-February 1979 ' ' AS/Loc/Prix"(30) 6^-\ - PARLIAMENTARY ASSEMBLY " II PACEC6M053596' COMMITTEE ON REGIONAL PLANNING AND LOCAL AUTHORITIES i ' Sub-Committee on the Europe Prize and the propagation £ of the European idea EUROPE PRIZE Additional information concerning the application by the municipality of GERLINGEN, Baden-Wiirttemberg, Federal Republic of Germany - Replies to the questionnaire /see also AS/Loc/Prix (20) ?o7 58.026 01-. 52 . • CONFIDENTIAL \ CONFIDENTIAL V AS/Loc/Prix (30) 6 - 1 - Replies to the questionnaire Question 1: Membership in organisations of local authorities Reply Yes, of the International Union of Mayors and the Council of European Municipalities. Question 2: Contribution to their activities Reply No events of this kind have as yet taken place in Gerlingen. k Question j5: "Twinning activities" Reply Since 1964., Gerlingen has been twinned with the French town of Vesoul/Haute SaSne (the Deed of Association dates from 24 May 1964 and the text appears in the enclosed brochures). From the beginning, extensive annual programmes have been organised in close co-operation with the municipal authorities, town council, schools, churches, organisations and associations in Vesoul. Specialised twin town committees appointed' by the town councils meet alternately in each town every year to co-ordinate plans and discuss any questions which arise. As proof of the many activities which we organise, we enclose an account of the first ten years of our twin towns scheme, published in 1974, and an outline of the yearly programmes for 1975-78. We have always, and increasingly in recent years, done our best to encourage family contacts and to facilitate the exchange of visits by individual young people.