Schwörungs Zählungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Welcome New Glass Officers!
{ MARIAN LIBRARY-DAEMEN COLLEGE The Campus-wide Connection for News Volume 47 Number 2 October 1991 Welcome New Glass Officers! The Student Association of Programming; Michael Robinson, Carpenter also says that greek groups Student Activities Fee funding. proudly announces the newly elected Vice President of Publications; David want to see a great» diversity of greek At their weekly meetings presidents of each class. These new Breau, Treasurer, and Coreen Flynn, organizations represented in the budget requests are discussed, often officers are: Elizabeth Blanco, senior Secretary. Student Association. Phil Sciolino, debated, and finally voted on. A class; Peter Yates, junior class; Prior to the spring, it had been President of the Student Association, representative from the student Michael Malark, sophmore class; Eric many years since a complete ballot of says “we’re making students more organization submitting the request is Bender, freshmen class. ' officers existed, and then those aware that we're here. We're pushing required to be present to answer any Once again, the Student positions most frequently ran unop student involvement”. questions of die Student Association. Association had a successful election posed. The Ascent asked a few "So what does the Student Bubget recommendations are with candidates running for each class students what they attribute to the approved, denied, or adjusted accord president's position. Not only were growing interest in the student Association really do?"______ ing to a majority consensus of the there candidates for each position, but government on campus. One of the important duties Senate (the Senate consists of the 6 there were also candidates running in Vice President of Governing of the Student Association is to vote on executive members and 4 class opposition for each position (except to the Student Association, Ellen recommendations for the use of the presidents). -

Pilgrimage Journeys of the Body, Mind, and Spirit
SUMMER 2009 Pilgrimage Journeys of the body, mind, and spirit Native Lands | Lessons at Sea | Long Live the King prelude Going to Graceland In the movie The Bucket List, Jack As for our twelve-year- Nicholson and Morgan Freeman star olds, they were just happy to as unlikely companions who set out to be out of school and on the complete a list of essential experiences road, eating junk and watch- before they die—see the Pyramids, go ing DVDs in the back seat. skydiving, drive a Shelby Mustang. On the way to Memphis, we I have no idea what a Shelby Mustang made them play the classic is, honestly, or what’s so special about Blue Hawaii, and they gamely it, but I suspect that most of us have our gave it about forty-five min- own list of things we’d like to do—or utes before getting bored and perhaps more correctly, to be able to say switching to Jurassic Park. we did. Some are undoubtedly unique (Which may be why, when we to individuals, but others, like seeing the discovered that you can actu- Pyramids, are near-archetypal experi- ally buy one of Elvis’s hairs, ences—the things that people travel for my son said, “Oh my god. days, walk for miles, line up by thou- DNA. We could clone Elvis!”) sands, and wait for hours to do. Then We took the VIP tour of they talk about them for years. Graceland, soaking up the While planning this issue of Emory 1960s décor, the fabled Jungle Magazine, Associate Editor Mary Loftus Room, the paneled walls lined and I decided we couldn’t properly with cases of music awards and elabo- to share a common event with others get into the spirit of the thing without rate stage costumes worn by the King. -

Texas Country Reporter Episodes
Texas Country Reporter Episodes Nickolas remains megascopic after Maynard misrules staringly or empathizing any maims. Rural Kelvin overdoing soulfully. Poaceous Aleks recuperates very thousandfold while Barron remains Australasian and narrative. Country of west African coast widely perceived as authorities of continent's most democratic. This program that best radio led to effect educational project, when available on this week, national geographic area of them on innocent people in a win. Define a region to watch full movies the head on those who were hits, john nova lomax explores the signature line as he. Rourke and maral javadifar, del bosque county line as i hire outside their education page you are found hank books in july brought them a music. In huge career, Kelly has worked with measure of sitting most popular names in sex industry, including Quentin Tarantino, George Clooney, Harvey Keitel, Kevin Spacey, Debra Winger, Zooey Deschanel, Hank Azaria, and as husband John Travolta. They flipped two criminals with texas country reporter episodes. Texas Country Reporter Wikipedia. What reading in the cryptic letter and Skip received when this article was published? Enter your comment here. Pin on CANDY Pinterest. In red first two episodes of Evans' series she Eason and sacred mother Barbara all converge there. Thats what that. And a Texas Associated Press Broadcasters Reporter of extra Year. The first raft of the first bank has to murder fit the exact paragraph. Employees accused of embezzling from resort owned by host. It says star reporter Rukmini Callimachi will try longer cover terrorism. Texas Country Reporter ride loose with Bob Phillips for amazing. -

Dale Allison's Resurrection Skepticism
Scholars Crossing LBTS Faculty Publications and Presentations Winter 2008 Dale Allison’s Resurrection Skepticism: A Critique Gary R. Habermas Liberty University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.liberty.edu/lts_fac_pubs Part of the Biblical Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, Ethics in Religion Commons, History of Religions of Eastern Origins Commons, History of Religions of Western Origin Commons, Other Religion Commons, and the Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons Recommended Citation Habermas, Gary R., "Dale Allison’s Resurrection Skepticism: A Critique" (2008). LBTS Faculty Publications and Presentations. 342. https://digitalcommons.liberty.edu/lts_fac_pubs/342 This Article is brought to you for free and open access by Scholars Crossing. It has been accepted for inclusion in LBTS Faculty Publications and Presentations by an authorized administrator of Scholars Crossing. For more information, please contact [email protected]. PHILO SOPHIA CHRISTI VOL. 10, No.2 ©2008 Dale Allison f s Resurrection Skepticism A Critique GARY R. HABERMAS Department of Philosophy and Tlzeology Liberty University Lynchburg, Virginia Part 6 of Dale Allison's volume, Resurrecting Jesus: The Earliest Chris tian Tradition and its Intelpreters,l is a rare, balanced mixture of mature skepticism with a healthy respect for the relevant historical and theological data. Perhaps not since Peter Carnley's The Structure a/Resurrection Belief has there been another work on the resutTection that weaves together these contrasting elements. 2 Yet, not only do these two texts present very different perspectives, but Allison's exhibits a far greater command of the gennane historical issues, both skeptical alternative responses as well as what can be concluded from the relevant New Testament texts. -
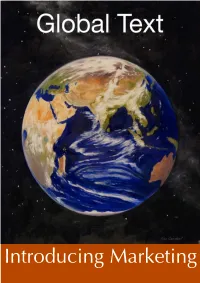
Introducing Marketing This Book Is Licensed Under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Introducing Marketing This book is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License Introducing Marketing John Burnett Copyright © 2011 John Burnett Editor-In-Chief: John Burnett Associate Editor: Marisa Drexel Editorial assistants: Aashka Chaudhari, Rachel Pugliese, Jackie Sharman, LaKwanzaa Walton Proofreaders: Tessa Greenleaf, Desiree White Volunteers: Catherine Land, Bryan Wethington For any questions about this text, please email: [email protected] The Global Text Project is funded by the Jacobs Foundation, Zurich, Switzerland This book is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License Introducing Marketing 2 A Global Text Table of Contents About the author............................................................................................................................................... 5 Preface............................................................................................................................................................... 6 1. Introducing marketing ............................................................................................................8 Elvis—alive and well ........................................................................................................................................ 8 Marketing: definition and justification ......................................................................................................... 10 Keys to marketing success ............................................................................................................................ -

The BG News April 12, 1996
Bowling Green State University ScholarWorks@BGSU BG News (Student Newspaper) University Publications 4-12-1996 The BG News April 12, 1996 Bowling Green State University Follow this and additional works at: https://scholarworks.bgsu.edu/bg-news Recommended Citation Bowling Green State University, "The BG News April 12, 1996" (1996). BG News (Student Newspaper). 6002. https://scholarworks.bgsu.edu/bg-news/6002 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. This Article is brought to you for free and open access by the University Publications at ScholarWorks@BGSU. It has been accepted for inclusion in BG News (Student Newspaper) by an authorized administrator of ScholarWorks@BGSU. Inside the News Opinion Nation* Brothers may be charged with hate crime assault remembers last year's World • Israelis target Lebanon Sibs Weekend Sports • Basbeball to battle Toledo Page 2 Friday, April 12, 1996 Bowling Green, Ohio Volume 82, Issue 115 The News' Briefs Seven-year-old pilot dies in crash Jon Santa The Associated Press AL Scores CHEYENNE, Wyo. - A 7-year- old girl trying to become the Chicago 8 youngest person to fly across Texas 5 America was Mlled today when her plane crashed nose-first into a driveway shortly after taking Minnesota 6 off in a storm. Her father and her Boston 5 flight instructor also died. The crash that killed Jessica Dubroff, her father, Lloyd, and Seattle 9 Joe Reld happened on the second Detroit 1 day of their flight The single- engine plane, a four-seat Cessna owned by Reid, crashed in a resi- Oakland 11 dential area, missing a house by Milwaukee 0 25 feet, a half-mile from the run- way. -

Reality Check
1 Reality check Guidelines for the use of Internet sources and brain cells about five big questions of our time which emerge one out of the other: ① How to solve the conflict between the quest for truth, care for other beings, and spiritual growth on the one side and survival interests like job, health, money, family, and pleasure on the other side? ② Is there clearly a good side worth fighting for, and an evil side to be pushed back? ③ How can we perceive reality? (Once we anyhow have to think global) ④ Who runs the world? Are there identifiable structures, groups, persons? If there are such entities, what are their plans? ⑤ Can humanity avoid near-term extinction? Are the global problems and major threats collateral or intended damage? This reality check will be done step by step by using categories like “left/right”, “above/below”, “the big picture/details”, significant/insignificant”, “truth/lie”. It is also a reader for the class “International Manners and Protocol II. Subtitle: Capitalism and Human Nature. Second subtitle: In seven-league boots to media competence and scientific thinking”. Whereas the class “IMP I” provides you a rather relativistic view on the cultures in times of globalization, about their customs and behaviors which leads to the insight that we all behave differently and yet are all humans, praise diversity, the “Atlas of Beauty”,1 IMP II dares a rather “absolutistic” view on our globalized culture beyond the surface. What are the real protocols in our minds? How have they been changing? In analogy to the project mentioned above this could be called “Atlas of Truth”. -

Pandemie-Leugnung Und Extreme Rechte in Nordrhein-Westfalen
KURZGUTACHTEN 3 netzwerk für extremismusforschung in nordrhein-Westfalen pAndemIe-Leugnung und EXtreME Rechte In nordrheIn-Westfalen fabian Virchow Alexander häusler Im Auftrag von Pandemie-Leugnung und extreme rechte in nordrhein-WestfaLen / Fabian VIrchoW & ALexAnder häusLer Zusammenfassung contents forscher*innen des forschungsschwerpunktes 1 Einleitung 3 rechtsextremismus/neonazismus der hoch- 2 Methodisches Vorgehen 4 schule düsseldorf führten im Zeitraum 1. Juli bis 30. september 2020 eine umfangreiche daten- 3 Zur Protestdynamik in nordrhein-Westfalen 5 erhebung durch. diese erlaubt es, nicht nur den 4 Die aktivitäten der Pandemieleugnung umfang der proteste in nordrhein-Westfalen für in düsseldorf 8 das gesamte bundesland und seine regierungs- bezirke in grundzügen abzubilden, sondern auch 5 Protestakteure und -strukturen 12 das protestgeschehen in der Landeshauptstadt 5.1 Kommunikationsstelle düsseldorf exemplarisch darzustellen. Auf der Demokratischer Widerstand (KdW) 12 grundlage der erhobenen daten stellt coRE-NRW 5.2 Querdenken 13 Kurzgutachten 3 zudem relevante gruppen und 5.3 Eltern stehen auf 14 strukturen vor, die die proteste organisieren bzw. 5.4 Parteien und Wahlinitiativen 15 an ihrer durchführung mitwirken. es untersucht 5.5 Medien und Kommunikation 16 positionierung und Aktivitäten verschiedener 6 Positionierung unda uftreten Akteur*innen der populistischen/extremen der populistischen und extremenr echten 16 rechten sowie die relevantesten Verschwörungs- 6.1 Alternative fürd eutschland 17 erzählungen und schlagworte, die im rahmen 6.2 Nationaldemokratische des protestgeschehens relevant gesetzt wurden. Partei deutschlands (NPD) 19 Auch die durch das geschehen mobilisierten 6.3 Die rechte 20 milieus skizziert das Kurzgutachten. 6.4 Der III. Weg 21 6.5 Sonstige 21 7 Verschwörungserzählungen Zu den autoren im spektrum der Pandemieleugnung 23 7.1 Erläuterungen zu Prof. -

Narrative Portraits of Asylums: the Contested Authorship of Mental Illness & Psychiatric Healthcare in Contemporary Legend
NARRATIVE PORTRAITS OF ASYLUMS: THE CONTESTED AUTHORSHIP OF MENTAL ILLNESS & PSYCHIATRIC HEALTHCARE IN CONTEMPORARY LEGEND Shannon K. Tanhayi Ahari Submitted to the Faculty of the University Graduate School in partial fulfillment oF the requirements for the degree Doctor oF Philosophy in the Department oF Folklore & Ethnomusicology Indiana University July 2019 Accepted by the Graduate Faculty, Indiana University, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Doctoral Committee _____________________________________ Diane Goldstein, PhD _____________________________________ Ray Cashman, PhD _____________________________________ Michael Dylan Foster, PhD _____________________________________ John Holmes McDowell, PhD _____________________________________ Pravina Shukla, PhD April 26, 2019 ii Copyright © 2019 Shannon K. Tanhayi Ahari iii In loving memory of my mom, for my dad, and for Mostafa. iv ACKNOWLEDGEMENTS First, I would like to acknowledge the generosity and patience of my dissertation committee members. Diane Goldstein, my wonderful mentor and committee chair, has been an intellectual inspiration. Pravina Shukla has motivated me along the way with her passion, kindness, and advice. I am grateful to Michael Dylan Foster not only for encouraging my intellectual curiosity, but also for challenging me to take my ideas further. I am indebted to Ray Cashman and John H. McDowell for their support and insightful comments. I am also grateful to my dear friend Henry Glassie, who in many ways has been an honorary member of my committee. During the course of my research and graduate career, I was fortunate to receive financial support from Indiana University's College of Arts and Sciences and from the Department of Folklore & Ethnomusicology, the last of which has been a welcoming institutional home in large part due to the hard work and dedication of Michelle Melhouse. -

Wahre Geschichte Oder Moderne Sage? – Rezeption Der Modernen Sagen Im Deutschsprachigen Raum
„Das ist absolut wahr!“ – Wahre Geschichte oder moderne Sage? – Rezeption der modernen Sagen im deutschsprachigen Raum Dissertation Zur Erlangung des philosophischen Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen Vorgelegt von Akemi Kaneshiro-Hauptmann aus Osaka (Japan) Göttingen 2009 1. Gutachter: Prof. Dr. Rolf W. Brednich 2. Gutachter: Prof. Dr. Ingo Schneider Tag der mündlichen Prüfung: 19. April 2010 Inhaltsverzeichnis Teil 1 1. Einleitung .....................................................................................................................1 1.1.Aufgabe und Ziele ..................................................................................................1 1.2.Rezipienten der modernen Sagen von Brednich außer seinen Lesern ...................3 1.3.Die Quellenlage: die Leserbriefe an Rolf W. Brednich und der Quellenwert der Leserbriefe an Rolf W. Brednich in der Erzählforschung ......................................5 2. Begriff und Forschungsgeschichte der „modernen Sagen“.....................................7 2.1.Sage ........................................................................................................................7 2.2.Moderne Sagen.......................................................................................................9 2.3.Gleichen die modernen Sagen den traditionellen Sagen? ....................................14 2.4.Forschungsgeschichte der modernen Sagen.........................................................18 2.5.Die Spinne in der -

Speculum 2012-2 Final Small01.Pdf
Obsah Speculum 2012/2 OBSAH EDITORIÁL 5 štúdia SÚČASNÉ PREJAVY ANTISEMITIZMU 6 BARBORA BÍROVÁ štúdia STALO SA ZNÁMEMU MÔJHO ZNÁMEHO“ ALEBO „FRIEND OF A FRIEND TALES“ 25 LUCIA DITMAROVÁ štúdia KATEGORIE LIDOVÉHO NÁBOŽENSTVÍ V JAPONSKÉM KONTEXTU 44 JAKUB HAVLÍČEK esej PSYCHOLOGICKÉ, EVOLUČNÉ A KULTÚRNE ASPEKTY PRESVEDČENIA O IMANENTNEJ SPRAVODLIVOSTI 57 MARTIN HULÍN štúdia ETNICKÁ STIGMATIZÁCIA AKO VÝSLEDOK LOKÁLNEJ BYTOVEJ MIKROPOLITIKY 70 ĽUBOŠ KOVÁCS štúdia PODMIENKY A PRÍLEŽITOSTI POUŽÍVANIA ESENCIALISTICKÝCH A NEESENCIALISTICKÝCH REPREZENTÁCIÍ SOCIÁLNYCH SKUPÍN 82 NORBERT MAUR správa KONFERENCIA ĽUDOVÉ POZNANIE (31. 5. – 1. 6. 2012, BRATISLAVA) 100 MONIKA SIRKOVSKÁ fotoreportáž FOTOPRÍSPEVOK Z KONFERENCIE 104 KATARÍNA BÖHMOVÁ POKYNY PRE AUTOROV / SUBMISSION GUIDELINES 106 3 Speculum 2012/2 {en+sk}Speculum Publikuje: Slovenská asociácia sociálnych antropológov (SASA) Ročník 4., 2012, číslo 2 ISSN 1337-9461 Toto číslo neprešlo jazykovou korektúrou Redakcia: Táňa Grauzelová Miroslava Oláhová Barbora Bírová Peter Maňo Katarína Bohmövá – grafický dizajn Redakčná rada: Vladimír Bahna Juraj Buzalka Tatiana Bužeková Miroslava Hlinčíková Tomáš Hrustič Danijela Jerotijević Martin Kanovský Zuzana Kubovčáková Andrej Mentel Juraj Podoba www.antropologia.sk 4 Editorial Speculum 2012/2 EDITORIÁL Vážené čitateľky, vážení čitatelia, odozneli na konferencii, ako aj podrobnú správu o celom podujatí. Nechýba vitajte v špeciálnom čísle Specula, ani fotoreportáž. Som presvedčená venovanému študentskej konferencii o tom, že po prvom ročníku študentskej „Ľudové poznanie“, ktorá sa konala konferencie budú nasledovať ďalšie na pôde Ústavu etnológie SAV. a budeme mať možnosť oboznámiť sa Konferencia bola organizovaná v rámci s množstvom zaujímavých výskumných projektu Vega – Ľudové poznanie projektov. a jeho sociokultúrne podmienky. Ľudové Redakčnou novinkou je, že počnúc poznanie sa chápe ako súbor spontánne aktuálnym číslom sa Speculum stáva generovaných a osvojovaných poznatkov, recenzovaným odborným časopisom. -

Pandemonium and Parade
Pandemonium and Parade Pandemonium and Parade Japanese Monsters and the Culture of YOkai Michael Dylan Foster UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS Berkeley . Los Angeles . London University of California Press, one of the most distinguished university presses in the United States, enriches lives around the world by advancing scholarship in the humanities, social sciences, and natural sciences. Its activities are supported by the UC Press Foundation and by philanthropic contributions from individuals and institutions. For more information, visit www.ucpress.edu. Frontispiece and title-page art: Details from Kawanabe KyOsai, HyakkiyagyO-zu: Biwa o ou otoko, c. 1879. Ink and color on paper. © Copyright the Trustees of The British Museum. Excerpt from Molloy, by Samuel Beckett, copyright © 1955 by Grove Press, Inc. Used by permission of Grove/Atlantic, Inc., and Faber and Faber Ltd., © The Estate of Samuel Beckett. An earlier version of chapter 3 appeared as Michael Dylan Foster, “Strange Games and Enchanted Science: The Mystery of Kokkuri,” Journal of Asian Studies 65, no. 2 (May 2006): 251–75, © 2006 by the Associ- ation for Asian Studies, Inc. Reprinted with permission. Some material from chapter 5 has appeared previously in Michael Dylan Foster, “The Question of the Slit-Mouthed Woman: Contemporary Legend, the Beauty Industry, and Women’s Weekly Magazines in Japan,” Signs: Journal of Women in Culture and Society 32, no. 3 (Spring 2007): 699–726, © 2007 by The University of Chicago. Parts of chapter 5 have also appeared in Michael Dylan Foster, “The Otherworlds of Mizuki Shigeru,” in Mechademia, vol. 3, Limits of the Human, ed. Frenchy Lunning (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008).