Membra Jesu Nostri Buxwv 75
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Membra Jesu Nostri
Diskothek: Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri Montag, 26. März 2018 20.00 - 22.00 Uhr, SRF 2 Kultur Samstag, 31. März 2018 14.00 - 16.00 Uhr, SRF 2 Kultur (Zweitsendung) Gäste im Studio: Julia Schröder (Geigerin) und Jean-Christophe Groffe (Sänger). Gastgeberin: Jenny Berg Das Resultat Aufnahmen mit Werken aus der Barockzeit zeigen oft grosse Unterschiede, da die Barockmusik den Interpretinnen und Interpreten viele Freiheiten lässt. So ist es auch bei Dietrich Buxtehudes «Membra Jesu nostri»: Es gibt chorische und solistische Besetzungen, unterschiedlich gestimmte Instrumente, italienische und lateinische Textaussprache bei diesen fünf Aufnahmen – und es gibt noch etliche weitere Interpretationen auf dem CD-Markt. In Runde eins wird die Tempowahl zum Ausschlusskriterium: René Jacobs mit dem Concerto Vocale Gent (A3) geht die Beschreibung der Körperteile Jesu zu sportlich an, das Bach Collegium Japan mit Dirigent Masaaki Suzuki (A4) schwankt zu stark im Tempo – eine vergleichsweise gute, aber auch gewöhnliche Interpretation, fanden die beiden Gäste. In der zweiten Runde scheidet das Purcell Quartett (A5) aus – eine Aufnahme mit ausgezeichneten Sängern, dafür aber mit einer recht schlichten Gestaltung des Basso continuo. Am Schluss gibt es einen klaren Sieger: Obwohl Cantus Cölln mit Konrad Junghänel (A1) immer wieder für Gänsehaut sorgt, den Text bewusst ausgestaltet und sehr rhythmisch agiert, überzeugt über alle drei Runden die Aufnahme mit Ton Koopmann und dem Amsterdam Baroque Orchestra & Choir) am meisten (A2). Er hat das Werk mehrfach aufgenommen, dies hier ist die zweite Einspielung: Eine sehr lebendige Aufnahme, die ins Innere geht, die die Stimmungen bewusst einsetzt, um die harmonischen Bewegungen zu schärfen, und dabei elegant und historisch informiert verziert. -

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Membra Jesu Nostri
Dietrich Buxtehude (1637-1707) Membra Jesu Nostri Tanya Aspelmeier, Stéphanie Révidat, Salomé Haller, sopranos Rolf Ehlers, haute-contre Julian Prégardien, ténor Benoît Arnould, basse LA CHAPE ll E RHÉNANE LA MAÎT R ISE DE GA R ÇONS DE CO lm A R DIRECTION : ARLETTE STEYER DIRECTION : BENOÎT HA LLER 1 Dietrich Buxtehude (1637-1707) Membra Jesu Nostri 1 Ad pedes - Ecce super montes 7’40 2 Ad genua - Ad ubera portabimini 9’50 3 Ad manus - Quid sunt plagae istae 9’06 4 Ad latus - Surge amica mea 9’13 5 Ad pectus - Sicut modo geniti infantes 9’27 6 Ad cor - Vulnerasti cor meum 9’03 7 Ad faciem - Illustra faciem tuam 6’16 > minutage total : 60’35 2 LA CHAPE ll E RHÉNANE Tanya Aspelmeier(6), Stéphanie Révidat(1,7), Salomé Haller(1,5,7) Sopranos Rolf Ehlers Haute-contre Julian Prégardien Ténor Benoît Arnould Basse Cosimo Stawiarski, Isabel Schau Violons Sergio Alvarez, Barbara Leitherer, François-Joubert Caillet, Anne-Garance Fabre-Garrus Violes de gambe Armin Bereuter Violone en sol Élodie Peudepièce Violone en ré Jennifer Harris Basson Thomas Boysen Théorbe Marie Bournisien Harpe Sébastien Wonner Orgue et Clavecin LA MAÎT R ISE DE GA R ÇONS DE CO lm A R DIRECTION : ARLETTE STEYER DI R E C TION : BENOÎT HA ll E R 3 Pour le présent enregistrement La Maîtrise de Garçons de Colmar était composée de : Les garçons Sopranos : ARMSPACH-YOUNG Thomas - BARTH François - DIESEL Noé - DROTHIERE Valentin - PAULUS Loïc SCHIELE Jean-Baptiste - SCHMITT Elliott - WEYMANN Vincent Mezzo-sopranos : BUCHER Romain - DECHRISTE Gauthier - GLEYZE Tom - GRAVRAND Dorian -

Figurenlehre and Affektenlehre in Buxtehude's Membra Jesu Nostri
Figurenlehre and Affektenlehre in Buxtehude’s Membra Jesu ostri © 2006 Helen K. H. Wong Per medullam cordis mei, Into the depths of my heart, Peccatoris atque rei, Sinful and wicked, Tuus amor transferatur, Let thy love be transported, Quo cor tuum rapiatur This love bereft of thy heart, Languens amoris vulnere. Languishing with love’s wounds. Viva cordis voce clamo, With my heart’s own voice I beseech thee, Dulce cor, te namque amo, Sweet heart, for I love thee, Ad cor meum inclinare, To incline thyself upon my heart, Ut se posit applicare That it may cleave Devoto tibi pectore. To thy venerated breast. (Buxtehude, Membra Jesu Nostri, “Ad Pectus”) Like many of his sacred vocal works, Buxtehude’s Membra Jesu ostri , a cycle of seven cantatas, has been associated by writers on music with its Pietist qualities for its choice of text. 1 A composite of Latin blibical texts and medieval poems of a subjective religious tone, each of the seven cantatas represents a spiritual contemplation on one of the parts of Christ’s crucified body: feet, knees, hands, side, breast, heart and face. 2 While the poems indeed 1 The intense personal and subjective language of the poem can be compared to an analogy made by Abraham Calovius (1612-86), the German Lutheran theologian of the 17 th century on the relationship between Christ and the Pietist believers: “ The espousal (marriage) of Christ with belivers is that which He eternally marries Himself to believers through faith, so that they become one spirit, and by His power communicates to them, as to His spiritual bride, intimate and enduring love, all His blessings and all His glory, so as to finally lead them to Him home, and dwell with them in His celestial and eternal kingdom.”Explains a bit about Pietism and music. -

Membra Jesu Nostri&Quo
[敎科敎育硏究, 제35권 제1호(2014.6), pp.45~70] Studies in Educational Research 합창 음악지도를 위한 북스데후데의 음악연구 김연주 (아주사 퍼시픽 대학교) A Study on Buxtehude’s Choral Music "Membra Jesu Nostri" Youn-Ju Kim (Azusa Pacific University, USA) Abstract: Dieterich Buxtehude (ca. 1637-1707) is known for his many organ works. However, no significant portion of his choral music is in the standard performing repertoire. Buxtehude’s large-scale choral work Membra Jesu Nostri should be considered a seminal “passion” composition in part because of its historic position in early German Lutheran church music. It also serves as an example of the heightened levels of affect in a seventeenth century devotional passion. To better understand Buxtehude and his music, an overview of his life, career and religious beliefs are discussed, including the incorporation of pietism and mysticism in his cantata, Membra Jesu Nostri. Details of the composition’s structure, unifying thematic elements and text sources with translations are included. Through these observations, it will be shown that Buxtehude’s Membra Jesu Nostri is one of the most well-conceived and well-constructed choral works of the early Baroque era. Key words : Buxtehude, choral music, passion, Membra Jesu Nostri I. Introduction A prolific composer of sacred vocal and instrumental ensemble music, Dietrich Buxtehude’s (ca. 1637-1707) fame as a composer mainly derives from works that he composed during his tenure as organist at Marienkirche (St. Mary’s Church) in Lübeck. He also composed vocal cantatas, concertos, and oratorios, though his position did not require him to do so. In actuality, his surviving vocal music outnumbers his keyboard and ensemble pieces, totaling - 45 - 敎科敎育硏究, 제35권 제1호(2014.6) more than 120 vocal and choral works, 120 keyboard pieces, and twenty-one instrumental sonatas. -

A 16Th-Century Meeting of England & Spain
A 16th-Century Meeting of England & Spain Blue Heron with special guest Ensemble Plus Ultra Saturday, October 15, 2011 · 8 pm | First Church in Cambridge, Congregational Sunday, October 16, 2011 · 4 pm | St. Ignatius of Antioch Episcopal Church, New York City A 16th-Century Meeting of England & Spain Blue Heron with special guest Ensemble Plus Ultra Saturday, October 15, 2011 · 8 pm | First Church in Cambridge, Congregational Sunday, October 16, 2011 · 4 pm | St. Ignatius of Antioch Episcopal Church, New York City Program Blue Heron & Ensemble Plus Ultra John Browne (fl. c. 1500) O Maria salvatoris mater a 8 Blue Heron Richard Pygott (c. 1485–1549) Salve regina a 5 intermission Ensemble Plus Ultra Tomás Luis de Victoria (1548–1611) Ave Maria a 8 Ave regina caelorum a 8 Victoria Vidi speciosam a 6 Vadam et circuibo civitatem a 6 Nigra sum sed formosa a 6 Ensemble Plus Ultra & Blue Heron Victoria Laetatus sum a 12 Francisco Guerrero (1528–99) Duo seraphim a 12 Blue Heron treble Julia Steinbok Teresa Wakim Shari Wilson mean Jennifer Ashe Pamela Dellal Martin Near contratenor Owen McIntosh Jason McStoots tenor Michael Barrett Sumner Thompson bass Paul Guttry Ulysses Thomas Peter Walker Scott etcalfe,M director Ensemble Plus Ultra Amy Moore, soprano Katie Trethewey, soprano Clare Wilkinson, mezzo-soprano David Martin, alto William Balkwill, tenor Tom Phillips, tenor Simon Gallear, baritone Jimmy Holliday, bass Michael Noone, director Blue Heron · 45 Ash Street, Auburndale MA 02466 (617) 960-7956 · [email protected] · www.blueheronchoir.org Blue Heron Renaissance Choir, Inc. is a 501(c)(3) tax-exempt entity. -

Membra Jesu Nostri (1680)
30 VAN DEN BERG Dissecting Jesus The Spiritual Role of the Senses in Buxtehude’s Cantata Cycle Membra Jesu Nostri (1680) Clemens van den Berg ABSTRACT The influence of German Pietism, a Protestant spiritual movement emphasizing the corporeal and the sensorial, on baroque composer Dieterich Buxtehude (ca. 1637-1707) has long been discussed among historians and musicologists of the seventeenth century like Martin Geck and Isabella van Elferen. However, current scholarship lacks detailed analyses of the composer’s individual works to assess how and to what extent this influence occurred. This paper, therefore, examines the contents of Membra Jesu Nostri, a peculiar composition by Buxtehude in which adoration of the limbs of Christ’s crucified body happens both textually and musically. This paper expands on the recent attention for the role of the senses in religious contexts and uses concepts from material religion to scrutinize the choices the composer made in his libretto and musical framework, thus tackling the issue of corporeal spirituality in Membra. It concludes that this specific compositional cycle does reflect Pietist inspiration, with a particularly striking role of the union of the senses: all co-operate to ensure a total immersion in the veneration of Christ’s body. KEYWORDS Dieterich Buxtehude, Baroque Music, German Pietism, History of Religion (17th Century), Sensorial Religion, Corporeal Religion. INTRODUCTION In 1680, the Northern German composer Dieterich (alternative spellings Dietrich and Diderich) Buxtehude (ca. 1637-1707) dedicated a cycle6 of seven Latin cantatas to his Swedish colleague Gustav Düben (1628-1690). The work categorized as BuxWV 757 is fully titled Membra Jesu nostri patientis sanctissima (Latin: “The Most Holy Limbs of Our Suffering Lord Jesus”), but better Junctions: Graduate Journal of the Humanities Clemens van den Berg. -

Dieterich Buxtehude's Membra Jesu Nostri: an Historical Overview, Analysis and Conducting Guide by Youn Ju Kim a Research Pa
Dieterich Buxtehude’s Membra Jesu Nostri: An historical overview, analysis and conducting guide by Youn Ju Kim A Research Paper Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Musical Arts Approved March 2012 by the Graduate Supervisory Committee: Gregory Gentry, Chair Gary Hill William Reber Rodney Rogers Timothy Russell ARIZONA STATE UNIVERSITY May 2012 ABSTRACT Dieterich Buxtehude (ca. 1637-1707) is known for his many organ works. However, no significant portion of his choral music is in the standard performing repertoire. Buxtehude’s large-scale choral work Membra Jesu Nostri should be considered a seminal “passion” composition in part because of its historic position in early German Lutheran church music. It also serves as an example of the heightened levels of affect in a seventeenth century devotional passion. To better understand Buxtehude and his music, an overview of his life, career and religious beliefs are discussed, including the incorporation of pietism and mysticism in his cantata, Membra Jesu Nostri. Details of the composition’s structure, unifying thematic elements and text sources with translations are included. Historical performance practices are discussed, including the composer’s probable intent of having one of the seven cantatas performed every day before Easter. This research study also provides conductors with a variety of practical performance considerations. Through these observations, it will be shown that Buxtehude’s Membra Jesu Nostri is one of the most well-conceived and well-constructed choral works of the early Baroque era. i DEDICATION In nomine Jesu, Soli Deo Gloria (In the name of Jesus, to God alone be the glory) And to my parents Kim, Ha Sub and Lee, Jung Ji My love and respect will always be with you. -

Membra Jesu Nostri
CORO The Sixteen Edition CORO The Sixteen Edition Victoria Heinrich Schütz The Mystery of the Cross Musikalische Exequien Dietrich Victoria: “The sombre colours the most outstanding of Schütz's moving Buxtehude composer of the funeral music are Renaissance finely brought out in this collection.” “Music Christophers was the guardian born to conduct.” bbc radio 3, Membra cd review cor16021 cor16036 Handel J. S. Bach Jesu Messiah 3 CDs (Special Edition) Cantatas 34, 50, 147 Carolyn Sampson “…a pleasure to listen Catherine Wyn-Rogers to when played and Nostri Mark Padmore sung as well as this.” Christopher Purves the independent “…this inspiriting new performance becomes a first choice.” The Sixteen HARRY CHRISTOPHERS the sunday times cor16062 cor16039 To find out more about The Sixteen, concert tours, and to buy CDs visit www.thesixteen.com cor16082 or some people, the cyclic title Fof these cantatas by Buxtehude might conjure up a rather morbid JANE COE (1953–2007) picture. However, this meditation on Jane Coe was principal cellist the Passion, in which each of the of The Sixteen for twenty years seven cantatas contemplates parts of and we are fortunate enough Christ’s body on the cross (feet, knees, Borggreve Marco Photograph: to have recorded many CDs hands, side, breast, heart and head), is full of beauty, hope and invention. on which you can hear Jane’s exquisite playing. This disc, It is very much a chamber work and which she loved dearly, is requires a certain intimacy between performers. In the year 2000 I was very fortunate to have five choir members dedicated to her memory. -

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Was a Student of Heinrich Scheidemann, Organist in Hamburg and a Student of Sweelinck
Buxtehudebookletnw 26/1/06 11:21 Pagina 1 CHANNEL CLASSICS CCS SA 24006 d.buxtehude Membra Jethesu netherlandsNostri bach society Jos van Veldhoven conductor Buxtehudebookletnw 26/1/06 11:21 Pagina 2 The Netherlands Bach Society Jos van Veldhoven conductor Anne Grimm soprano 1 Johannette Zomer soprano 2 Peter de Groot alto Andrew Tortise tenor Bas Ramselaar bass Antoinette Lohmann violin Pieter Affourtit violin Mieneke van der Velden viola da gamba (also continuo) Eva Reiter viola da gamba Josh Cheatham viola da gamba Ricardo Rodriguez Miranda viola da gamba (also continuo) Nick Milne viola da gamba Lucia Swarts violoncello Dane Roberts double bass Pieter Dirksen organ & clavicord Mike Fentross theorbo Illustration 1: Title page of Membra Jesu Nostri (Uppsala, University Library) 2 Buxtehudebookletnw 26/1/06 11:21 Pagina 3 t is now fairly certain that Dietrich Buxtehude (1637-1707) was a student of Heinrich Scheidemann, organist in Hamburg and a student of Sweelinck. Buxtehude’s studies would have occurred around I 1655. At this time his fellow student was Johann Adamsz Reincken of Deventer, who would become his lifelong friend. Thanks to this friendship, he became one of that impressive group of organist- composers from the Baltic area, known collectively as the ‘Sweelinck school’. Their elevated, ‘learned’ composing style and virtuosity as performers and improvisers amounted to a carefully guarded ‘secret’ which could only be transmitted among the members of this guild, from teacher to student. While the first generation of Sweelinck’s students, the most important of whom was Scheidemann, confined themselves primarily to organ playing and composing for the organ, their students, in turn, went a step further. -
Buxtehude Membra Jesu Nostri
Buxtehude Membra Jesu nostri Emma Kirkby soprano The Purcell Quartet Elin Manahan Thomas soprano Michael Chance counter-tenor Charles Daniels tenor Peter Harvey bass Fretwork CHANDOS early music Autograph title page of Buxtehude’s ‘Membra Jesu nostri’ Dietrich Buxtehude (c. 1637–1707) Membra Jesu nostri, BuxWV 75* 65:15 I. Ad pedes 1 1 Sonata 0:45 2 2 Tutti. Ecce super montes 1:14 3 3 Aria. Salve mundi salutare 4:59 4 4 Tutti. Ecce super montes 1:16 5 5 Tutti. Salve mundi salutare 0:59 II. Ad genua 6 6 Sonata in tremulo 1:04 7 7 Tutti. Ad ubera portabimini 1:34 8 8 Aria. Salve Jesu, rex sanctorum 3:44 9 9 Tutti. Ad ubera portabimini 1:39 III. Ad manus 10 10 Sonata 0:56 11 11 Tutti. Quid sunt plagae istae 1:58 12 12 Aria. Salve Jesu, pastor bone 5:07 13 13 Tutti. Quid sunt plagae istae 2:15 IV. Ad latus 14 14 Sonata 0:26 15 15 Tutti. Surge, amica mea, speciosa mea 1:44 16 16 Aria. Salve latus salvatoris 4:40 17 17 Tutti. Surge, amica mea, speciosa mea 1:58 3 V. Ad pectus 18 18 Sonata 0:40 19 19 Voci. Sicut modo geniti infantes rationabiles 2:20 20 20 Aria. Salve, salus mea, Deus 5:21 21 21 Voci. Sicut modo geniti infantes rationabiles 2:40 VI. Ad cor 22 22 Sonata 1:48 23 23 Doi Soprani è Basso. Vulnerasti cor meum 2:21 24 24 Aria. Summi Regis cor, aveto 3:04 25 25 Doi Soprani è Basso. -

4860739-3D7bc9-809478090236.Pdf
Title page of Buxtehude’s 1680 manuscript of Membra Jesu nostri Dieterich Buxtehude c.1637 –1707 Membra Jesu nostri BuxWV75 15 15. Tutti: Surge, amica mea, speciosa mea 1.44 I. Ad pedes 16 16. Aria: Salve latus salvatoris 4.12 1 1. Sonata 0.44 17 17. Tutti: Surge, amica mea, speciosa mea 1.50 2 2. Tutti: Ecce super montes 1.13 V. Ad pectus 3 3. Aria: Salve mundi salutare 4.31 18 18. Sonata 0.39 4 4. Tutti. Ecce super montes 1.12 19 19. Voci: Sicut modo geniti infantes rationabiles 2.43 5 5. Tutti: Salve mundi salutare 0.55 20 20. Aria: Salve, salus mea, Deus 4.08 II. Ad genua 21 21. Voci: Sicut modo geniti infantes rationabiles 2.53 6 6. Sonata in tremulo 1.16 VI. Ad cor 7 7. Tutti: Ad ubera portabimini 1.34 22 22. Sonata 1.40 8 8. Aria: Salve Jesu, rex sanctorum 3.44 23 23. Doi Soprani è Basso: Vulnerasti cor meum 2.11 9 9. Tutti: Ad ubera portabimini 1.40 24 24. Aria: Summi Regis cor, aveto 3.00 III. Ad manus 25 25. Doi Soprani è Basso: Vulnerasti cor meum 2.15 10 10. Sonata 0.56 VII. Ad faciem 11 11. Tutti: Quid sunt plagae istae 2.03 26 26. Sonata 0.37 12 12. Aria: Salve Jesu, pastor bone 4.47 27 27. Tutti: Illustra faciem tuam super 1.20 13 13. Tutti: Quid sunt plagae istae 2.03 servum tuum IV. Ad latus 28 28. Aria: Salve, caput cruentatum 3.43 14 14. -
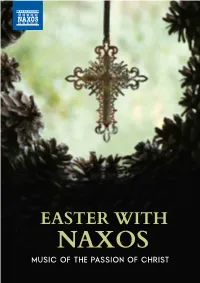
EASTER with NAXOS MUSIC of the PASSION of CHRIST Easter with Naxos
EASTER WITH NAXOS MUSIC OF THE PASSION OF CHRIST Easter with Naxos The events of Christ’s Passion have been marked in artistic triumphs over the centuries, not least in music which has a treasure trove of works devoted to the sequence of the action. Just as the Easter story moves from darkness to light, so the works describing it represent the full spectrum of genres and resources. In this catalogue – which also includes titles from Naxos’ affiliated labels – you’ll find masterpieces representative of all musical styles: from Bach’s Passion settings to the Requiems of Mozart, Dvořák and Verdi, plus the more contemporary utterances of works. You’ll also see recordings of instrumental music, such as Messiaen’s L’Ascension, Gubaidulina’s Sieben Worte, and Haydn’s Seven Last Words in its piano version. CONTENTS Naxos Titles Listing by Composer...................................................................................................3 Collections ................................................................................................................15 Audiovisual Products ................................................................................................16 Affiliated Labels Belvedere .................................................................................................................17 Capriccio ..................................................................................................................18 Dynamic ...................................................................................................................23