Der Kiez Um Den Traveplatz (Friedrichshain)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Supporting Information Carbazole-Based Copolymers Via
Electronic Supplementary Material (ESI) for Polymer Chemistry. This journal is © The Royal Society of Chemistry 2017 Supporting Information Carbazole-Based Copolymers via Direct Arylation Polymerization (DArP) for Suzuki- Convergent Polymer Solar Cell Performance Nemal S. Gobalasingham,a Seyma Ekiz,a Robert M. Pankow,a Francesco Livi,a,b Eva Bundgaard,b* and Barry C. Thompsona* aDepartment of Chemistry and Loker Hydrocarbon Research Institute, University of Southern California, Los Angeles, California 90089-1661 bDTU Energy, Technical University of Denmark, Frederiksborgvej 399, 4000, Roskilde, Denmark *email: [email protected] or [email protected] S1 1 Figure S1. H NMR of 2,7-dibromo-9-(heptadecan-9-yl)-9H-carbazole in CDCl3 S2 Figure S2. 1H NMR of 2,5-diethylhexyl-3,6-di(thiophen-2-yl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole- 1,4-dione in CDCl3 S3 Figure S3. 1H NMR of 4,10-bis(diethylhexyl)-thieno[2',3':5,6]pyrido[3,4-g]thieno[3,2- c]isoquinoline-5,11-dione in CDCl3 S4 Figure S4. 1H NMR of 5-octyl-1,3-di(thiophen-2-yl)-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione in CDCl3 S5 1 Figure S5. H NMR of 2,5-bis(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)pyridine in CDCl3 S6 2.13 2.29 2.57 2.13 2.11 2.19 1.00 5.38 7.15 8.05 23.31 7.67 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 1 Figure S6. High Temperature H NMR of P1 in C2D2Cl4 S7 7.66 3.37 22.18 8.41 4.78 3.66 1.00 2.15 2.12 1.86 2.23 2.24 2.07 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 1 Figure S7. -

X-Ray Structural Analyses of Cyclodecasulfur (S10) and of A
X-Ray Structural Analyses of Cyclodecasulfur (S10) and of a Cyclohexasulfur-Cyclodecasulfur Molecular Addition Compound (S6 • S10) [1] Ralf Steudel*, Jürgen Steidel Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Technische Universität Berlin, Sekr. C2, D-1000 Berlin 12 Richard Reinhardt** Institut für Kristallographie der Freien Universität Berlin, Takustraße 6, D-1000 Berlin 33 Dedicated to Professor Dr. Karl Winnacker on the occasion of his 80th birthday Z. Naturforsch. 38 b, 1548-1556 (1983); received August 11, 1983 Elemental Sulfur, Sulfur Rings, Molecular Structure, Crystal Structure, Vibrational Spectra Low temperature X-ray structural analyses of monoclinic single crystals of Sio and Sö • Sio (prepared from the components) show that the cyclic Sio molecule exhibits the same D2 conformation in both compounds with bond distances between 203.3 and 208.0pm, bond angles (a) between 103 and 111°, and torsional angles (r) between 73 and 124°. The Sß molecule (site symmetry Ci) in Sö • Sio is very similar to the one in pure Sö (dss = 206.2 pm, a= 103°, r = 74°). All intermolecular interactions are of van-der-Waals type. The Raman spectrum of S6 • Sio can be explained by a superposition of the Se and Sio spectra. Introduction In all cases the reason for the differing bond distances is the variation of the torsional angles The tremendous industrial importance of ele- leading to a varying degree of lone-pair-lone-pair mental sulfur and its surplus expected for the near repulsion between neighboring atoms. In fact, the future (and occasionally already experienced in the torsional angles r in sulfur rings Sre vary between 0° past) have stimulated considerable research ac- and 140° resulting in a bond length variation of tivities with the result that 19 well characterized 19 pm or 9% [18]. -

Inhibition of Steel Corrosion and Alkaline Zinc Oxide
www.nature.com/scientificreports OPEN Inhibition of Steel Corrosion and Alkaline Zinc Oxide Dissolution by Dicarboxylate Bola-Amphiphiles: Received: 10 March 2017 Accepted: 18 April 2017 Self-Assembly Supersedes Host- Published: xx xx xxxx Guest Conception Dirk Schmelter1, Arthur Langry2, Andrej Koenig1, Patrick Keil1, Fabrice Leroux2 & Horst Hintze-Bruening 1 For many decorative applications like industrial and architectural paints, prevention of metal substrates from corrosion is a primary function of organic coatings. Triggered release of inhibitor species is generally accepted as a remedy for starting corrosion in case of coatings damage. A polyurethane based coating, doped with bola-amphiphiles of varying molecular weight but with a common head group motif that stems from ring-opened alkenyl succinic anhydride, enables passivation of the defect and mitigates cathodic delamination, if applied on cold rolled steel. An antagonistic effect results from the intercalation of the bola-amphiphiles into layered double hydroxide Zn2Al(OH)6 and subsequent incorporation of the hybrid phase into the organic matrix. In particular higher molecular weight bola- amphiphiles get immobilized through alkaline degradation of the layered framework in the basic milieu at the cathode. By means of sediments from colloidal states it is demonstrated that in-situ formed zinc oxide encapsulates the hybrid phase, evidenced by impeded dissolution of the ZnO based shell into caustic soda. While inhibition of steel corrosion results from a Donnan barrier layer, impeded zinc oxide dissolution is rooted in zinc catalyzed bola-amphiphile hydrolysis and layered deposition of the crystalline spacer diol hydrogenated bisphenol-A. Iron, aluminum and their respective alloys are the most widely used metals in civil engineering, infrastructure, transportation and industry1. -

World Para Swimming World Records Long Course
World Para Swimming World Records Long Course World Para Swimming World Records created by IPC Sport Data Management System Gender: Men | Course: Long Course Men's 50 m Freestyle Class Name NPC Birth Time Date City Country S1 Mamistvalov, Itzhak ISR 1979 01:03.80 2014-03-09 Esbjerg Denmark S2 Zou, Liankang CHN 1995 00:50.65 2016-09-11 Rio de Janeiro Brazil S3 Huang, Wenpan CHN 1995 00:38.81 2017-12-06 Mexico City Mexico S4 Leslie, Cameron NZL 1990 00:37.14 2019-09-13 London Great Britain S5 Fantin, Antonio ITA 2001 00:30.16 2019-06-01 Lignano Sabbiadoro Italy S6 Xu, Qing CHN 1992 00:28.57 2012-09-04 London Great Britain S7 Trusov, Andrii UKR 2000 00:27.07 2019-09-15 London Great Britain S8 Tarasov, Denis RUS 1993 00:25.32 2014-08-10 Eindhoven Netherlands S9 Barlaam, Simone ITA 2000 00:24.00 2019-09-15 London Great Britain S10 Brasil, Andre BRA 1984 00:23.16 2012-08-31 London Great Britain S11 Yang, Bozun CHN 1986 00:25.27 2012-09-01 London Great Britain S12 Veraksa, Maksym UKR 1984 00:22.99 2009-10-21 Reykjavik Iceland S13 Boki, Ihar BLR 1994 00:23.20 2015-07-13 Glasgow Great Britain IPC Sport Data Management System Page 1 of 22 29 September 2021 at 00:11:44 CEST World Para Swimming World Records Long Course Men's 100 m Freestyle Class Name NPC Birth Time Date City Country S1 Mamistvalov, Itzhak ISR 1979 02:15.83 2012-09-01 London Great Britain S2 Liu, Benying CHN 1996 01:46.63 2016-09-11 Rio de Janeiro Brazil S3 Lopez Diaz, Diego MEX 1994 01:32.69 2018-06-08 Berlin Germany S4 Dadaon, Ami Omer ISR 2000 01:19.77 2021-05-17 Funchal Portugal -

Seasonal Characteristics of Organic Aerosol Chemical Composition and Volatility in Stuttgart, Germany
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-364 Manuscript under review for journal Atmos. Chem. Phys. Discussion started: 30 April 2019 c Author(s) 2019. CC BY 4.0 License. Seasonal characteristics of organic aerosol chemical composition and volatility in Stuttgart, Germany Wei Huang1,2, Harald Saathoff1, Xiaoli Shen1,2, Ramakrishna Ramisetty1,3, Thomas Leisner1,4, Claudia Mohr5,* 5 1Institute of Meteorology and Climate Research, Karlsruhe Institute of Technology, Eggenstein-Leopoldshafen, 76344, Germany 2Institute of Geography and Geoecology, Working Group for Environmental Mineralogy and Environmental System Analysis, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, 76131, Germany 3Now at: TSI Instruments India Private Limited, Bangalore, 560102, India 10 4Institute of Environmental Physics, Heidelberg University, Heidelberg, 69120, Germany 5Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University, Stockholm, 11418, Sweden *Correspondence to: [email protected] Abstract. Chemical composition and volatility of organic aerosol (OA) particles were investigated during July– 15 August 2017 and February–March 2018 in the city of Stuttgart, one of the most polluted cities in Germany. Total non-refractory particle mass was measured with a high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometer (HR- ToF-AMS; hereafter AMS). Aerosol particles were collected on filters and analyzed in the laboratory with a filter inlet for gases and aerosols coupled to a high-resolution time-of-flight chemical ionization mass spectrometer (FIGAERO-HR-ToF-CIMS; hereafter CIMS), yielding the molecular composition of oxygenated OA (OOA) 20 compounds. While the average organic mass loadings are lower in the summer period (5.1 ± 3.2 µg m-3) than in the winter period (8.4 ± 5.6 µg m-3), we find relatively larger mass contributions of organics measured by AMS in summer (68.8 ± 13.4 %) compared to winter (34.8 ± 9.5 %). -
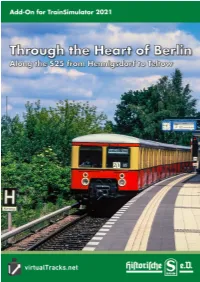
Train Simulator - Right Through Berlin
Train Simulator - Right through Berlin © Historical S-Bahn Berlin e.V. 2020 Page 1 Train Simulator - Right through Berlin Manual "Mitten durch Berlin" - Operation Series 476 Table of contents Table of contents ....................................................................................................... 2 0. authors ................................................................................................................ 3 1. introduction .......................................................................................................... 3 2. system requirements .............................................................................................. 4 3. the driver's cab ..................................................................................................... 5 4. upgrading .......................................................................................................... 10 4.1 Train is cold (full upgrade) .............................................................................. 10 4.2 Transfer of trains from other Tf ......................................................................... 10 4.3 Train is fully upgraded .................................................................................... 10 4.4 Change of driver's cab ................................................................................... 11 5. door control ....................................................................................................... 11 6. driving and braking ........................................................................................... -

New Subway Breaks Cover at Innotrans
THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE www.lrta.org www.tautonline.com NOVEMBER 2018 NO. 971 NEW SUBWAY BREAKS COVER AT INNOTRANS Highlights from the world’s biggest mobility fair Success at the Global Light Rail Awards FTA demands Honolulu ‘rescue plan’ Five shortlisted for Tyne & Wear Metro Zürich Stuttgart at 150 11> £4.60 Further improving Celebrating one of an LRT world-leader the tramway greats 9 771460 832067 Congratulations to all those honoured at this year’s Global Light Rail Awards and a big thank you to the evening’s supporters: HEADLINE SUPPORTER ColTram Next year’s event will be held in London on 2 October 2019 2019 Register your interest by emailing [email protected] or by calling +44 (0)1733 367600 CONTENTS The official journal of the Light Rail Transit Association 410 NOVEMBER 2018 Vol. 81 No. 971 www.tautonline.com EDITORIAL EDITOR – Simon Johnston [email protected] 404 ASSOCIATE EDITOr – Tony Streeter [email protected] WORLDWIDE EDITOR – Michael Taplin [email protected] 422 NewS EDITOr – John Symons [email protected] SenIOR CONTRIBUTOR – Neil Pulling WORLDWIDE CONTRIBUTORS Tony Bailey, Richard Felski, Ed Havens, Andrew Moglestue, Paul Nicholson, Herbert Pence, Mike Russell, Nikolai Semyonov, Alain Senut, Vic Simons, Witold Urbanowicz, Bill Vigrass, Francis Wagner, Thomas Wagner, Philip Webb, Rick Wilson PRODUCTION – Lanna Blyth Tel: +44 (0)1733 367604 [email protected] NEWS 404 SYSTEMS FACTFILE: ZÜRich 422 Achievement and excellence at the Global Neil Pulling explores the recent projects and DESIGN – Debbie Nolan Light Rail Awards; Two openings in a week future prospects for a city that continues to ADVertiSING grow Wuhan’s metro by over 50km; Honolulu invest in high-quality urban transport. -

Science Journals
SCIENCE ADVANCES | RESEARCH ARTICLE CLIMATOLOGY Copyright © 2021 The Authors, some rights reserved; Denitrifying pathways dominate nitrous exclusive licensee American Association oxide emissions from managed grassland for the Advancement of Science. No claim to during drought and rewetting original U.S. Government E. Harris1*, E. Diaz-Pines2, E. Stoll1, M. Schloter3,4, S. Schulz3, C. Duffner3,4, K. Li5, K. L. Moore5, Works. Distributed 1 1 2 6 7 1 under a Creative J. Ingrisch , D. Reinthaler , S. Zechmeister-Boltenstern , S. Glatzel , N. Brüggemann , M. Bahn Commons Attribution NonCommercial Nitrous oxide is a powerful greenhouse gas whose atmospheric growth rate has accelerated over the past License 4.0 (CC BY-NC). decade. Most anthropogenic N2O emissions result from soil N fertilization, which is converted to N2O via oxic nitri- fication and anoxic denitrification pathways. Drought-affected soils are expected to be well oxygenated; however, using high-resolution isotopic measurements, we found that denitrifying pathways dominated N2O emissions during a severe drought applied to managed grassland. This was due to a reversible, drought-induced enrich- ment in nitrogen-bearing organic matter on soil microaggregates and suggested a strong role for chemo- or codenitrification. Throughout rewetting, denitrification dominated emissions, despite high variability in fluxes. Total N2O flux and denitrification contribution were significantly higher during rewetting than for control plots at the same soil moisture range. The observed feedbacks between -

Berlin 2018 World Para Swimming World Series PI Classification Schedule Version 1.2
Berlin 2018 World Para Swimming World Series PI Classification Schedule Version 1.2 Athletes: Must present to the Classification 15 minutes before the allocated time on the classification schedule. Must bring a passport or another official photo form of identification to classification. Will be required to read and sign a classification consent form prior to presenting to the classification panel. Must be accompanied by one support staff from their team. Must bring their own interpreter if they do not speak English. 4-Jun-18 Time SDMS ID NPC Family Name Given Name S SB SM Status 9:00 29994 TUR Inci Omer Onur S4 New 9:00 19482 ISR Gordiychuk Yuliya S9 SB8 SM9 Review 9:00 4201 BLR Shavel Natalia S5 SB4 SM5 Review 9:00 38962 ESP Cortes Melgar Jaume S5 SB4 SM5 New 10:30 33328 TUR Dogan Ismail Can S5 SB4 SM5 Review 10:30 23573 KAZ Yeldekenov Yerlan S9 SB8 New 10:30 22473 ISR Malyar Ariel S5 SB4 SM5 Review 10:30 35895 CZE Fryba Petr S8 New 12:15 15071 ESP Rolo Marichal Judit S7 SB7 SM7 Review 12:15 5338 AUT Onea Andreas S8 SB8 SM8 Review 12:15 26226 BLR Shchalkanau Yahor S10 SB9 SM10 Review Lunch Break 13:15 14:15 35154 KAZ Pronkina Viktoriya S7 New 14:15 19472 ESP Rodriguez Martinez Ines Rocio S4 SB3 SM3 New 14:15 22955 CZE Andrysek Petr S6 SB5 SM6 Review 14:15 26225 BLR Musarau Artsiom S7 SB6 SM7 Review 16:00 11498 EST Tilk Brenda S7 N/A N/A Review 16:00 20050 EST Topkin Matz S5 SB4 SM5 Review 16:00 17934 CZE Duskova Vendula S8 SB7 SM8 Review 16:00 22511 BLR Svadkouskaya Aliaksandra S10 SB9 SM10 Review 17:30 5942 ESP Gascon Sarai S9 SB9 SM9 -
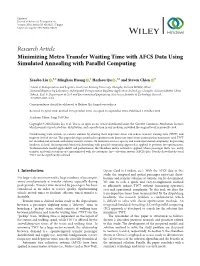
Research Article Minimizing Metro Transfer Waiting Time with AFCS Data Using Simulated Annealing with Parallel Computing
Hindawi Journal of Advanced Transportation Volume 2018, Article ID 4218625, 17 pages https://doi.org/10.1155/2018/4218625 Research Article Minimizing Metro Transfer Waiting Time with AFCS Data Using Simulated Annealing with Parallel Computing Xiaobo Liu ,1,2 Minghua Huang ,1 Hezhou Qu ,1,2 and Steven Chien 3 1 School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 610000, China 2National Engineering Laboratory of Integrated Transportation Big Data Application Technology, Chengdu, Sichuan 610000, China 3John A. Reif, Jr. Department of Civil and Environmental Engineering, New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ 07102-1982, USA Correspondence should be addressed to Hezhou Qu; [email protected] Received 16 April 2018; Revised 10 September 2018; Accepted 18 September 2018; Published 4 October 2018 Academic Editor: Luigi Dell’Olio Copyright © 2018 Xiaobo Liu et al. Tis is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Coordinating train arrivals at transfer stations by altering their departure times can reduce transfer waiting time (TWT) and improve level of service. Tis paper develops a method to optimize train departure times from terminals that minimizes total TWT for an urban rail network with many transfer stations. To maintain service capacity and avoid operational complexity, dispatching headway is fxed. An integrated Simulated Annealing with parallel computing approach is applied to perform the optimization. To demonstrate model applicability and performance, the Shenzhen metro network is applied, where passenger fows (i.e., entry, transfer, and exit) at stations are approximated with the automatic fare collection system (AFCS) data. -

Variantenbewertung Ostkreuz, Stufe 2“
1 Kommentare des IDEENAUFRUF Zukunft Ostkreuz zur „Variantenbewertung Ostkreuz, Stufe 2“ Das Gutachten „Variantenbewertung Ostkreuz, Stufe 2“ hat einen wertvollen Beitrag zur Vergleichbarkeit der Trassenvarianten geleistet. Die Punkteverteilung ist zwar von einer Meinungshaltung abhängig, z.B. ob die Tramtrasse in der Sonntagstraße positiv oder störend empfunden wird. Insbesondere führen aber eine fehlende Berücksichtigung von Vorteilen der Variante 4b (Spitzkehre Marktstr.) und von Nachteilen der Variante 1a (Sonntagstr.) zwangsläufig zu einer Verschiebung der relativen Bewertung beider Varianten. Einbeziehung solcher Aspekte führen zu einem völlig anderen Ergebnis des Vergleichs: Die Tram 21 durch die Sonntagstraße unterliegt in der Betrachtung. Zielgruppe: Fahrgast/Kunden Die schnellere Durchfahrt auf dem Hauptnetz wiegt die Standzeit zum Fahrtrichtungswechsel und die leichte Streckenverlängerung weitgehend auf. Dabei ist die Umsteigesituation des Kopfbahnhofs sogar komfortabler als eine Durchgangsstation. Der Punktevorsprung von 1a wurde dennoch belassen. Kriterium S01 – Reisezeit unverändert Kriterium S02 – Umstiege Unterkriterium (UK) „netzweite Änderung der Direktfahrer/Jahr“ unverändert Auffällig: Summe aus den vier Kategorien ergibt bei Variante 1a eine Steigerung der Fahrgastzahlen um insgesamt 158 Tsd. pro Jahr, bei Variante 4b um insgesamt 28 Tsd. pro Jahr. Diese Zahlen decken sich nicht mit den bei S03-UK „Erschließungspotential“ verwendeten Zahlen: 1a: 147 Tsd. pro Jahr; 4b: 30 Tsd. pro Jahr. UK „Qualität der Umsteigemöglichkeiten“ -
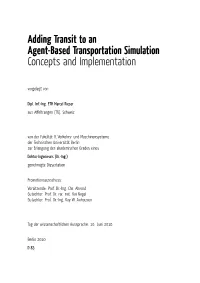
Adding Transit to an Agent-Based Transportation Simulation: Concepts and Implementation
Adding Transit to an Agent-Based Transportation Simulation Concepts and Implementation vorgelegt von Dipl. Inf.-Ing. ETH Marcel Rieser aus Affeltrangen (TG), Schweiz von der Fakultät V, Verkehrs- und Maschinensysteme der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) genehmigte Dissertation Promotionsausschuss: Vorsitzende: Prof. Dr.-Ing. Chr. Ahrend Gutachter: Prof. Dr. rer. nat. Kai Nagel Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Kay W. Axhausen Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 10. Juni 2010 Berlin 2010 D 83 Contents Abstract ix Kurzfassung xi 1 Introduction 1 2 Public Transportation Systems 5 2.1 Definitions ............................... 5 2.2 Public Transportation in Developed Countries ................. 6 2.2.1 Overview ............................. 6 2.2.2 Data Requirements ........................ 7 2.3 Public Transportation in Developing Countries ................ 9 2.3.1 Overview ............................. 9 2.3.2 Data Requirements ........................ 9 3 Related Work 11 3.1 Transportation Simulation in General .................... 11 3.2 Multi-Modal and Transit Simulation ..................... 13 3.2.1 Transit Assignment ........................ 13 3.2.2 Multimodal Route Choice ...................... 14 3.2.3 Operational Simulation ....................... 15 3.2.4 Multi-Modal Simulation ....................... 16 4 Agent-Based Transportation Simulation 19 4.1 Overview ................................ 19 4.2 Controler ................................ 22 4.3 Initial Demand