Wissenschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A 7000 Yr Runoff Chronology from Varved Sediments of Lake Mondsee (Upper Austria)
Universität Potsdam Mathemathisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Erd- und Umweltwissenschaften und Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ Sektion 5.2 – Klimadynamik und Landschaftsentwicklung A 7000 yr runoff chronology from varved sediments of Lake Mondsee (Upper Austria) Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades „doctor rerum naturalium“ (Dr. rer. nat.) in der Wissenschaftsdisziplin Geologie/Paläoklimadynamik eingereicht an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam von Tina Swierczynski Potsdam, den 31.10.2012 Supervisor: apl. Prof. Dr. Achim Brauer Published online at the Institutional Repository of the University of Potsdam: URL http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2013/6670/ URN urn:nbn:de:kobv:517-opus-66702 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-66702 Abstract The potential increase in frequency and magnitude of extreme floods is currently dis- cussed in terms of global warming and the intensification of the hydrological cycle. The profound knowledge of past natural variability of floods is of utmost importance in order to assess flood risk for the future. Since instrumental flood series cover only the last ~150 years, other approaches to reconstruct historical and pre-historical flood events are needed. Annually laminated (varved) lake sediments are meaningful natural geoarchives because they provide continuous records of environmental changes >10000 years down to a seaso- nal resolution. Since lake basins additionally act as natural sediment traps, the riverine sediment supply, which is preserved as detrital event layers in the lake sediments, can be used as a proxy for extreme discharge events. Within my thesis I examined a ~8.50 m long sedimentary record from the pre-alpine Lake Mondsee (Northeast European Alps), which covered the last 7000 years. -
General Information Mondseeland, Mondsee-Irrsee
Discover the lakes, enjoy the nature. culture & tradition awesome nature hiking paradise GENERAL INFORMATION MONDSEELAND, MONDSEE-IRRSEE www.mondsee.at Familiy holiday DEAR VISITOR CONTENTS Welcome to MondSeeLand, the region around Lakes Mondsee History 04 and Irrsee. MondSeeLand is just a 20-minute drive from the city of Salzburg and is one of the gateways to the Salzkammergut. Pile dwellings: Unesco World Heritage Site 05 Lakes Mondsee and Irrsee are the warmest lakes for bathing in the Salzkammergut region, with water temperatures of up to Unmissable sights 06 27°C/80°F All about MondSeeLand 07 The wide range of leisure activities is one of the region’s great as- sets: we have something for everyone – for families and individual Boat trips on Lake Mondsee 08 guests; for sporting enthusiasts and those in search of peace and relaxation. MondSeeLand has so much to experience, discover and enjoy, not to mention our famous Austrian hospitality. Boat hire 08 We hope you enjoy your stay in MondSeeLand. Swimming / bathing spots 09 Tourismusverband MondSeeLand tourist information team, Sport in MondSeeLand 09 - 11 Mondsee-Irrsee Hiking and hillwalking 11 - 14 Great events 16 IMPRINT: Publisher: Tourismusverband MondSeeLand, Mondsee-Irrsee Pictures: TV MondSeeLand, Oberösterreich Tourismus, Fotografie Schwamberger, Culinary treats 17 Fotostudio Meindl, Foto Weinhäupl, Kuratorium Pfahlbauten Print: Fuchs Druck GmbH All information without guarantee, changes and misprints! Usefull information 18-19 2 3 History Pile dwellings: Unesco World Heritage Site The history of MondSeeLand stretches back 6000 years. Ruins of settlements In the Mondsee, Attersee and Seewalchen communities, you can now visit were found underwater near the banks of Lake Mondsee near Scharfling, and the new information pavilions on the UNESCO WORLD HERITAGE SITE Prehi- a rich array of Neolithic pottery and stone and bone tools were excavated. -
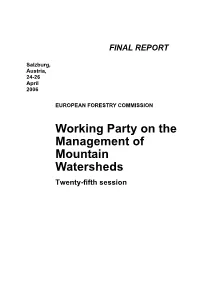
Working Party on the Management of Mountain Watersheds
FINAL REPORT Salzburg, Austria, 24-26 April 2006 EUROPEAN FORESTRY COMMISSION Working Party on the Management of Mountain Watersheds Twenty-fifth session EUROPEAN FORESTRY COMMISSION WORKING PARTY ON THE MANAGEMENT OF MOUNTAIN WATERSHEDS TWENTY-FIFTH SESSION Salzburg, Austria 24 - 26 April 2006 FINAL REPORT FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2006 1 INTRODUCTION 1. The Twenty-fifth Session of the European Forestry Commission’s Working Party on the Management of Mountain Watersheds was held in Salzburg, Austria from 24 to 26 April 2006. On 26 April the Service for Avalanche and Torrent Control of the Austrian Ministry of Agriculture and Forestry, Environment and Water Management organized a study tour to the Lake Chamber district (Salzkammergut) where examples of watershed management, forest management and environmental protection were demonstrated and discussed. 2. The session was attended by 29 delegates and observers from the following countries: Austria, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Japan, Poland, Romania, Slovakia, Spain and the United States of America. 3. The twenty-fifth session was opened by Mr Gernot Fiebiger, who welcomed all participants and introduced the session Chairperson, Mr Antoine Hurand (France), the Vice-Chairperson, Ms Maria Patek (Austria) and the Secretary of the Working Party, Mr Thomas Hofer (FAO). 4. In his welcoming address, Mr Hurand explained that this year’s session would be held in English only. He thanked Ms Patek and the Austrian government for hosting the session, and FAO for its continuous support. Mr Hurand introduced the new Secretary of the Working Party, Mr Hofer, and thanked the former Secretary, Mr Douglas McGuire, for his efforts and support over the past years. -

An Outline of the Quaternary Stratigraphy of Austria
Quaternary Science Journal GEOzOn SCiEnCE MEDiA Volume 60 / number 2–3 / 2011 / 366–387 / DOi 10.3285/eg.60.2-3.09 iSSn 0424-7116 E&G www.quaternary-science.net An outline of the Quaternary stratigraphy of Austria Dirk van Husen, Jürgen M. Reitner Abstract: An overview of the Quaternary Stratigraphy in Austria is given. The subdivision of the mappable depositional units is based partly on criteria of lithostratigraphy (lithic properties) and allostratigraphy (e.g. unconformities). Traces of glaciations are missing for the Early Pleistocene period (2.58–0.78 Ma). The few and isolated sediment bodies are documenting fluvial accumulation and loess deposition along the rivers. Paleomagnetically correlated loess-paleosol-sequences like the profil at Stranzendorf including the Gauss/Matuyama boundary respectively Neogen/Quaternary are documenting slightly warmer condition than during during the Middle Pleistocene (0.78–0.13 Ma) which is in accordance with the global 18δ O record. Four major glaciations (Günz, Mindel, Riß, Würm) are proved during Middle and Late Pleistocene. All of these are documented by proglacial sediments topped by basal till, terminal moraines linked with terrace bodies and loess accumulation as well. This allows to recognize the climatic steering of sedimentation in context with advancing glaciers and the dispersion of permafrost and congelifraction as far as into the Alpine foreland. Both youngest major glaciations (Riß and Würm) are correlated according to geochronological data with the Marine Isotope Stages (MIS) 6 and 2. The simultaneousness of Günz and Mindel with the phases of massive global climatic deterioration during MIS 16 and 12 seems plausible. -

799 € 10 Days 12 From/To Fuschl Am See 3 Walking Tours Europe #B1
Full Itinerary and Tour details for Austria's Ten Lakes 10-day Self-guided Walking Tour Level 3 Prices starting from. Trip Duration. Max Passengers. 799 € 10 days 12 Start and Finish. Activity Level. from/to Fuschl am See 3 Experience. Tour Code. Walking Tours Europe #B1/2507 Austria's Ten Lakes 10-day Self-guided Walking Tour Level 3 Tour Details and Description Ragged peaks tower next to lovely, forest covered hills, both hiding away idyllic mountain lakes. Stop and look around–take in breathtaking scenery and unspoiled nature. Our trekking route crosses the Austrian Salzkammergut from West to East. Ten more or less famous lakes such as lake Wolfgangsee, Mondsee,Irrsee and Fuschlsee are part of this amazing tour. Stop at some of the best known highlights of the region: the White Horse Inn in St. Wolfgang, the Imperial summer residence in Bad Ischl and the most beautiful place on a lake Hallstatt are unforgettable highlights during your hike. A special excursion dips into the lovely Ausseerland, a gem of the Salzkammergut where time seems to pass slower than everywhere else. Tour character: Mountain Hiking Level 3 You mainly walk along lakes and across alpine pastures. Several low summits offer scenic views and therefore you should be surefooted. A good fitness level for ascents and longer walking stages up to 6 hours are required. Included in the Walking Tour: • 9 overnight stays in beautiful 3* hotels, breakfasts included Luggage transfer Welcome meeting Boat fare on lake Wolfgangsee and lake Hallstätter See Mountain cable car fare -

Welcome to Mondsee! We Wish You a Pleasant Stay
WELCOME TO MONDSEE! WE WISH YOU A PLEASANT STAY Irrsee Salzburg 30km Munich 167km Linz 107km Vienna 270km 1 2 3 4 5 8 6 7 Mondsee WC WC PARKING ATM SHIP PARKING SUPERMARKET INFORMATION KULTURLEITWEG ST. MICHAEL’S BASILICA - CARS PIER COACHES (CULTURE ROUTE) PARKING COACHES TOURISMUSVERBAND MONDSEELAND, MONDSEE-IRRSEE Dr.-Franz-Müller-Strasse 3 · 5310 Mondsee, Austria Phone +43 6232 2270 · Fax +43 6232 2270 22 Email: [email protected] · www.mondsee.at 1 St. Michael’s Basilica: 4 Pilgrimage Church Maria Hilf – Hilfberg Church: In 748, the Bavarian Duke Odilo II founded the monastery Mond- Originally, this church was dedicated to St. Ulrich. Abbot Amand see on the remains of a Roman settlement. After the overthrow Göbl had the old Ulrichskirche converted into a “Mariahilfkirche” of Duke Tassilo III by Emperor Karl, Mondsee became an imperial to show his gratitude that the MondSeeLand was spared the ef- monastery. In the 15th century, all the churches of MondSeeLand fects of the Spanish War of Succession (Maria Hilf = Our Lady, were rebuilt; in 1444, the chapter house was built, the cloister Help of Christians). Meinrad Guggenbichler, a sculptor from in 1448. In 1514, the first monastery secondary school in Upper Mondsee, created the altars and the pulpit, and on 2 July 1706, Austria was founded in Mondsee, and it existed until the dissolu- a picture of the Virgin Mary was solemnly transferred from the tion of the monastery. abbey chapel to the church and placed in the middle of the altar. One of the greatest Baroque sculptors, Meinrad Guggenbichler, The pilgrimage to the Mariahilfberg in Mondsee rapidly grew in worked for 44 years, until his death, in Mondsee. -

Berechnung Potential Seeache
Berechnung Potential Seeache Von der Klima und Energiemodellregion Mondseeland wurden folgender Verbrauch der 6 Gemeinden Innerschwand, Mondsee, Oberhofen, St.Lorenz, Tiefgraben und Zell am Moos erhoben: Der Gesamtstromverbrauch liegt bei 78 GWh pro Jahr. Es wird nur je eine GWh Photovoltaik und Kleinwasserkraft ins Netz gespeist! Viele setzen auf Wasserkraft, wenn es darum geht, noch zusätzliche erneuerbare Energie herzustellen. Manche in der Region glauben auch, dass genug Potential vorhanden ist. Um zu illustrieren, wie weit Nachfrage und Angebot auseinander liegen, haben wir uns die Seeache zwischen Mondsee und Attersee angesehen. Daten zum Fluss aus Wikipedia: Lage Oberösterreich , Salzburg Flusssystem Donau Abfluss über Attersee → Ager → Traun → Donau → Schwarzes Meer Ursprung Mondsee bei See am Mondsee ♁47° 48 ′ 14 ″ N, 13° 27 ′ 1″ O Quellhöhe 481 m ü. A. (Normalwasserstand) Mündung Bei Unterach am Attersee in den Attersee Mündungshö he 469 m ü. A. (Normalwasserstand) Höhenunterschied 12 m Länge 3 km Einzugsgebiet 253,4 km² [1] Abfluss am Pegel MQ 1981– 9,14 m³/s See am Mondsee 2009 (Au) Der mittlere Abfluss MQ eines Entwässerungssystems errechnet sich als zeitliches Mittel der Regelwassermenge über das Jahr . Würde man jeden Tropfen Wasser und die gesamte Fallhöhe nützen, ergebe sich in etwa eine Leistung von 1 MW. Nehmen wir an, das Kraftwerk läuft jede Stunde im Jahr (reine fiktive Annahme) dann wären damit rund 8,5 GWh (also 8.500 MWh) theoretisch erzeugbar. Aber das sind rein theoretische Zahlen. In der Praxis ist nur ein geringer ein Bruchteil nutzbar! Aber man erkennt, selbst unter diesen fiktiven Annahmen könnte man nur etwas mehr als 10% der Nachfrage erzeugen. -

Fun in the Water for All the Family
The MondSeeLand, home to both the Mondsee and Irrsee lake, has been a popular holiday destination for decades. At just 27 km away from the festival city of Salzburg, international guests to the region can enjoy the many activities it has to offer. Fun in the water for all the family The Mondsee and Irrsee lakes are the warmest lakes in the Salzkammergut region and can reach temperatures of 27 °C in July and August. The Irrsee lake is very natural and ideal for all gentle water sports. The Mondsee lake plays host to numerous water sports activities such as surfing and sailing schools, wakeboarding, kite surfing, water skiing schools, diving schools, boat trips, diving, etc. The Mondsee is 11.8 km long and 2.5 km at its widest point. The Irrsee is 5 km long and 1 km at its widest point. Both lakes have excellent water quality. - 1 - Walking, cycling, running A high quality network of footpaths has been created around the Mondsee and Irrsee over the last few years, covering more than 100 km and leading to the neighbouring lakes – the Attersee, Fuschlsee and Wolfgangsee. A nature map of the MondSeeLand can be purchased from the tourist office (for 1 euro). This shows all the footpaths, cycle paths, jogging paths and specially designated relaxation areas. The cycle paths and footpaths are all well signposted and suitable for family days out. Meetings, congresses and company events The ‘Schloss Mondsee’ castle is home to a modern conference and events centre for hosting a variety of activities. International congresses and conferences of up to 500 participants are increasingly being held here, attracted by the fascination of the MondSeeLand, the good connection with the A1 motorway and the high quality historical atmosphere. -

Sediments and Sedimentary History of Lake Attersee (Salzkammergut, Austria)
1215 Hydrobiologia 143: 233-246, (1986) 233 © Dr W. Junk Publishers, Dordrecht Printed in the Netherlands Sediments and sedimentary history of Lake Attersee (Salzkammergut, Austria) 1 2 Ahmad-Reza Behbehani , Jens Miiller , Roland Schmidt3, Jurgen Schneider1, Heinz-Gerd Schroder4, Ines Strackenbrock1 & Michael Sturm5 1lnstitut fur Oeologie und Dynamik der Lithosphiire, Ooldschmidtstra}Je 3, D-3400 Odttingen, FRO 2Lehrstuhl fur Oeologie, Technische Universitdt Munchen, Lichtenbergstra}Je 4, D-8046 Oarching, FRO 3Institut fur Limnologie der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Oafs berg 116, A-5310 Mondsee, Austria 4/nstitut fur Seenforschung und Fischereiwesen, Untere Seestra}Je 81, D-7994 Langenargen, FRO 5EAWAO-ETH Zurich, Uberlandstra}Je 133, CH-8600 Dubendoif, Switzerland Keywords: lake sediments, late- and postglacial history, palynology, biogenic carbonate production, eutrophication, heavy metals Abstract Attersee represents a good example of a Jake situated in the Northern forelands of the Northern Calcareous Alps and influenced by different sediment-supplying processes during the postglacial. Several compounds, of different origin, form the sediments of the basin. Clastics which are mainly composed of dolomites derive from the Northern Calcareous Alps. Clastic input of organic and inorganic particles is accomplished by rivers and landslides. They are responsible for the main input of siliciclasts like quartz, feldspar and mica. A high proportion of the sediment results from autochthonous biogenic carbonate precipitation. In the shal- low sublittoral areas of the northern part of the lake benthic decalcification caused by encrusting macro- and micro-phytes is dominant, while in the southern and central parts of the lake epilimnetic decalcification caused by the blooming of phytoplancton is more important during summer. -

Infestation of Zooplankton with Triaenophorus and Proteocephalus Procercoids (Cestoda) in a Deep Oligotrophic Lake
J. Limnol., 2015; 74(1): 40-49 ORIGINAL ARTICLE DOI: 10.4081/jlimnol.2014.1021 Infestation of zooplankton with Triaenophorus and Proteocephalus procercoids (Cestoda) in a deep oligotrophic lake Peter ANEGG, Roland PSENNER, Barbara TARTAROTTI* University of Innsbruck, Institute of Ecology, Alpine Freshwater Ecology Division, Lake and Glacier Research Group, Technikerstraße 25, 6020 Innsbruck, Austria *Corresponding author: [email protected] ABSTRACT In spring 2004, a massive infestation of the whitefish population in the Austrian Lake Achensee with Triaenophorus crassus was ob- served. Procercoids, the larval stage of parasitic cestodes, infest copepods as their first intermediate host. Therefore, in spring 2011, zooplankton samples were taken weekly at two sampling sites and depth ranges to determine the abundances of crustaceans as well as percentages of infected copepods and temporal occurrence of parasites. In addition, whitefish (Coregonus lavaretus) stomach contents were analysed for food spectrum and parasite infestation. From the end of June to mid-August, procercoids of Triaenophorus spp. were detected in Cyclops abyssorum, the only first intermediate host for this parasite in Lake Achensee. Highest percentages of infected copepods were reached in mid-July (prevalence: 0.38%). Furthermore, an infestation of Proteocephalusonlysp. was observed in this copepod species, which occurred earlier until the end of the sampling period (prevalence: 1.34%). Besides C. abyssorum, also Eudiaptomus gracilis was occasionally infected with Proteocephalus (prevalence: 0.05%). The procercoids were found in both depth ranges, with no clear vertical infestation preference. More C. abyssorum female were Triaenophorus-infected than males, while the opposite was ob- served for Proteocephalus infection. The whitefish stomachs contained large numbers ofuse Proteocephalus and Triaenophorus procercoids, coinciding with the occurrence of these parasites in the copepods. -

Environmental Responses to Lateglacial Climatic Fluctuations Recorded in the Sediments of Pre-Alpine Lake Mondsee
Environmental responses to Lateglacial climatic fluctuations recorded in the sediments of pre-Alpine Lake Mondsee (northeastern Alps) Stefan Lauterbach, Achim Brauer, Nils Andersen, Dan L. Danielopol, Peter Dulski, Matthias Hüls, Krystyna Milecka, Tadeusz Namiotko, Ulrich von Grafenstein, Soumaya Belmecheri, et al. To cite this version: Stefan Lauterbach, Achim Brauer, Nils Andersen, Dan L. Danielopol, Peter Dulski, et al.. En- vironmental responses to Lateglacial climatic fluctuations recorded in the sediments of pre-Alpine Lake Mondsee (northeastern Alps). Journal of Quaternary Science, Wiley, 2011, 26 (3), pp.253-267. 10.1002/jqs.1448. insu-00680868 HAL Id: insu-00680868 https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00680868 Submitted on 29 Mar 2012 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Environmental responses to Lateglacial climatic fluctuations recorded in the sediments of pre-Alpine Lake Mondsee (northeastern Alps) 1. Stefan Lauterbach1,*, 2. Achim Brauer1, 3. Nils Andersen2, 4. Dan L. Danielopol3,†, 5. Peter Dulski1, 6. Matthias Hüls2, 7. Krystyna Milecka4, 8. Tadeusz Namiotko5, 9. Milena Obremska4, 10. Ulrich Von Grafenstein6, 11. Declakes Participants ‡ Keywords: Lateglacial; climate; lake sediments; Austria; sediment microfacies; µ-XRF scanning; pollen; stable isotopes Abstract Investigation of the sedimentary record of pre-Alpine Lake Mondsee (Upper Austria) focused on the environmental reaction to rapid Lateglacial climatic changes. -

Wehrordnung Mondsee
Regionale Innovationsstrategien „LEADER-Mehrwert im Tourismus“ Julia Soriat-Castrillón, LEADER-Managerin Thomas Ebner, GF TVB Mondsee-Irrsee Mondsee, am 19.01.2021 Agenda Begrüßung und Vorstellung Input LEADER-Tourismus-Region Fuschlsee Mondseeland (FUMO) Erfahrungsaustausch LEADER-Mehrwert im Tourismus Zusammenfassung LEADER- Region 10 Gemeinden in 7 Gemeinden im der Fuschlseeregion Mondseeland (Salzburg) (Oberösterreich) Projektfördermittel LE 14-20: € 2,3 Mio. davon für Sbg € 1,5 Mio. (65 %) für OÖ € 0,8 Mio. (35 %) Projekte AF 1: regionale 63 * Wertschöpfung 23 16 AF 2: Natürliche 24 Ressourcen/Kultur Davon 3 zurückgezogene Projekte AF 3: * Gemeinwohl → Tourismusverbände (TVBs) als wichtige Projektträger ORTE DES GLAUBENS Projekte ERWANDERN AUSSICHTSTURM KULMSPITZE MACHBARKEITSSTUDIE GANZJAHRES- NUTZUNG SKIGEBIET GAISSAU-HINTERSEE GOLF-DESTINATION GOLF UND SEEN SALZKAMMERGUT → nicht nur TVBs setzen touristisch relevante Projekte um → Tourismus-relevante Projekte gibt es in allen Aktionsfeldern Projekte IRRSEEMOOR ENTDECKEN UND VERSTEHEN PUMPTRACK KOPPL DAS PLÖTZHAUS AM BADERBACH Tourismus- Region FUMO Eckdaten: • Tourismusregion mit > 7000 Betten und ca. 700.000 Nächtigungen (Ø 3 Tage) • Nächtigungen je EW je Gemeinde sehr unterschiedlich (2,4 bis 123,2) • Top-Veranstaltungen: Seefest, Internat. Mondseer 5-Seen-Radmarathon, Wanderfestival Fuschlseeregion 24h- Trophy, Fuschlseelauf Race the Lake, Mondseer Jedermann, Musiktage, Electric Love am Salzburgring, Advent • Sonstiges: Irrseemoor Naturschutz- gebiet, Skigebiet Gaißau-Hintersee,