Hanna Berger-Bio-Köln2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
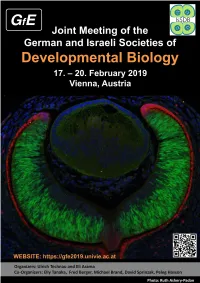
Gfe Full Program 13.02.2019
Joint Meeting of the German and Israeli Societies of Developmental Biology Vienna, February 17-20, 2019 https://gfe2019.univie.ac.at/home/ Organizers Ulrich Technau, Eli Arama Co-Organizers Michael Brand, Fred Berger, Elly Tanaka, David Sprinzak, Peleg Hasson GfE https://www.vbio.de/gfe-entwicklungsbiologie IsSDB http://issdb.org Gesellschaft für Entwicklungsbiologie e.V. Geschäftsstelle: Dr. Thomas Thumberger Centre for Organismal Studies Universität Heidelberg Im Neuenheimer Feld 230 69120 Heidelberg E-mail: [email protected] Contents Sponsors ......................................................................................................................................... 4 General information ..................................................................................................................... 5 Venue .......................................................................................................................................... 5 Getting there................................................................................................................................ 5 From the airport ...................................................................................................................... 6 If you come by long distance train .......................................................................................... 6 Taxi ......................................................................................................................................... 6 If you -

THU APRIL 21 – SUN APRIL 24 in TQW / Studios and TQW / Halle G
THU APRIL 21 – SUN APRIL 24 in TQW / Studios and TQW / Halle G ARCHIVES TO COME SCORES N°11 / / ATELIER EDN — EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK Perjovschi (c) Dan CALENDAR ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- MON 18 – SAT 23 APRIL FRI 22 APRIL SAT 23 APRIL SUN 24 APRIL 10.45 h – 12.30 h in TQW / Studios 14.00 h – 17.30 h in Leopold Museum / ongoning at TQW / Studios Passage ongoning at TQW / Studios Passage SHANNON COONEY unteres Atrium DAN PERJOVSCHI DAN PERJOVSCHI TRAINING Legible Archive SIOBHAN DAVIES DANCE Black Belt Drawing Black Belt Drawing Table of Contents ----------------------------------- 12.00 h – 17.30 h in Leopold Museum / 10.30 h – 15.00 h in Leopold Museum / 15.00 h in TQW / Studios Passage unteres Atrium unteres Atrium THU 21 – SAT 23 APRIL DAN PERJOVSCHI SIOBHAN DAVIES DANCE SIOBHAN DAVIES DANCE 13.00 h – 15.30 h in TQW / Studios Black Belt Drawing Table of Contents Table of Contents CLAUDIA BOSSE + GUESTS WORKSHOP The archive as a body, 16.00 h – 21.00 h in TQW / Studios 16.00 h – 21.00 h in TQW / Studios 12.00 h in TQW / Studios the body as an archive DANIEL ASCHWANDEN + DANIEL ASCHWANDEN + FUTURE ARCHIVES CONNY ZENK CONNY ZENK with ARKADI ZAIDES, ----------------------------------- INSTALLATION OPENING INSTALLATION Mobil[e]_migration DAN PERJOVSCHI, Mobil[e]_migration SIOBHAN DAVIES + THU 21 APRIL 16.00 h – 21.00 h in TQW / Studios SCOTT DELAHUNTA, PENELOPE 16.00 h – 21.00 h in TQW / Studios 16.00 h – 21.00 h in -

Dance and Exile Research and Showcasing in Austria – an Attempt at a Chronology
גרט ויזנטל רוקדת את יצירתה אנדנטה, וינה, 08/1906, גרטרוד קראוס רוקדת את יצירתה וודקה, וינה 1924, באדיבות מורה ציפרוביץ, וינה 1920, צילום: לא ידוע, באדיבות מוזיאון התיאטרון צילום: מוריץ נהר, באדיבות מוזיאון התיאטרון מוזיאון התיאטרון בוינה Mura Ziperowitsch, Wien, 1920, Photo: Unknown, Courtesy of Theatermuseum -KHM – Museumsverband Gertrud Kraus in Wodka, Wien 1924, Photo: Martind Grete Wiesenthal in Ändante con moto, Wien, Imboden, Courtesy of Theatermusem – KHM 08/1906, Photo: Moritz Naher, Courtesy of Theatermusuem, KHM-Museumsverband Dance and Exile Research and Showcasing in Austria – An Attempt at a Chronology Andrea Amort The broadly defined topic of exile, to a varying extent still relevant Nazi dictatorship. Presciently, Gertrud Kraus left Austria in 1935 to dance )modern dance and ballet( today, mainly covers those and emigrated to Palestine/Israel. Rudolf von Laban )Bratislava dance practitioners in Austria who, in the wake of Austro-Fascism 1879 – Weybridge, Surrey 1958(, the influential founder of Aus- and the racist and political measures of Nazi dictatorship, were druckstanz )expressionist dance(, is nowadays considered a na- restricted in their activities and went into inner emigration or else tional figure especially in Germany and England and, in recent were active in resistance, persecuted, expelled, or murdered. In years, also in Slovakia despite having been born in the Austro- dance scholarship also artists who had emigrated much earlier Hungarian Monarchy. He left Berlin in 1937 and escaped via Paris on and were committed to Zionism )among others, the Ornstein to England. sisters and Jan Veen, alias Hans Wiener ]sic[( are included in this topic. No precise statistics of the persecuted and murdered are avail- able; we estimate, however, that at least 200 dance practitioners All dance practitioners mentioned in the following – with the ex- were affected. -

WIDERSTAND Gegen Den Nationalsozialismus in Berlin Widerstand Gegen Den Nationalsozialismus War Schwierig, Aber Möglich
WIDERSTAND gegen den Nationalsozialismus in Berlin Widerstand gegen den Nationalsozialismus war schwierig, aber möglich. Er endete für die han- delnden Akteure oftmals mit Verhaftung, Folter, Verurteilung und Tod. Dennoch sind manche Menschen mutig diesen Weg gegangen. Herausgeber: Berliner Geschichtswerkstatt e. V. Die Berliner Geschichtswerkstatt ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1981 besteht. Im Zent- rum unserer Arbeit stehen Alltagsgeschichte und die Geschichte „von unten“, wobei wir die Erinnerungsarbeit nicht als Selbstzweck verstehen. Wir wollen anhand des Schicksals der NachbarInnen am Wohnort Zeitgeschichte und die eigene Verstrickung darin nachvollzieh- bar machen. Berliner Geschichtswerkstatt e. V. Tel: 030/215 44 50 [email protected] www.berliner-geschichtswerkstatt.de Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Berlin Herausgeber: Berliner Geschichtswerkstatt e. V. Mit Beiträgen von: Geertje Andresen Madeleine Bernstorff Dörte Döhl Eckard Holler Thomas Irmer Jürgen Karwelat Ulrike Kersting Annette Maurer-Kartal Annette Neumann Cord Pagenstecher Kurt Schilde Bärbel Schindler-Saefkow Dokumentation zur Veranstaltungsreihe der Berliner Geschichtswerkstatt e. V. „Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Berlin“ Januar bis Juni 2014 Eigenverlag der Berliner Geschichtswerkstatt e. V. Goltzstraße 49, 10781 Berlin, 2014 Druck: Rotabene Medienhaus, Schneider Druck GmbH, Rothenburg ob der Tauber Satz, Layout und Umschlaggestaltung: Irmgard Ariallah, Atelier Juch © für die Texte bei den Autorinnen und Autoren -
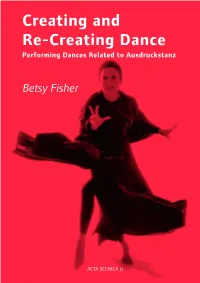
Creating and Re-Creating Dance Performing Dances Related to Ausdruckstanz
Creating and Re-Creating Dance Performing Dances Related to Ausdruckstanz Betsy Fisher ACTA SCENICA 12 Creating and Re-Creating Dance Performing dances related to Ausdruckstanz Betsy Fisher ACTA SCENICA 12 Näyttämötaide ja tutkimus Teatterikorkeakoulu - Scenkonst och forskning - Teaterhögskolan - Scenic art and research - Theatre Academy Betsy Fisher Creating and Re-Creating Dance Performing dances related to Ausdruckstanz written thesis for the artistic doctorate in dance Theatre Academy, Department of Dance and Theatre Pedagogy Publisher: Theatre Academy © Theatre Academy and Betsy Fisher Front and back cover photos: Carl Hefner Cover and lay-out: Tanja Nisula ISBN: 952-9765-31-2 ISSN: 1238-5913 Printed in Yliopistopaino, Helsinki 2002 To Hanya Holm who said, “Can do.” And to Ernest Provencher who said, “I do.” Contents Abstract 7 Acknowledgements 9 Preface 11 Introduction 13 Preparation: Methodology 19 Rehearsal: Directors 26 Discoveries: Topics in Reconstruction 43 Performance: The Call is “Places”– an analysis from inside 75 Creating from Re-Creating: Thicket of Absent Others 116 Connections and Reflections 138 Notes 143 References 150 Index 157 Abstract Performance Thesis All aspects of my research relate to my work in dance reconstruction, performance, and documentation. Concerts entitled eMotion.s: German Lineage in Contemporary Dance and Thicket of Absent Others constitute the degree performance requirements for an artistic doctorate in dance and were presented in Studio-Theater Four at The Theater Academy of Finland. eMotion.s includes my performance of solos choreographed by Mary Wigman, Dore Hoyer, Marianne Vogelsang, Hanna Berger, Rosalia Chladek, Lotte Goslar, Hanya Holm, Alwin Nikolais, Murray Louis, and Beverly Blossom. These choreographers share a common artistic link to Ausdruckstanz (literally Expression Dance). -

Pressemappe Impulstanz2019.Pdf
Presseinformation Pressekontakt Theresa Pointner, Almud Krejza & Zorah Zellinger ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival Museumstraße 5/21 1070 Wien, Austria T +43.1.523 55 58-34 T +43.1.523 55 58-35 F +43.1.523 55 58-9 [email protected] impulstanz.com Laufend aktualisierte Presseinformationen, -texte und -fotos zu unserem Festivalprogramm finden Sie in unserem Pressebereich auf der ImPulsTanz-Website. impulstanz.com/presscontact Pressetexte Hier finden Sie eine Auswahl der aktuellen Pressetexte, die Sie als PDF herunterladen können. impulstanz.com/pressfiles Pressefotos In diesem Bereich steht Ihnen eine Auswahl an Fotos des diesjährigen Performance- und Workshop- Programms zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Fotos nur im Zusammenhang mit ImPulsTanz und unter Angabe des Copyrights verwendet werden dürfen. Sollten Sie an weiterem Fotomaterial interessiert sein, wenden Sie sich bitte an uns. impulstanz.com/presspictures Presseakkreditierungen Es gibt die Möglichkeit, per Online-Formular einen Antrag auf Akkreditierung für das ImPulsTanz Festival 2019 zu stellen. Bitte füllen Sie dieses aus und senden Sie es gemeinsam mit den genannten Unterlagen ab. Wir werden uns nach Ansicht und Bearbeitung Ihrer Unterlagen mit Ihnen in Verbindung setzen. impulstanz.com/mediaaccreditation 11 Juli — 11 August 2019 1 Inhaltsverzeichnis Presseinformation 1 Inhaltsverzeichnis 2 Spielplan 5 Compagnie Übersicht 14 Spielstätten 17 Vorverkauf & Tageskassen 18 ImPulsTanz Performances 19 ImPulsTanz X Museum 21 Grußworte 22 [8:tension] Young Choreographers’ Series 23 Compagnies A-Z 25 Artists 25 Agudo Dance Company 26 Alleyne Dance 31 [8:tension] Eric Arnal-Burtschy 36 Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec & Saša Božić 39 Jérôme Bel 44 Jonathan Burrows 50 Dimitri Chamblas & Boris Charmatz / Terrain 54 [8:tension] Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov 60 Steven Cohen 63 Claire Croizé & Matteo Fargion / ECCE vzw 69 Ivo Dimchev 74 Cie. -

Biografia Lexikon Österreichischer Frauen
Ilse Korotin (Hg.) biografiA. Lexikon österreichischer Frauen Band 4 Register 2016 BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR Veröffentlicht mit der Unterstützung des Austrian Science Fund ( FWF ): PUB 162-V15 sowie durch das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und das Bundesministerium für Bildung und Frauen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar. © 2016 by Böhlau Verlag Ges. m. b. H & Co. KG , Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Layout: Carolin Noack, Ulrike Dietmayer Einbandgestaltung: Michael Haderer und Anne Michalek , Wien Druck und Bindung: baltoprint, Litauen Gedruckt auf chlor- und säurefrei gebleichtem Papier Printed in the EU ISBN 978-3-205-79590 -2 Inhalt Einleitung: Frauen sichtbar machen. Das Projekt biografiA. Biografische Datenbank und Lexikon österreichischer Frauen . 7 Band 1 Biografien A – H ........................................ 19 – 1420 Band 2 Biografien I – O ......................................... 1421 – 2438 Band 3 Biografien P – Z ........................................ 2439 – 3666 Band 4 Register................................................... 3667– 4 24 8 Personen.............................................. -

INCS 2010 Online
THE INTERNATIONAL NEWSLETTER OF COMMUNIST STUDIES ONLINE FEATURING: THE INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF COMMUNIST STUDIES Der Internationale Newsletter der Kommunismusforschung La newsletter internationale des recherches sur le communisme Международный бюллетень исторических исследований коммунизма La Newsletter Internacional de Estudios sobre el Comunismo A Newsletter Internacional de Estudos sobre o Comunismo Edited by Bernhard H. Bayerlein and Gleb J. Albert XIX (2013) NO 26 Published by The European Workshop of Communist Studies With Support of the Centre of Contemporary History Potsdam (ZZF), Germany http://newsletter.icsap.eu ISSN 1862-698X Shortened Print Edition Published in Jahrbuch für historische Kommunismusforschung: ISSN Y503-1060 The International Newsletter of Communist Studies XIX (2013), no. 26 2 Executive Editor Bernhard H. Bayerlein University of Bochum, Germany, Institute of Social Movements (ISB) Associate, Center of Contemporary History Potsdam (ZZF), Germany [email protected] Junior Editor Gleb J. Albert, Bielefeld University, Germany [email protected] Assisted by Véronique Mickisch, Berlin, Germany Board of Correspondents Lars Björlin (Stockholm) Kevin McDermott (Sheffield) Kasper Braskén (Åbo) Brendan McGeever (Glasgow) Cosroe Chaqueri (Paris) Kevin Morgan (Manchester) Sonia Combe (Paris) Timur Mukhamatulin (Moscow) Mathieu Denis (Montréal) Manfred Mugrauer (Wien) Jean-François Fayet (Geneva) José Pacheco Pereira (Lisbon) Jan Foitzik (Berlin) Fredrik Petersson (Åbo/Stockholm) José Gotovitch (Bruxelles) -

About the Exhibition Everybody Dances. the Cosmos of Viennese
Everybody Dances. The Cosmos of Viennese Dance Modernism 21 March 2019 – 10 February 2020 Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien [email protected] T +43 1 525 24 5315 About the Exhibition During the first third of the 20th century Vienna ranked amongst the most important international centres of Modern Dance. The exhibition, organised in cooperation with the Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), attempts to inscribe significant female dancers into Vienna’s great historical narrative. It focuses on dancers, choreographers and teachers such as Isadora Duncan, Grete Wiesenthal, Gertrud Bodenwieser and Rosalia Chladek as well as Valeria Kratina, Gertrud Kraus, Hilde Holger and others who were the pioneers for the European Modernism. The show illustrates the variety and concentration of a female-dominated dance scene which was destroyed by Nazi dictatorship and further developed in exile. Threads are spun between the productive and socio-critical spirit of that time and today through enduring movement techniques of Modernism and related topics. Hence, the exhibition, curated by Andrea Amort and designed by Thomas Hamann, concludes with film contributions by Amanda Piña, Doris Uhlich, Thomas Kampe and Simon Wachsmuth. The starting point for the exhibition was the donation of the extensive legacy of texts by the dancer, choreographer and pedagogue Rosalia Chladek (Brno 1905–1995 Vienna) to the newly established dance archive at the Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) in 2015. The Internationale Gesellschaft Rosalia Chladek (IGRC) entrusted the task of making it accessible to Andrea Amort. The Theatermuseum will take over this valuable material comprising more than a hundred boxes after this has been achieved. -

Und Sachinformationen Für Den Buchkauf
15238 l 4. Jahrgang l Oktober 2012 l Ausgabe 5 l ISSN 1867-5328 l Besuchen Sie uns auf der FACHBuchmesse!- UND Halle 4.2 SACH Stand P INFORMATIONEN457 FÜR DEN BUCHKAUF IM FOKUS l Thema: Organspende Gespräch mit Annett Pöpplein WIRTSCHAFT l Freiheit statt Kapitalismus l Der Euro l Der globale Minotaurus l China. Der bessere Kapitalismus RECHT l Bank- und Kapitalmarktrecht l Rechtspolitik und Rechtskultur l Moderne deutsche Strafgesetzgebung l Verwaltungsrecht der EU STEUERN l Neuerscheinungen VERLAGE Nutzung und Trends überwachen l Kohlhammer von A bis Z Publikationen der Mitglieder nachverfolgen l Ellert & Richter POLITIK Reichweite eigener Publikationen ermitteln l Die Außenpolitik Chinas Eigene Online-Bestände einbinden BIOGRAPHIEN Kollaborationsaktivitäten analysieren l Frauen! Zitierstil entwicentwickeln und vorgeben Haben Sie Interesse? KINDER- UND JUGENDBUCH l Gespräche mit VerlegerInnen www.fachbuchjournal.de € Einzelpreis 7,– Verlag Dinges & Frick basisbibel.de Entdecken Sie die neue Generation Bibelübersetzung: blau ISBN 978-3-438-00974-6 Ab 10 Exemplaren €(D) 18,90 I €(A) 19,40 I CHF 28,50 Urtextnah, lesefreundlich und crossmedial. BasisBibel Ab 20 Exemplaren €(D) 17,90 I €(A) 18,40 I CHF 26,50 petrol ISBN 978-3-438-00975-3 Neues Testament mit Psalmen. 13 x 19 cm, 1520 Seiten, Ab 50 Exemplaren €(D) 16,90 I €(A) 17,40 I CHF 25,50 Lesebändchen, partieller Farbschnitt, zwei Farbregister, hellgrün ISBN 978-3-438-00976-0 fl exibler Farbeinband. lila ISBN 978-3-438-00977-7 €(D) 19,90 | €(A) 20,50 | CHF 29,50 gelb ISBN 978-3-438-00978-4 Gebührenfreie Bestell-Hotline 0800-242 3546 EDITORIAL „Lesen macht Spaß wie Essen oder Gärtnern.“ Der Deutsche Taschenbuch Verlag hat ein ganz wichtiges Sachbuch zum Thema Organspende auf den Markt gebracht, das wir in den Fokus dieser Buchmesseausgabe stellen. -

ROEDER, MANFRED 0013.Pdf
DECLASSIFIED AND RE LEASED BY CENTRkl INTELLIGENCE AGENCY SOUR-ICES METHODS EXEMPT 10qA-y S IICA., r "ea,r) nT NAZI WAR CR INES OISCLOSM DATE 2004 2006 . The Rote Kapelle (FINCK Study) C. ,_] . 1. Harro S HULZE-BOYSEN was born on 2 September 1909 in Kiel to naval officer Edgar SC ZE and his wife, Marie-Louise nee BOYSEN. He grew up in Berlin and Duisb rg. After completing his education, SCHULZE-,BOYSEN became a member of the Jungdeutschen Ordens". He traveled abroad to Sweden and . England, visitin friends and relatives. After his Abitur exams, he began to study law. He n ver finished his law studies because he chose to enter politics. In 19 2 he became a member of the editorial staff of the "Gegner", a political peni dical. Soon he became its chief editor and published his own political br chure, "Gegner von heute, Kampfgenossen von Morgen" (Enemy today; ally tomo row). 2. In Apri 1933 the Nazi regime banned the "Gegner" and its offices were destroyed. Harr SCHULZE-BOYSEN and some of his co-workers were arrested by SS-Sturm troops. The troops were very brutal towards the men they arrested and even maltrea ed one of the prisoners so badly that he died. SCHULZE-BOYSENs mother came to rlin and was successful in getting her sons release. The release was gran ed on the condition that SCHULZE-BOYSEN leave Berlin and in the future, stay out of politics. 3. SCHULZE BOYSEN then took a one-year course at the Verkehrs-Fliegerschule in Warnemuende. -

Recalling Her Dance
Aufruf (1943/44) Mimose. Ein Übergang. 14. März 2021 ___Den Fokus auf Berührung, also auf Sinneswahrnehmung zu richten, Der Boden auf dem wir tanzen „Das Ganze ist der Ruf eines Arbeiters an seine ___Eigentlich wollte ich meine Großeltern besuchen – dann kommt etwas bringt mich in den Moment der Gegenwart. Bewegungen entstehen, sind ___Es ist uns ja auch im Tanz längst klar: Es gibt kein Morgen Genossen aus ihrem Trott auszubrechen und ihm zu dazwischen, nämlich die Information, meine Cousine habe sich mit dem aber unvorhersehbar, erzeugen neue Verbindungen zu meiner Umwelt. ohne Gestern und nur Heute können wir Entscheidungen treffen, folgen. Schwere Arbeiterhände, kräftige, nie Virus angesteckt und außerdem steigen die Ansteckungszahlen im nördlichen ___Die Art und Weise wie sich diese Pflanze bewegt – funktioniert als eine wie wir weiter verfahren wollen. Angelegt auf die Situation des ermüdende Beine, entschlossenes Gesicht, dessen Burgenland stark an. Mein Vater rät ab, aus Sorge um meine Großmutter, ziemlich fantastische Anleitung zur Improvisation. Dabei, diese Blume zu künstlerischen „modernen“, jeweils zeitgenössischen, von einer Bitterkeit vom also gut, ich fahre nicht, dann in zehn Tagen. „verkörpern“, muss ich unerwartet an Deborah Hays „What if..?“ – Fragen zutiefst demokratischen Haltung durchpulsten Tanzes in Österreich Wien. Widerstand. Tanz idealistischen ___1942, im Jahr als Hanna Berger „Die Un bekannte denken. Natürlich erzeugt jede Bewegung auch Form, aber ist das Form oder scheint die Frage nach dem Woher und dem Wohin, zeithistorisch ___Im Solo „Aufruf“ wird die Idee, gegen Unterdrückung und Kampfgeist über- aus der Seine“ choreografiert und in der Wiener ist es einfach nur Bewusstsein? Wie viel Form braucht eine Pflanze? gedacht, eine stets prekäre.