Carl Jacob Burckhardt Als Schriftsteller
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verlag Vittorio Klostermann Gesamtkatalog Stand Januar 2020
Verlag Vittorio Klostermann Gesamtkatalog Stand Januar 2020 A Abendland A.F und N.F. siehe Reihenverzeichnis L´absence au niveau syntagmatique. Fallstudien zum Französischen. Herausgegeben von Ludwig Fesenmeier, Anke Grutschus, Carolin Patzelt 2013. 300 Seiten. Analecta Romanica Band 80 Kt € 79.-* Best.Nr. 3757-6 E-Book € 158.- Best.Nr. 13757-3 E. Lavric: Article zéro et absence d´article an allemand et en français – A. Violet: L´article zéro après la préposition en allemand et en français – D. Marzo/B. Umbreit: Absenz und Präsenz verbaler Argumente. Hinweise auf den Nominalisierungsgrad von Infinitiven im Französischen – S. Heidinger: Zur Absenz und Präsenz eines Valenzoperators bei unmarkier- ten Antikausativa im Französischen – C. Meisner: Ne oder nicht ne? Akzeptabilitätstests zu verschiedenen Realisierungen der französischen Negation in phonischer Nähe- und Distanz- sprache – A. Dufter: Zur Geschichte der ne-Absenz in der neufranzösischen Satznegation – P. Hadermann: Les absences dans les comparatives en français – J. Glikman: L´absence se sub- ordonnant en français – C. Fuchs: L´inversion absolue en français – N. Tanguy: La phrase averbale, une phrase sans verbe? – M. Becker: La concordance des temps. Un cas d´absence? – C. Martinez: L´absence de signes diacritiques dans les écrits de la vie quotidi- enne – N. Rentel: Sprachliche Strategien zur Kompensation von Absenz in SMS Achter, Viktor: Geburt der Strafe 1951. 144 Seiten Kt € 18.- Best.Nr. 0001-3 Ackermann, Kathrin: Von der philosophisch-moralischen Erzählung zur modernen Novelle. Contes und nouvelles von 1760 bis 1830 2004. 398 Seiten. Analecta Romanica 70 Kt € 68.-* Best.Nr. 3228-1 E-Book € 95.20 Best.Nr. 13228-8 Adler, Alfred: Episches Frage- und Antwortspiel in der „Geste de Nanteuil” mit einem Exkurs über Gegenbildlichkeit in altfranzösischen „chansons de geste” 1974. -
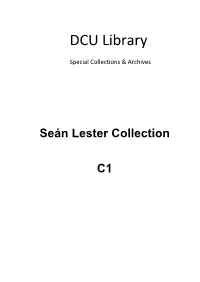
Seán Lester Collection Finding
DCU Library Special Collections & Archives Seán Lester Collection C1 © DCU Library 2019 *Each digitised diary is linked below in its original order and combined as PDF C1 Seán Lester Collection Page 3 C1/1 − Diary: October 1935 – January 1936 PDF 8 C1/2 − Diary: January – June 1936 PDF 8 C1/3 − Diary: May 1936 – February 1937 PDF 8 C1/4 − Diary: January – December 1937 PDF 9 C1/5 − Diary: January – July 1938 10 C1/6 − Diary: September 1938 – March 1939 10 C1/7 − Diary: August 1939 – April 1940 11 C1/8 − Diary: May – December 1940 12 C1/9 − Diary: August 1940 – April 1941 13 C1/10 − Diary: April – December 1941 14 C1/11 − Diary: 1942 15 C1/12 − Address book 16 C1/13 − Metal Case 16 − Television documentary: Nation Builders – C1/14 16 Sean Lester 2 Reference Code: IE DCUA C1 Title: Seán Lester Collection Creation Dates: 1935-2003 Level of Description: Fonds Extent and Medium: 2 boxes Name of Creator: Seán Lester Biographical History: Seán Ernest Lester [baptised John Lester] was born on 27 September 1888 in Carrickfergus, County Antrim, to Robert John Lester and Henrietta Mary Lester (née Ritchie). The Lesters owned a grocery shop and Seán attended the Methodist College in Belfast until the age of 14 when he began working for the Belfast & County Down Railway in Bangor. Due to being colour-blind, he was forced to leave his railway job and began a career in journalism with the unionist North Down Herald newspaper in 1905, where one of his colleagues was Ernest Blythe. In the next few years he would go on to work for several newspapers including the Dublin Evening Mail, the Dublin Daily Express, and the Galway Connaught Tribune. -

The International Committee of the Red Cross and Chemical Warfare in the Italo-Ethiopian War 1935-1936
Force versus law: The International Committee of the Red Cross and chemical warfare in the Italo-Ethiopian war 1935-1936 by Rainer Baudendistel "Caritas inter arma" is no longer possible: this is all-out war, pure and simple, with no distinction made between the national army and the civilian population, and it is inevitable that the poor Red Cross is drowning in the flood. Sidney H. Brown, ICRC delegate, 25 March 19361 M"e Odier: (...) How can we reconcile the obligation to remain silent with the dictates of human conscience? That is the problem. President: We kept silent because we did not know the truth. Minutes of ICRC meeting, 3 July 19362 Rainer Baudendistel has a degree in philosophy and history from the University of Geneva and an M.A. in international relations from the Fletcher School of Law and Diplomacy. An experienced ICRC delegate, the author has spent a total of six years in Ethiopia and Eritrea. 1 "lln'y a plus de possibility de "caritas inter arma", c'est la guerre a outrance pure et simple, sans distinction aucune entre I 'armee nationale et la population civile, et quant a lapauvre Croix-Rouge, il est Men naturel qu'elle soit engloutie dans lesflots. " Archives of the International Committee of the Red Cross, Geneva (hereafter "ICRC Archives"), Rapports des delegues. No. 13, 25 March 1936. - Note: all translations of original French extracts from ICRC Archives by the author. 2 "M"e Odier: (...) Comment concilier le devoir du silence et celui d'exprimer les avis de la conscience humaine? Tel est le probleme. -

Modernism, Fiction and Mathematics
MODERNISM, FICTION AND MATHEMATICS JOHANN A. MAKOWSKY July 15, 2019 Review of: Nina Engelhardt, Modernism, Fiction and Mathematics, Edinburgh Critical Studies in Modernist Culture, Edinburgh University Press, Published June 2018 (Hardback), November 2019 (Paperback) ISBN Paperback: 9781474454841, Hardback: 9781474416238 1. The Book Under Review Nina Engelhardt's book is a study of four novels by three authors, Hermann Broch's trilogy The Sleepwalkers [2, 3], Robert Musil's The Man without Qualities [21, 23, 24], and Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow and Against the Day [27, 28]. Her choice of authors and their novels is motivated by the impact the mathe- matics of the interwar period had on their writing fiction. It is customary in the humanities to describe the cultural ambiance of the interwar period between World War I and World War II as modernism. Hence the title of Engelhardt's book: Mod- ernism, Mathematics and Fiction. Broch and Musil are indeed modernist authors par excellence. Pynchon is a contemporary American author, usually classified by the literary experts as postmodern. arXiv:1907.05787v1 [math.HO] 12 Jul 2019 Hermann Broch in 1909 Robert Musil in 1900 1 2 JOHANN A. MAKOWSKY Thomas Pynchon ca. 1957 Works produced by employees of the United States federal government in the scope of their employment are public domain by statute. Engelhard's book is interesting for the literary minded mathematician for two reasons: First of all it draws attention to three authors who spent a lot of time and thoughts in studying the mathematics of the interwar period and used this experience in the shaping of their respective novels. -

Switzerland – Second World War Schlussbericht Der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg
Final Report of the Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Schlussbericht der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg Rapport final de la Commission Indépendante d'Experts Suisse – Seconde Guerre Mondiale Rapporto finale della Commissione Indipendente d'Esperti Svizzera – Seconda Guerra Mondiale Final Report of the Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Members: Jean-François Bergier, Chairman Wladyslaw Bartoszewski Saul Friedländer Harold James Helen B. Junz (from February 2001) Georg Kreis Sybil Milton (passed away on 16 October 2000) Jacques Picard Jakob Tanner Daniel Thürer (from April 2000) Joseph Voyame (until April 2000) Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Switzerland, National Socialism and the Second World War Final Report PENDO Secretary General: Linus von Castelmur (until March 2001), Myrtha Welti (from March 2001) Scientific Project Management: Stefan Karlen, Martin Meier, Gregor Spuhler (until March 2001), Bettina Zeugin (from February 2001) Scientific-Research Adviser: Marc Perrenoud ICE Database: Development – Management: Martin Meier, Marc Perrenoud Final Report Editorial Team / Coordination: Mario König, Bettina Zeugin Production Assistants: Estelle Blanc, Regina Mathis Research Assistants: Barbara Bonhage, Lucas Chocomeli, Annette Ebell, Michèle Fleury, Gilles Forster, Marianne Fraefel, Stefan Frech, Thomas Gees, Frank Haldemann, Martina Huber, Peter Hug, Stefan Karlen, Blaise Kropf, Rodrigo López, Hanspeter Lussy, Sonja -

Rilke in Bern Sonette an Orpheus
Rilke in Bern Sonette an Orpheus Im Auftrag der Rilke-Gesellschaft herausgegeben von Jörg Paulus und Erich Unglaub Rilke_32.indd 3 05.08.14 15:35 Zuschriften an die Redaktion: PD Dr. Jörg Paulus Technische Universität Braunschweig Institut für Germanistik Bienroder Weg 80 38106 Braunschweig E-Mail: [email protected] Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Wallstein Verlag, Göttingen 2014 www.wallstein-verlag.de Vom Verlag gesetzt aus der Stempel Garamond Druck und Verarbeitung: Hubert & Co, Göttingen ISBN 978-3-8353-1493-1 Rilke_32.indd 4 05.08.14 13:08 Simona Noreik und Erich Unglaub Zu Carl Jacob Burckhardt. Eine kleine Nachlese Unter den Schweizer Freunden Rilkes ist der Basler Historiker und Diplomat Carl Jacob Burckhardt (1891-1974)1 eine durchaus bemerkenswerte Gestalt. Die Be- kanntschaft mit Rilke ergab sich aus den Zeitumständen.2 Im Juni 1919 war Rilke von München aus in die Schweiz gekommen, der äußere Anlaß war die Einladung zu einer Vortragsreise, die ihn in mehrere Städte führte und ihn auch meist mit ei- nem jüngeren Publikum – Studentinnen und Studenten – bekannt machte, während der Dichter durchaus auch an sich anschließenden Kontakten mit den »einheimi- schen alten Familien«3 interessiert war. Nach einer Lesung in Basel lernte Rilke im Ritterhof4 die alteingesessene Familie Burckhardt näher kennen. Den Kontakt hatte eine Bekannte von Clara Rilke, die sächsische Schriftstellerin und Bildhauerin Emmy von Egidy (1872-1946), hergestellt, die dort gerade einen Porträt-Auftrag ausführte. Zuerst wurde Rilke von der Hausherrin Theodora Von der Mühll, geb. -

Gerald Steinacher, Hakenkreuz Und Rotes Kreuz. Eine Humanitäre
Francia-Recensio 2016/1 19.±20. Jahrhundert ± Époque contemporaine Gerald Steinacher, Hakenkreuz und Rotes Kreuz. Eine humanitäre Organisation zwischen Holocaust und Flüchtlingsproblematik, Innsbruck (StudienVerlag) 2013, 211 S., ISBN 978-3-7065-4762-8, EUR 24,90. rezensiert von/compte rendu rédigé par Gilad Ben-Nun, Leipzig In recent years, historical research concerning the International Committee of the Red Cross' (ICRC) involvement and impact upon international affairs has seen a steady growth, both in terms of the sheer number of thorough archive-based publications, and in terms of their importance to other realms of research (most notably legal commentaries on the application of international humanitarian law). This trend is also evident in periodicals, as the longstanding International Review of the Red Cross (over 90 years old now), has recently become an integral part of Cambridge University Press' Journals. Within this recent surge in literature, Gerald Steinacher's contributions have played a somewhat special role in contextualizing the post WW II evolvement of the ICRC, given the overcast shadow which the Jewish Holocaust shed over the ICRC's disturbing lack of its action, and its consequent indictment as to its knowledge and arguable tacit complacency during that era. Steinacher is the author of the ground-breaking study on the direct involvement of the ICRC (alongside western intelligence agencies such as the CIA and the MI5) in providing the main escape route for Nazi war criminals from Western Europe to Latin America after WW II. Originally published in 2008 in German1, The Oxford University Press translation of »Nazis on the Run« rightfully won the National Jewish Book award, and merited whole hearted acceptance in the academic community thanks to Steinacher's painstakingly detailed archive research of the full escape route and aid which Nazis such as Joseph Mengele, Adolf Eichmann, Klaus Barbie and many others, received from the ICRC who issued them false-named travel documents, which they used to escape trial and judgment by the Allies. -

Cold Empathy: Challenges in Writing a Life of Reinhard Heydrich
Cold Empathy: Challenges in Writing a life of Reinhard Heydrich Life-Writing in Europe conference, Oxford 20-21 April Robert Gerwarth The subject of my recently published biography, Reinhard Heydrich, is widely recognized as one of the great iconic villains of the twentieth century, an appalling figure even within the context of the Nazi elite. Countless TV documentaries, spurred on by the fascination of evil, have offered popular takes on his intriguing life, and there is no shortage of sensationalist accounts of his 1942 assassination in Prague and the unprecedented wave of retaliatory Nazi violence that culminated in the vengeful destruction of the Bohemian village of Lidice. Arguably the most spectacular secret service operation of the entire Second World War, the history of the assassination and its violent aftermath have inspired the popular imagination ever since 1942, providing the backdrop to Heinrich Mann’s novel Lidice (1942), Berthold Brecht’s film-script for Fritz Lang’s 1943 Hollywood blockbuster Hangmen also Die, a whole series of HISTORY channel and BBC documentaries, and two recent Prix-Goncourt-winning SS novels: by Jonathan Littell’s The Kindly Ones and Laurent Binet’s HHhH, (an acronym for the Goering quote: “Himmler’s Hirn heisst Heydrich”). The continuing popular fascination with Heydrich is quite easily explained. Although probably not as widely known to the non-German (and non-Czech) general public as Hitler, Himmler and Goebbels, Heydrich played a key role in Nazi Germany’s policies of persecution and terror. Although merely thirty-eight years old at the time of his violent death in Prague in June 1942, Heydrich had accumulated three key positions in Hitler’s rapidly expanding empire. -
Switzerland and Refugees in the Nazi Era
Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Switzerland and Refugees in the Nazi Era This version has been replaced by the revised and completed version: Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg: Die Schweiz und die Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus, Zürich 2001 (Veröffentlichungen der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, vol. 17). Order: Chronos Verlag (www.chronos-verlag.ch) Edited by Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War P.O. Box 259 3000 Bern 6, Switzerland www.uek.ch Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War: Switzerland and Refugees in the Nazi Era. Bern, 1999. ISBN 3-908661-07-2 English version has been translated from German and French original texts Distributed by BBL/EDMZ, 3003 Bern www.admin.ch/edmz Art.-No. 201.282 eng 12.99 1000 H-UEK 07-10-99 Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Switzerland and Refugees in the Nazi Era Members of the Commission / General Management Jean-François Bergier, Chairman Sybil Milton, Vice-Chairman/Report Management Joseph Voyame, Vice-Chairman Wladyslaw Bartoszewski Georg Kreis, Report Management Saul Friedländer, Report Management Jacques Picard, Delegate Harold James Jakob Tanner General Secretary Linus von Castelmur Project Direction Gregor Spuhler Academic Advisor Marc Perrenoud Authors Valérie Boillat, Daniel Bourgeois, Michèle Fleury, Stefan Frech, Michael Gautier, Tanja Hetzer, Blaise Kropf, Ernest H. Latham, Regula Ludi (team leader), Marc Perrenoud, Gregor Spuhler (team leader), Hannah E. Trooboff Researchers Thomas Busset, Frank Haldemann, Ursina Jud, Martin Lind, Martin Meier, Laurenz Müller, Hans Safrian, Thomas Sandkühler, Bernhard Schär, Daniel Schmid, Marino Viganò, Daniel Wildmann, Bettina Zeugin, Jan Zielinski, Regula Zürcher Administration/Production Estelle Blanc, Armelle Godichet, Regina Mathis Translation from the German: Susan M. -

Carl Jacob Burckhardt *10
Carl Jacob Burckhardt *10. September 1891 in Basel +3. März 1974 in Vinzel, Kanton Waadt, Schweiz Gästebücher Bd. VII mit Ehefrau Elisabeth Aufenthalte Schloss Neubeuern: 9.-11. Oktober 1928 / 27. Oktober 1928 v.l. Carl Jacob Burckhardt, Gräfin Ottonie Degenfeld-Schonburg und Hugo von Hofmannsthal im Oktober 1924 in Bad Aussee war ein Schweizer Diplomat, Essayist und Historiker. Als sein literarisches Hauptwerk gilt die von 1935 bis 1967 veröffentlichte dreibändige Richelieu-Biographie. Im Jahr 1937 wurde er vom Völkerbund zum Hohen Kommissar für die Freie Stadt Danzig ernannt. Von 1944 bis 1948 war er Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Carl Jacob Burckhardt wurde als Sohn eines Juristen in Basel geboren. Er besuchte Gymnasien in Basel und Glarisegg. Anschließend studierte er Geschichtswissenschaften in Basel, München, Göttingen und Zürich und schloss sein Studium 1918 mit der Promotion zum Dr. phil. ab. Von 1918 bis 1922 war er Gesandtschaftsattaché in Wien, wo er mit Hugo von Hofmannsthal Freundschaft schloss. 1926 habilitierte er sich an der Universität in Zürich. Drei Jahre später wurde er hier zum Professor für Neuere Geschichte berufen. Von 1932 bis 1937 und von 1939 bis 1945 war er darüber hinaus auch in Genf als Professur für Geschichte am "Institut des Hautes Études Internationales" tätig. In seinem literarischen Schaffen befasste sich Burckhardt mit großen Gestalten der europäischen Geschichte. 1935 erschien der erste Teil seines Hauptwerkes, der später dreiteiligen Biographie "Richelieu". 1923 war er im Rahmen eines Besuches griechischer Kriegsgefangener in der Türkei erstmals für das IKRK aktiv, zehn Jahre später wurde er Mitglied des Komitees und besuchte in dieser Funktion 1935 und 1936 Konzentrationslager in Deutschland. -

Mennonite Responses to Nazi Human Rights Abuses: a Family in Prussia/Danzig
Mennonite Responses to Nazi Human Rights Abuses: A Family in Prussia/Danzig Christiana Epp Duschinsky, Ottawa Human rights abuses are always tragic and that tragedy is magnified many millions of times when one examines the human rights abuses of the Nazi regime of Germany, the worst of its kind of the twentieth century. The record is well known, but here is a brief summary of the brutality. In Germany itself, the Nazis jailed and tortured their political opponents; as the existing jails were soon full, the Nazis set up their infamous system of concentration camps, enabling systematic terror and torture. German Jews were systematically persecuted while some 100,000 “Aryan” Germans who were considered “unworthy of life” were murdered. After 1939 the Third Reich invaded and controlled most of continental Europe. In conquered Poland and the Soviet Union, the Nazi regime targeted the “inferior” Slavic-speaking populations with enslavement and mass-murder. Estimates vary, but at least five million civilians,1 possibly many more, were intentionally executed or worked and starved to death. In addition, all Jews and Roma (Gypsies) in all Nazi-controlled areas were slated for genocidal murder and some six million were killed. 82 Journal of Mennonite Studies When Hitler took dictatorial power in Germany with the Enabling Act of March 23, 1933 and transformed the country into the aggressive, totalitarian state he called The Third Reich, there were some 7,599 Mennonites in Prussia, a few thousand more in the rest of Germany, and a further 5,600 in the region of the Free City of Danzig, the area with the largest concentration of Mennonites in the German-speaking areas.2 In March 1933 very few German Mennonites, indeed very few Germans in general, foresaw the degree of brutality and murder the Nazis would visit on their fellow Germans and on the people they would conquer. -
An Institution Standing the Test of Time? a Review of 150 Years of The
Volume 95 Number 889 Spring 2013 An institution standing the test of time? A review of 150 years of the history of the International Committee of the Red Cross Daniel Palmieri* Daniel Palmieri is the historical research officer at the ICRC. He is the author of numerous works on ICRC history and on the history of war. Abstract This article seeks to explain how the ICRC – the oldest international humanitarian organization still in activity – has managed to pass through 150 years of existence. By analysing some key moments in ICRC history and by examining both its inner workings and their interaction with the context within which the organization has functioned over time, this article finds two characteristics that may help explain the ICRC’s continuity: its unique specificity and its innovative capacity. The International Committee of the Red Cross (ICRC) was born out of a wager on the future by five Geneva citizens. The five met on 17 February 1863 to consider the proposals made by one of them and to simultaneously form a ‘Permanent * This article was written in a personal capacity and does not necessarily reflect the views of the ICRC. The original version of this article is in French. doi:10.1017/S1816383113000039 1 Daniel Palmieri – An institution standing the test of time? International Committee’.1 The story is well known. However, the reasons that drove Dunant and his colleagues to consider their work as necessarily permanent are less well known, especially the objective reasons that enabled the ICRC to persevere through the many ups and downs of the last 150 years, even though, as we will see, varying events could have been its undoing.