Österreichische Musikzeitschrift
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
ARSC Journal
A Discography of the Choral Symphony by J. F. Weber In previous issues of this Journal (XV:2-3; XVI:l-2), an effort was made to compile parts of a composer discography in depth rather than breadth. This one started in a similar vein with the realization that SO CDs of the Beethoven Ninth Symphony had been released (the total is now over 701). This should have been no surprise, for writers have stated that the playing time of the CD was designed to accommodate this work. After eighteen months' effort, a reasonably complete discography of the work has emerged. The wonder is that it took so long to collect a body of information (especially the full names of the vocalists) that had already been published in various places at various times. The Japanese discographers had made a good start, and some of their data would have been difficult to find otherwise, but quite a few corrections and additions have been made and some recording dates have been obtained that seem to have remained 1.Dlpublished so far. The first point to notice is that six versions of the Ninth didn't appear on the expected single CD. Bl:lhm (118) and Solti (96) exceeded the 75 minutes generally assumed (until recently) to be the maximum CD playing time, but Walter (37), Kegel (126), Mehta (127), and Thomas (130) were not so burdened and have been reissued on single CDs since the first CD release. On the other hand, the rather short Leibowitz (76), Toscanini (11), and Busch (25) versions have recently been issued with fillers. -

LIST of WORKS in the EXHIBITION Dance of Hands
LIST OF WORKS IN THE EXHIBITION Dance of Hands. Tilly Losch and Hedy Pfundmayr in Photographs 1920 ─1935 November 14, 2014–February 15, 2015 Rupertinum Works are listed in alphabetical order according to artist’s names and in chronological order. Works indicated in italics are authorized titles, otherwise a descriptive title is used. Height proceeds width proceeds depth. Anonymous Salzburg Festival 1926, 1926 Film, 16mm (black and white, silent) transferred to digital video disc 14:25 min. This film is stored at Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin Friedrich Wilhelm Murnau Nosferatu—A Symphony of Horror , 1922 Max Schreck as Nosferatu Frame enlargement Silver gelatin print (vintage print) 6.8 x 9 cm Austrian Film Museum, Vienna Friedrich Wilhelm Murnau Nosferatu—A Symphony of Horror , 1922 Wolfgang Heinz as Nosferatu and Max Schreck as Maat Film still Silver gelatin print (vintage print) 10.2 x 12.4 cm Austrian Film Museum, Vienna Robert Wiene The Hands of Orlac , 1924 Conrad Veidt as Paul Orlac and Alexandra Sorina as Yvonne Orlac Film still Silver gelatin print (vintage print) 21.1 x 27 cm Austrian Film Museum, Vienna Robert Wiene The Hands of Orlac , 1924 Conrad Veidt as Paul Orlac and Fritz Kortner as Nera Film still 1/21 Dance of Hands_List of works Silver gelatin print (vintage print) 21.3 x 27.4 cm Austrian Film Museum, Vienna Robert Wiene The Hands of Orlac , 1924 Conrad Veidt as Paul Orlac Silver gelatin print Photo: 17,6 x 23,6 cm Theatermuseum, Vienna Gustav Ucicky Pratermizzi , 1926 Hedy Pfundmayr as double of the dancer Valette -

Echo and Influence Violin Concertos by Franz Clement in the Gravitation Field of Beethoven
Echo and Influence Violin Concertos by Franz Clement in the Gravitation Field of Beethoven World premier recording by Mirijam Contzen and Reinhard Goebel For the opening of Sony Classical’s „Beethoven’s World“ series Franz Joseph Clement (1780-1842) CONCERTO NO. 1 IN D-MAJOR FOR VIOLIN AND ORCHESTER (1805) [1] ALLEGRO MAESTOSO [2] ADAGIO [3] RONDO. ALLEGRO CONCERTO N. 2 IN D-MINOR FOR VIOLIN AND ORCHESTER (AFTER 1806) (WORLD PREMIER RECORDING) [4] MODERATO [5] ADAGIO [6] RONDO. ALLEGRO WDR Symphony Orchestra // Reinhard Goebel (Conductor) Mirijam Contzen (Violin) Sony Classical 19075929632 // Release (Germany): 10th of January 2020 For many years violinist Mirijam Contzen has supported the conductor and expert for historical performance practice Reinhard Goebel in his efforts to reintroduce audiences to 18th and early 19th century compositions: works that for decades have resided in the shadows, lost and forgotten, amongst the ample works preserved in various musical archives. The recordings of the Violin Concertos Nos. 1 and 2 by Viennese virtuoso Franz Joseph Clement (1780-1842) mark the rediscovery of such treasures. Together with the WDR Symphony Orchestra, Contzen and Goebel will kick-off the quintuple series „Beethoven’s World“, curated by Goebel himself, which will be released by Sony Classical throughout 2020 - the year of Beethoven’s 250th birthday anniversary. The German release date for the first album has been set for the 10th of January and includes the world premiere recording of Clements Violin Concerto No. 2 - a work lost soon after its introduction to the public in the first decade of the 19th century. The CD series acts as Reinhard Goebel’s contribution to Beethoven’s anniversary year. -

Reviews of This Artist
Rezension für: Hertha Klust Pilar Lorengar: A portrait in live and studio recordings from 1959-1962 Vincenzo Bellini | Giacomo Puccini | Georg Friedrich Händel | Enrique Granados | Alessandro Scarlatti | Wolfgang Amadeus Mozart | Giuseppe Verdi | Joaquín Rodrigo | Joaquín Nin | Jesús García Leoz | Jesús Guridi | Eduardo Toldrà | _ Anonym | Jacobus de Milarte | Esteban Daza | Juan Bermudo | Luis de Narváez | Juan Vásquez | Alonso Mudarra | Luis de Milán | Diego Pisador | Enríquez de Valderrábano 3CD aud 21.420 operafresh.blogspot.de Tuesday, May 20, 2014 ( - 2014.05.20) Pilar Lorengar Live and Studio Recordings 1959-1962 Berlin In addition to the live opera recordings on this release, is the famous studio recording of songs with guitar featuring Siegfried Behrend available for the first time on CD outside of Japan. Full review text restrained for copyright reasons. Das Opernglas Juni 2014 (J. Gahre - 2014.06.01) CD News Ihre Stimme [strahlt] in diesen um 1960 gemachten Aufnahmen Wärme und Weiblichkeit aus, die den modernen Hörer durchaus gefangen nehmen können. Full review text restrained for copyright reasons. page 1 / 96 »audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • [email protected] • www.audite.de http://theaterpur.net Juni 2014 (Christoph Zimmermann - 2014.06.01) Tenorales Gruppenbild mit Damen Pilar Lorengars klares, sonnenhelles Organ lässt nirgends falsche Sentimentalität aufkommen. [...] Neuerlich bezaubert die Natürlichkeit der Darstellung ohne ein demonstratives Ausstellen vokaler Raffinessen. Full review text restrained for copyright reasons. Der Tagesspiegel 22.07.2014 (Frederik Hanssen - 2014.07.22) Klassik-CD der Woche: Pilar Lorengar Spanische Nächte Die Norma wie auch „Piangerò la sorte mia“ aus Händels „Giulio Cesare“ meistert sie mit Eleganz, jugendlicher Strahlkraft und schier endlosem Atem Full review text restrained for copyright reasons. -

Eberhard Waechter“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Eberhard Waechter“ Verfasserin Mayr Nicoletta angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl: A 317 Studienrichtung: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof.Dr. Hilde Haider-Pregler Dank Ich danke vor allem meiner Betreuerin Frau Professor Haider, dass Sie mir mein Thema bewilligt hat und mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich danke der Familie Waechter und Frau Anneliese Sch. für die Bereitstellung des Materials. Ich danke meiner Schwester Romy und meiner „Seelenverwandten“ Sheila und all meinen Freunden für ihre emotionale Unterstützung und die zahlreichen motivierenden Gespräche. Ich danke meinem Bruder Florian für die Hilfe im Bereich der Computertechnik. Ein großer Dank gilt meiner Tante Edith, einfach dafür, dass es dich gibt. Außerdem danke ich meinen Großeltern, dass sie meine Liebe zur Musik und zur Oper stets enthusiastisch aufgenommen haben und mit mir Jahr für Jahr die Operettenfestspiele in Bad Ischl besucht haben. Ich widme meine Diplomarbeit meinen lieben Eltern. Sie haben mich in den letzten Jahren immer wieder finanziell unterstützt und mir daher eine schöne Studienzeit ermöglicht haben. Außerdem haben sie meine Liebe und Leidenschaft für die Oper stets unterstützt, mich mit Büchern, Videos und CD-Aufnahmen belohnt. Ich danke euch für eure Geduld und euer Verständnis für eure oft komplizierte und theaterbessene Tochter. Ich bin glücklich und froh, so tolle Eltern zu haben. Inhalt 1 Einleitung .......................................................................................... -

Jakob Semotan
Vereinsmagazin der Wiener Volksopernfreunde Juni 2019 Jakob Semotan „Wien und die Volksoper - Die ideale Mischung“ Vereinsmagazin der Wiener Volksopernfreunde Juni 2019 boten auch die Wiener Volksopern- zu sein - zwischen den Künstlern und Liebe Volksopernfreunde! Inhalt freunde bisher in diesem Jahr! Bei den Mitarbeitern des Hauses, der Direktion Vorschau: Die „Jubiläumssaison“ der Volksoper monatlichen Soiréen konnten wir wie- und dem Publikum - aber auch genau- 2 Editorial und Kommentar neigt sich ihrem Ende zu und man er- der junge Künstler wie den charmanten so zwischen der Vergangenheit und der Soiréen bis Jahresende innert sich an so manche zauberhafte ab September Künstlerporträt Jakob Semotan Bariton Alexandre Beuchat vorstellen, Zukunft. 4 Abende, an im Gedächtnis haftende der im Mai im Haus sein Papageno-De- In der vorliegenden Ausgabe des im Gasthaus „Lechner“ Volksopern-Saisonvorschau Eindrücke und interessante Begegnun- büt feierte und nächste Saison erstmals „Souffleur“ feiern wir gleich mit ei- (Extrazimmer), 7 2019/2020 gen. Im Jänner feierte das Ballett „Cop- als Danilo im Maxim champagnisie- nigen Beiträgen den 200.Geburtstag Wilhelm-Exner-Gasse 28, pelia“ einen fulminanten Erfolg – „… ren wird. Auch konnten wir den neu- eines wahren Europäers – des Köl- 1090 Wien Zum 200. Geburtstag von eine „Coppelia“ wie aus dem Märchen- en fantastischen Higgins, Musical-Star ners und Parisers Jacques Offenbach! Jeden 2. Freitag im Monat: 10 Jacques Offenbach buch“, wie die „Presse“ in ihrer Kritik Axel Herrig begrüßen. Wir erinnern Volksopern-Experte Felix Brachetka 13. September, bemerkte. Man erinnert sich an den uns an wunderbare Künstlerporträts widmet sich dabei ausführlich Offen- 11. Oktober, 13 Offenbach an der Volksoper grandiosen „Fliegenden Holländer“ in mit der „Legende“ und ewig jungge- bachs Aufführungen in Wien und an 8. -

Der . Fliegende Hollander
_ Der . Fliegende Hollander. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016 Courtle[glz GOLD BAND FILTER TIPPED ·HAND BLENDED ·LIGHT AND MILD Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016 &caPAB ~ '' I I CAPAB OPERA/KHUIK-OPERA Artistic Director/ Artistieke Direkteur PROF. MURRAY DICKIE Der Fliegende Hollander OPERA IN THREE ACTS/OPERA IN DRIE BEDRYWE (Sung in German/Geslng in Duits) Music/Musiek & Libretto RICHARD WAGNER Producer/Regisseur, Set Designs/Dekorontwerpe, Lighting/Beligting GUNTHER SCHNEIDER-SIEMSSEN Conductor/Dirigent CHRISTOPHER DOWDESWELL Costume Designs/ Kostuumontwerpe JENNY DE SWARDT Lighting Director/ Beligtingsdirekteur PIETER DE SWARDT Design Assistants/ DIETMAR SOLT Ontwerpassistente AMELIA MULLER Scenic Painter/T oneeiskilder CHRISTOPHER LORENTZ Assistant Producer/ Assistent-Regisseur CHRISTINE CROUSE Choreography Adviser/ Choreografie-Adviseur PAMELA CHRIMES CAPAB CHORUS/ KRUIK-KOOR Chorus Master/Koormeester RAYMOND HUGHES CAPAB ORCHESTRA/ KRUIK-ORKES Leader/ Konsertmeester THOMAS MOORE Der Fliegende Hollander Der Riegende Hollander was first performed in Dresden is di€ eerste maal op 2 Januarie 1843 on 2nd January, 1843 in Dresden opgevoer. hrst production in the Nico Malan Opera House. Eerste produksie in die Nico Malan-Operahuis. Aprill976 Aprill976 Season: 29th March until 12th April, 1986. Speelvak: 29 Maart tot 12 Aprtll986. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016 THE VISUAL AND DRAMATIC CONCEPTION OF WAGNER'S DER FLIEGENDE HOLlANDER By Professor Giinther Schneider-Siemssen While Wagner's music for Tristan und Isolde belongs to the later period of his work and has an erotic and cosmic nature, Der Fliegende Hollander is an earlier work in which the influence of Verdi is sometimes felt. -

Brahms, Johannes (B Hamburg, 7 May 1833; D Vienna, 3 April 1897)
Brahms, Johannes (b Hamburg, 7 May 1833; d Vienna, 3 April 1897). German composer. The successor to Beethoven and Schubert in the larger forms of chamber and orchestral music, to Schubert and Schumann in the miniature forms of piano pieces and songs, and to the Renaissance and Baroque polyphonists in choral music, Brahms creatively synthesized the practices of three centuries with folk and dance idioms and with the language of mid and late 19thcentury art music. His works of controlled passion, deemed reactionary and epigonal by some, progressive by others, became well accepted in his lifetime. 1. Formative years. 2. New paths. 3. First maturity. 4. At the summit. 5. Final years and legacy. 6. Influence and reception. 7. Piano and organ music. 8. Chamber music. 9. Orchestral works and concertos. 10. Choral works. 11. Lieder and solo vocal ensembles. WORKS BIBLIOGRAPHY GEORGE S. BOZARTH (1–5, 10–11, worklist, bibliography), WALTER FRISCH (6– 9, 10, worklist, bibliography) Brahms, Johannes 1. Formative years. Brahms was the second child and first son of Johanna Henrika Christiane Nissen (1789–1865) and Johann Jakob Brahms (1806–72). His mother, an intelligent and thrifty woman simply educated, was a skilled seamstress descended from a respectable bourgeois family. His father came from yeoman and artisan stock that originated in lower Saxony and resided in Holstein from the mid18th century. A resourceful musician of modest talent, Johann Jakob learnt to play several instruments, including the flute, horn, violin and double bass, and in 1826 moved to the free Hanseatic port of Hamburg, where he earned his living playing in dance halls and taverns. -

Central Opera Service Bulletin
CENTRAL OPERA SERVICE BULLETIN WINTER, 1972 Sponsored by the Metropolitan Opera National Council Central Opera Service • Lincoln Center Plaza • Metropolitan Opera • New York, N.Y. 10023 • 799-3467 Sponsored by the Metropolitan Opera National Council Central Opera Service • Lincoln Canter Plaza • Metropolitan Opera • New York, NX 10023 • 799.3467 CENTRAL OPERA SERVICE COMMITTEE ROBERT L. B. TOBIN, National Chairman GEORGE HOWERTON, National Co-Chairman National Council Directors MRS. AUGUST BELMONT MRS. FRANK W. BOWMAN MRS. TIMOTHY FISKE E. H. CORRIGAN, JR. CARROLL G. HARPER MRS. NORRIS DARRELL ELIHU M. HYNDMAN Professional Committee JULIUS RUDEL, Chairman New York City Opera KURT HERBERT ADLER MRS. LOUDON MEI.LEN San Francisco Opera Opera Soc. of Wash., D.C. VICTOR ALESSANDRO ELEMER NAGY San Antonio Symphony Ham College of Music ROBERT G. ANDERSON MME. ROSE PALMAI-TENSER Tulsa Opera Mobile Opera Guild WILFRED C. BAIN RUSSELL D. PATTERSON Indiana University Kansas City Lyric Theater ROBERT BAUSTIAN MRS. JOHN DEWITT PELTZ Santa Fe Opera Metropolitan Opera MORITZ BOMHARD JAN POPPER Kentucky Opera University of California, L.A. STANLEY CHAPPLE GLYNN ROSS University of Washington Seattle Opera EUGENE CONLEY GEORGE SCHICK No. Texas State Univ. Manhattan School of Music WALTER DUCLOUX MARK SCHUBART University of Texas Lincoln Center PETER PAUL FUCHS MRS. L. S. STEMMONS Louisiana State University Dallas Civic Opera ROBERT GAY LEONARD TREASH Northwestern University Eastman School of Music BORIS GOLDOVSKY LUCAS UNDERWOOD Goldovsky Opera Theatre University of the Pacific WALTER HERBERT GIDEON WALDKOh Houston & San Diego Opera Juilliard School of Music RICHARD KARP MRS. J. P. WALLACE Pittsburgh Opera Shreveport Civic Opera GLADYS MATHEW LUDWIG ZIRNER Community Opera University of Illinois See COS INSIDE INFORMATION on page seventeen for new officers and members of the Professional Committee. -

Chronology 1916-1937 (Vienna Years)
Chronology 1916-1937 (Vienna Years) 8 Aug 1916 Der Freischütz; LL, Agathe; first regular (not guest) performance with Vienna Opera Wiedemann, Ottokar; Stehmann, Kuno; Kiurina, Aennchen; Moest, Caspar; Miller, Max; Gallos, Kilian; Reichmann (or Hugo Reichenberger??), cond., Vienna Opera 18 Aug 1916 Der Freischütz; LL, Agathe Wiedemann, Ottokar; Stehmann, Kuno; Kiurina, Aennchen; Moest, Caspar; Gallos, Kilian; Betetto, Hermit; Marian, Samiel; Reichwein, cond., Vienna Opera 25 Aug 1916 Die Meistersinger; LL, Eva Weidemann, Sachs; Moest, Pogner; Handtner, Beckmesser; Duhan, Kothner; Miller, Walther; Maikl, David; Kittel, Magdalena; Schalk, cond., Vienna Opera 28 Aug 1916 Der Evangelimann; LL, Martha Stehmann, Friedrich; Paalen, Magdalena; Hofbauer, Johannes; Erik Schmedes, Mathias; Reichenberger, cond., Vienna Opera 30 Aug 1916?? Tannhäuser: LL Elisabeth Schmedes, Tannhäuser; Hans Duhan, Wolfram; ??? cond. Vienna Opera 11 Sep 1916 Tales of Hoffmann; LL, Antonia/Giulietta Hessl, Olympia; Kittel, Niklaus; Hochheim, Hoffmann; Breuer, Cochenille et al; Fischer, Coppelius et al; Reichenberger, cond., Vienna Opera 16 Sep 1916 Carmen; LL, Micaëla Gutheil-Schoder, Carmen; Miller, Don José; Duhan, Escamillo; Tittel, cond., Vienna Opera 23 Sep 1916 Die Jüdin; LL, Recha Lindner, Sigismund; Maikl, Leopold; Elizza, Eudora; Zec, Cardinal Brogni; Miller, Eleazar; Reichenberger, cond., Vienna Opera 26 Sep 1916 Carmen; LL, Micaëla ???, Carmen; Piccaver, Don José; Fischer, Escamillo; Tittel, cond., Vienna Opera 4 Oct 1916 Strauss: Ariadne auf Naxos; Premiere -

Complete Piano Music • 2 Goran Filipec
includes WORLD PREMIÈRE RECORDINGS BERSA COMPLETE PIANO MUSIC • 2 TEMA CON VARIAZIONI BALLADE IN D MINOR SONATA IN C MAJOR RONDO-POLONAISE WALTZES GORAN FILIPEC BLAGOJE BERSA © Croatian Institute of Music / Hrvatski glazbeni zavodi GORAN FILIPEC BLAGOJE BERSA (1873–1934) Goran Filipec, laureate of the Grand Prix du Disque of the Ferenc Liszt Society of Budapest for his 2016 COMPLETE PIANO MUSIC • 2 recording of Liszt’s Paganini Studies (Naxos 8.573458), was born in Rijeka (Croatia) in 1981. He studied at the TEMA CON VARIAZIONI • BALLADE IN D MINOR Tchaikovsky Conservatory in Moscow, the Royal SONATA IN C MAJOR • RONDO-POLONAISE Conservatory in The Hague, the Hochschule für Musik WALTZES in Cologne and the Zagreb Academy of Music. He is a prize winner of several piano competitions including GORAN FILIPEC, Piano the Premio Mario Zanfi ‘Franz Liszt’, Concurso de Parnassos, the José Iturbi International Music Competition and the Gabala International Piano Catalogue Number: GP832 Competition. Filipec performs regularly in Europe, the Recording Dates: 15–16 October 2019 Recording Venue: Fazioli Concert Hall, Sacile, Italy United States, South America and Japan. He made his Producer: Goran Filipec © Stephany Stefan debut at Carnegie Hall in 2006, followed by Engineer: Matteo Costa performances in venues including the Mariinsky Editors: Goran Filipec, Matteo Costa Theatre, the Auditorium di Milano, Minato Mirai Hall, the Philharmonie de Paris and Piano: Fazioli, model F278 the Palace of Arts in Budapest. With the award by the Liszt Society, Goran Filipec Booklet Notes: Goran Filipec German Translation: Cris Posslac joined the list of prestigious laureates of the Grand Prix such as Vladimir Horowitz, Publisher: Croatian Institute of Music György Cziffra, Alfred Brendel, Claudio Arrau, Zoltán Kocsis and Maurizio Pollini. -
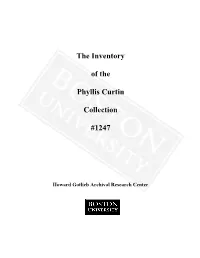
The Inventory of the Phyllis Curtin Collection #1247
The Inventory of the Phyllis Curtin Collection #1247 Howard Gotlieb Archival Research Center Phyllis Curtin - Box 1 Folder# Title: Photographs Folder# F3 Clothes by Worth of Paris (1900) Brooklyn Academy F3 F4 P.C. recording F4 F7 P. C. concert version Rosenkavalier Philadelphia F7 FS P.C. with Russell Stanger· FS F9 P.C. with Robert Shaw F9 FIO P.C. with Ned Rorem Fl0 F11 P.C. with Gerald Moore Fl I F12 P.C. with Andre Kostelanetz (Promenade Concerts) F12 F13 P.C. with Carlylse Floyd F13 F14 P.C. with Family (photo of Cooke photographing Phyllis) FI4 FIS P.C. with Ryan Edwards (Pianist) FIS F16 P.C. with Aaron Copland (televised from P.C. 's home - Dickinson Songs) F16 F17 P.C. with Leonard Bernstein Fl 7 F18 Concert rehearsals Fl8 FIS - Gunther Schuller Fl 8 FIS -Leontyne Price in Vienna FIS F18 -others F18 F19 P.C. with hairdresser Nina Lawson (good backstage photo) FI9 F20 P.C. with Darius Milhaud F20 F21 P.C. with Composers & Conductors F21 F21 -Eugene Ormandy F21 F21 -Benjamin Britten - Premiere War Requiem F2I F22 P.C. at White House (Fords) F22 F23 P.C. teaching (Yale) F23 F25 P.C. in Tel Aviv and U.N. F25 F26 P. C. teaching (Tanglewood) F26 F27 P. C. in Sydney, Australia - Construction of Opera House F27 F2S P.C. in Ipswich in Rehearsal (Castle Hill?) F2S F28 -P.C. in Hamburg (large photo) F2S F30 P.C. in Hamburg (Strauss I00th anniversary) F30 F31 P. C. in Munich - German TV F31 F32 P.C.