Bachelorarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz 1992-2017
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz 1992-2017 Ein Film von Andreas Deinert, Moritz Denis, Matthias Ehlert, Wolfgang Gaube, Rosa Grünberg, Eike Hosenfeld, Michael Kaczmarek, Thomas Kleinwächter, Lutz Pehnert Caroline Peters, Susann Schimk, Johannes Schneeweiß, Jens Stubenrauch, Christoph Sturm, Jörg Theil, Mieke Ulfig, Adama Ulrich Mit Kathrin Angerer, Henry Hübchen, Susanne Düllmann, Karin Ugowski, Katrin Knappe, Alexander Scheer, Martin Wuttke, Frank Castorf, Herbert Fritsch, Sophie Rois, Marc Hosemann Lilith Stangenberg, Wolfram Koch, Elisabeth Zumpe, Ingo Günther, Herbert Sand, Wilfried Ortmann, Walfriede Schmitt, Heide Kipp, Annett Kruschke, Ulrich Voß, Harald Warmbrunn Winfried Wagner, Magne Hovard Brekke, Jon-Kaare Koppe, Peter-René Lüdicke, Bruno Cathomas, Kurt Naumann, Gerd Preusche, Torsten Ranft, Joachim Tomaschewsky, Jürgen Rothert Klaus Mertens, Bodo Krämer, Sabine Svoboda, Harry Merkel, Christiane Schober, Claudia Michelsen, Meral Yüzgülec, Astrid Meyerfeldt, Annekathrin Bürger, Dietmar Huhn, Hans-Uwe Bauer Andreas Speichert, Frank Meißner, Susanne Strätz, Robert Hunger-Bühler, Lajos Talamonti, Steve Binetti, Christoph Schlingensief, Wilfried Rott, Adriana Almeida, Walter Bickmann Christian Camus, Jean Chaize, Amy Coleman, Christina Comtesse, Beatrice Cordua, Ana Veronica Coutinho, Brigitte Cuvelier, Gernot Frischling, Andrea Hovenbitzer, Susana Ibañez Martin Kasper, Kristine Keil, Monica Kodato, Martin Lämmerhirt, Ireneu Marcovecchio, Mauricio Oliveira, Mauricio Ribeiro, Liliana Saldaña, Aliksey Schoettle, Christian Schwaan -

Welle Der Nichtschwimmer? UND AUF ALDI-NORD.DE Vom 24.07
Nimm das Glück mit in den Sommer 1 Zufallstipp 3 Zufallstipp 5 Zufallstipp 7 Zufallstipp 9 Zufallstipp 11 Zufallstipp Spielteilnahme ab 18 Jahren. Bitte beachten Sie umseitige Hinweise zu 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 den 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 Te ilnahmebedingungen und zur Spielsuc 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 43 44 45 46 47 48 49 2 Zufallstipp 4 Zufallstipp 6 Zufallstipp 8 Zufallstipp 10 Zufallstipp 12 Zufallstipp 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 htprävention. -

Quarterly 2 · 2006
German Films Quarterly 2 · 2006 AT CANNES Directors' Fortnight SOMMER '04 AN DER SCHLEI by Stefan Krohmer Critics' Week PINGPONG by Matthias Luthardt Cinéfondation MR. SCHWARTZ, MR. HAZEN & MR. HORLOCKER by Stefan Mueller PORTRAITS Bernd Neumann, Valeska Grisebach, Philip Groening, Nadja Uhl, Razor Film, Atrix Film, The Match Factory SPECIAL REPORT Location Germany German Films and Co-Productions IN THE OFFICIAL PROGRAM In Competition In Competition In Competition Lights in the Dusk Summer Palace The Wind that by Aki Kaurismaeki by Lou Ye Shakes the Barley by Ken Loach German Co-Producer: Pandora Film/Cologne German Co-Producer: Flying Moon Film/Potsdam German Co-Producer: EMC Produktion/Berlin World Sales: The Match Factory/Cologne World Sales: Wild Bunch/Paris World Sales: Pathé Pictures International/London Un Certain Regard Un Certain Regard Un Certain Regard Paris, je t’aime: To Get to You Am I Place des Fetes Heaven First by Kristijonas Vidlziunas by Oliver Schmitz & You Have to Die True by Tom Tykwer by Djamshed Usmonov World Sales: German Co-Producer: Pandora Film/Cologne German Co-Producer: Pandora Film/Cologne Victoires International/Paris World Sales: Celluloid Dreams/Paris World Sales: Studio Uljana Kim/Vilnius Directors’ Fortnight Directors’ Fortnight Directors’ Fortnight Sommer ’04 an Day Night Day Princess der Schlei Summer ’04 Night by Anders Morgenthaler by Stefan Krohmer by Julia Loktev Producer: Oe Film/Berlin German Co-Producer: ZDF/Mainz German Co-Producer: Shotgun Pictures/Stuttgart World Sales: Bavaria Film International/Geiselgasteig -
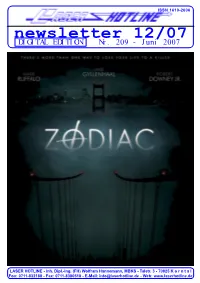
Newsletter 12/07 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 12/07 DIGITAL EDITION Nr. 209 - Juni 2007 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 3 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 12/07 (Nr. 209) Juni 2007 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, dass letztendlich maximal ein Format Aus-Zeit liebe Filmfreunde! überleben wird. Ob es dann eines der Je näher der Juli kommt, umso näher Als wir die beiden vorausgegangenen jetzt verfügbaren sein wird oder gar rücken auch wieder die beiden Som- Ausgaben unseres Newsletters ohne ein ganz anderes, das steht in den Ster- mer-Filmfestivals, auf die wir uns im- das dazugehörige traditionelle Editori- nen. Grund zur Panik besteht keines- mer wieder freuen: das Bollywood- al verschickt haben, waren wir eigent- falls. Vergleicht man die Verkaufszah- Filmfestival (Stuttgart, 11.07.- lich frohen Mutes, dass das niemand len von Standard-DVDs und hochauf- 15.07.2007) und das Fantasy Filmfest bemerken würde und somit kein lösenden DVDs, so wird schnell klar, (Stuttgart, 25.07.-01.08.2007). Was schlechtes Gewissen haben müssen. dass der Standard-DVD noch viele das Fantasy Filmfest angeht, so wurden Dass das offensichtlich ein großer Irr- glückliche Jahre bevorstehen. hierzu bereits die ersten Details be- tum war, durften wir in den vergange- kanntgegeben. Eröffnungsfilm ist nen vier Wochen anhand vieler Gesprä- 5 x 300 BLACK SHEEP aus Neuseeland, der che erfahren, die wir am Telefon oder Fans harter Actionkost sollten sich den das Genre des Tierhorrorfilms zu neu- auch im Ladenlokal mit Kunden ge- 10. -

Sozialistische Filmkunst Eine Dokumentation Sozialistische Filmkunst
Klaus-Detlef Haas, Dieter Wolf (Hrsg.) Sozialistische Filmkunst Eine Dokumentation Sozialistische Filmkunst 90 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 1 Rosa-Luxemburg-Stiftung Manuskripte 90 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 2 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 3 Rosa-Luxemburg-Stiftung KLAUS-DETLEF HAAS, DIETER WOLF (HRSG.) Sozialistische Filmkunst Eine Dokumentation Karl Dietz Verlag Berlin MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 4 Rosa-Luxemburg-Stiftung, Reihe: Manuskripte, 90 ISBN 978-3-320-02257-0 Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2011 Satz: Elke Jakubowski Druck und Verarbeitung: Mediaservice GmbH Druck und Kommunikation Printed in Germany MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 5 Inhalt Vorwort 11 2005 | Jahresprogramm 13 Günter Reisch: Erinnern an Konrad Wolf an seinem 80. Geburtstag 15 Mama, ich lebe Einführung | Programmzettel 17 Sterne Einführung | Programmzettel 22 Busch singt Teil 3. 1935 oder Das Faß der Pandora Teil 5. Ein Toter auf Urlaub Programmzettel 27 Solo Sunny Programmzettel 29 Der nackte Mann auf dem Sportplatz Programmzettel 30 Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis Einführung | Programmzettel 32 Ich war neunzehn Programmzettel 38 Professor Mamlock Programmzettel 40 Der geteilte Himmel Einführung | Programmzettel 42 Addio, piccola mio Programmzettel 47 Leute mit Flügeln Programmzettel 49 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 6 2006 | Jahresprogramm 51 Sonnensucher Programmzettel 53 Lissy Programmzettel 55 Genesung Programmzettel 57 Einmal ist keinmal Programmzettel 59 Die Zeit die bleibt Programmzettel -

AO2018 Revue-De-Presse.Pdf
Ateliers Ouverts 2018 Revue de Presse 1 Alsace Nord ...... p. 5 - « Portes ouvertes à l’atelier d’artiste » (DNA - Saverne 17.05.18) - Petit tour au « Jardingue », (DNA Haguenau / Lu 28 mai 2018) - « Ateliers ouverts chez Didier Clad » En bref (DNA - Haguenau / Je. 24 Mai 2018) - Deux nouveaux ateliers (DNA - Molsheim - Schirmeck / Lu. 21 Mai 2018) - « Les artistes sont sur le pont » (DNA Sarre-Union 17.05.18) - « Confluence artistique en bord de Sarre » (DNA Saverne 17.05.18) - « Wilwisheim Portes ouvertes à l’atelier d’artiste » (DNA Saverne 18 15.05.18) - Saravi déborde, les artistes créent (DNA - Sarre-Union / Me. 23 Mai 2018) - Peindre aux Récollets (DNA - Bas-Rhin / Je. 3 Mai 2018) - Partage artistique (DNA - Saverne / Lu. 21 Mai 2018) - La pierre dans le sang (DNA - Saverne / Lu. 21 Mai 2018) Strasbourg ...... p. 15 - L’Atelier nord reprend la pose (L’alsace - Divers / Ve. 25 Mai 2018) - Parcours de santé avec artistes (DNA - Strasbourg / Di. 20 Mai 2018) - Bienvenue chez les artistes (DNA - Strasbourg / Ve. 18 Mai 2018) - « Les expos du cloître » (DNA Strasbourg 24.04.18) - « Deux ans pour créer » (DNA Strasbourg campagne 13.05.18) - Kermesse et découvertes avec les artistes du parc Gruber (DNA - Strasbourg / Sa. 19 Mai 2018) - Visions du monde (DNA - Strasbourg Nord / Sa. 26 Mai 2018) - « Deux week-end d’ouverture à l’Atelier perché » (DNA - Strasbourg / Lu. 28 Mai 2018) - « Des images et des mots » à l’Atelier nord » (L’alsace - Divers 18.05.18) - Ce week-end, à la rencontre de Caroline Riegel (L’alsace - Divers / Je. 24 Mai 2018) - En bref (DNA - Strasbourg Nord / Sa. -

Mail : [email protected]
TOUTES BOISSONS TRANSPORTS NATIONAUX REINHEIMER et Fils VINS ET SPIRITUEUX ET INTERNATIONAUX S.A R.L. au capital de 15 240 e Lundi : 14h00-18h30 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Mardi au vendredi : 9h00-12h00 14h00-18h30 22 rue de la Gare ...Toute une équipe à votre service... Samedi : 8h30-12h00 14h00-18h00 68140 LUTTENBACH près Munster 28a Route de la Schlucht - 68140 STOSSWIHR • Vente au détail • Organisation d’événements Tél. 03 89 77 32 67 - Fax 03 89 77 06 26 Tél. 03 89 77 33 07 - Fax 03 89 77 06 31 • Grand choix en vins fins • Coffrets cadeaux E-mail : [email protected] 250 places Son dolby stéréo / 2D et 3D Parking gratuit devant le cinéma Classé art et essai / Label jeune public Info programme GRAND PUBLIC www.allocine.fr (Munster) 1 Place de la Tuilerie - 68140 Munster Mél : [email protected] Rejoignez-nous sur Facebook (cinéma de Munster) SAINT GREGOIRE ESPACE CULTUREL E MUNSTER ART ET ESSAI CINEMA D NOS TARIFS : (sous réserve) Tarif plein : 6,00 e Tarif réduit jeunes -14 ans : 4,00 e e PROCHAINEMENT Tarif réduit : 3,50 PITE/PEREZ/ (avec la carte de membre) SHECHTERT Tarif réduit : 4,00 e (carnet à 5 entrées) The art of not Diffusion Tarif cinéma-opéra : 14 e (tarif plein) looking back des FILMS e 11 (tarif réduit) CINEMA-BALLET de l’opption Carnet à 5 entrées : 55 e ”CINEMA” Lunettes 3D à la location : 1 e du lycée de Munster Carte de membre (fidélité) : • 8 e pour l’année civile (adultes) • 4 e pour scolaires, étudiants, handicapés, chômeurs et membres de CE Confiserie à la caisse Film diffusé 15 mn après le début de la séance JEUNE PUBLIC FÊTE DU CINÉMA À MUNSTER PROGRAMME FÊTE DU CINÉMA À MUNSTER BECASSINE ! Samedi 30 juin, dimanche 1 juillet et mercredi 4 juillet MAI Samedi 30 juin, dimanche 1 juillet et mercredi 4 juillet 2018 CREATION Nuss-Dietrich sàrl 12 Rue Principale IMPRESSION 68920 LA FORGE / WINTZENHEIM Matériaux de construction et d’aménagement Tél. -

Newsletter 07/16 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 07/16 DIGITAL EDITION Nr. 359 - September 2016 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 11 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 07/16 (Nr. 359) September 2016 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, dazu gekommen sind, einen Newsletter len: Axel Ranisch, Tom Lass, Heiko liebe Filmfreunde! zu produzieren. Dafür eben jetzt in ge- Pinkowski und Ruth Bickelhaupt, die ballter Form. Auch nicht schlecht, immerhin schon 94 Jahre jung ist! Viele Kennen Sie Lou Andreas-Salomé? oder? weitere Videos sind bereits in Vorberei- Schauspielerin Katharina Lorenz, die tung. Also: bleiben Sie dran! Sie auf dem Titelbild unseres Das eingangs erwähnte Video zur LOU Newsletters sehen, spielt diese hoch ANDREAS SALOMÉ Premiere ist übri- In Stuttgart steht jetzt wieder das interessante Psychoanalytikerin im gens nicht das einzige, das wir zwi- Fantasy Filmfest vor der Tür. Für uns gleichnamigen Film, der in Stuttgart schenzeitlich in unseren YouTube-Ka- höchste Zeit, eine Zeitlang den Büro- seine Premiere feierte. Wir haben natür- nal geladen haben. So finden Sie dort stuhl gegen den Kinosessel einzutau- lich wie immer die Gelegenheit genutzt, auch Videos zu den Stuttgarter Premie- schen. Deshalb bleibt unser Büro in Interviews zu führen und das ganze ren von FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR der Zeit vom 01. September bis ein- Spektakel in einem kleinen Featurette HENRI (mit Regisseur Ivan Calberac) schließlich 18. September geschlossen. für unseren YouTube-Kanal festzuhal- und TONI ERDMANN (mit Regisseurin Wir bitten um Verständnis. -

Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz 1992-2017
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz 1992-2017 Ein Film von Andreas Deinert, Moritz Denis, Matthias Ehlert, Wolfgang Gaube, Rosa Grünberg, Eike Hosenfeld, Michael Kaczmarek, Thomas Kleinwächter, Lutz Pehnert Caroline Peters, Susann Schimk, Johannes Schneeweiß, Jens Stubenrauch, Christoph Sturm, Jörg Theil, Mieke Ulfig, Adama Ulrich Mit Kathrin Angerer, Henry Hübchen, Susanne Düllmann, Karin Ugowski, Katrin Knappe, Alexander Scheer, Martin Wuttke, Frank Castorf, Herbert Fritsch, Sophie Rois, Marc Hosemann Lilith Stangenberg, Wolfram Koch, Elisabeth Zumpe, Ingo Günther, Herbert Sand, Wilfried Ortmann, Walfriede Schmitt, Heide Kipp, Annett Kruschke, Ulrich Voß, Harald Warmbrunn Winfried Wagner, Magne Hovard Brekke, Jon-Kaare Koppe, Peter-René Lüdicke, Bruno Cathomas, Kurt Naumann, Gerd Preusche, Torsten Ranft, Joachim Tomaschewsky, Jürgen Rothert Klaus Mertens, Bodo Krämer, Sabine Svoboda, Harry Merkel, Christiane Schober, Claudia Michelsen, Meral Yüzgülec, Astrid Meyerfeldt, Annekathrin Bürger, Dietmar Huhn, Hans-Uwe Bauer Andreas Speichert, Frank Meißner, Susanne Strätz, Robert Hunger-Bühler, Lajos Talamonti, Steve Binetti, Christoph Schlingensief, Wilfried Rott, Adriana Almeida, Walter Bickmann Christian Camus, Jean Chaize, Amy Coleman, Christina Comtesse, Beatrice Cordua, Ana Veronica Coutinho, Brigitte Cuvelier, Gernot Frischling, Andrea Hovenbitzer, Susana Ibañez Martin Kasper, Kristine Keil, Monica Kodato, Martin Lämmerhirt, Ireneu Marcovecchio, Mauricio Oliveira, Mauricio Ribeiro, Liliana Saldaña, Aliksey Schoettle, Christian Schwaan -

Dissertation
DISSERTATION „Das „Choreographische Theater“ von Johann Kresnik als „Theater der Szenographie“ verfasst von Mag. phil. Genia Enzelberger angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2015 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 317 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreut von: ao. Univ.-Prof. Dr. Monika Meister Danksagungen Monika Meister, für ihre langjährige bereichernde und großzügige wissenschaftliche Betreuung. Stefan Hulfeld, für seine wertvolle Unterstützung. Hans Kresnik, für viele Gespräche und für die Zurverfügungstellung seines privaten Archives. Mein herzlicher Dank für die Unterstützung bei der Recherche gilt: Elke Becker, Sybille Dahrendorf, Tomke Doren, Gabriele Gornowich, Christoph Klimke, Helga Kristan, Herta Ulbricht. Ein herzliches Dankeschön auch meinen Lektorinnen: Angela Heide, Christina Kaindl- Hönig, Jana Kaunitz, Gabriele Pfeiffer, Regula Schröter. Gewidmet meiner Schulfreundin Irene Vejvancicky, der ein Hochschulstudium verwehrt wurde. 1. Einleitung 2 1.1. Johann Kresnik ‒ ein persönlicher Zugang 2 1.2. Zum Materialbestand 8 1.3. Zum Forschungsstand 9 1.4. Aufbau und Kapitel der Dissertation 10 1.5. Methode und Ziel der Forschungsarbeit 14 2. Tanzhistorischer Überblick 21 2.1. Zur Entwicklung des Ausdruckstanzes im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 22 2.2. Der Tanz in Deutschland in den 1950er- und 1960er-Jahren 26 2.3. Die Entwicklung des „Tanztheaters“ in den 1970er-Jahren 28 3. Zur historischen Situation in Kärnten zwischen 1938 und 1945 35 4. Biographie eines Biographen 42 4.1. Kindheit und Lehrjahre eines Bauernsohnes 42 4.2. Vom Solotänzer zum Choreographen 52 4.3. „Ballett kann kämpfen“ – Kresniks politisches Theater 62 4.4. Der Körper als Kampfplatz – Kresniks „Stil“ 67 4.5. Wechselwirkungen zwischen Choreographischem Theater und Sprechtheater 77 4.6. -

Wintersemester 2018/2019 Liebes Publikum, Die Dunkle Jahreszeit Steht Vor Der Tür
Wintersemester 2018/2019 Liebes Publikum, die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür. Es ist die Hochsaison der Filmfestivals : Mit gleich drei Festivals kooperieren wir diesen Herbst. Die Jüdische Gemeinde Frankfurt organisiert alle zwei Jahre ein Festival, an dem diverse Kinos der Stadt partizipieren. Die Pupille zeigt im Rahmen der Jüdischen Filmtage Ende Oktober den Film Foxtrot. Im November findet dann die erste Ausgabe der Frankfurter Frauen Film Tage Re- make statt. Ab dem 7. November sind täglich Filme im Studierendenhaus zu sehen. Das genaue Programm stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest, wird aber noch bekanntgegeben. Danach übernimmt das Wiesbadener Independent Filmfestival exground. Wie schon in den vorherigen Jahren spielen wir zwei Filme des Länderschwerpunkts, der sich dieses Mal mit den Philippinen befasst, in Frankfurt nach und zwar den Eröff- nungsfilm Neomanila sowie The Journey of Stars into the Dark Night. An dieser Stelle sei dabei auch auf den Dokumentarfilm The Cleaners verwiesen, der sich mit der dunklen Seite der Social Media befasst, die ihre Drecksarbeit in Ländern mit nied- rigen Löhnen und wenigen Regeln – wie eben den Philippinen – erledigen lassen. Gemeinsam mit dem Fritz Bauer Institut zeigen wir drei Filme zum Tag des Geden- kens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar). Zu jeder Vorstellung werden die jeweiligen Filmemacher anwesend sein. Dies sind nicht die einzigen Gäste. Zur Werkschau Ted Fendt kommt beispielswei- se eben jener angereist, um seine Filme persönlich in der Pupille vorzustellen. Wir zeigen seine kurzen bis mittellange Filmen am 5. Dezember. Unser Eröffnungsfilm The Florida Project gehört zu einer zweiteiligen Reihe des Independent-Regisseurs Sean Baker, der in seinen bisher zwei Langfilmen den von ihm portraitierten Figuren ein Höchstmaß an Authentizität verleiht. -

History of the Film by Thomas Elsaesser Y 1970 R a R B I L
‘Rescued in Vain’ Parapraxis and Deferred Action in Konrad Wolf’s Stars History of the Film By Thomas Elsaesser y 1970 r a r b i L Feb. 26 m l i F The DEFA Studio for Feature Films concludes a contract with director Iris Gusner for the development of a A F E D concept for a film with the working title Daniel . Gusner’s honorarium is 2,400 East German marks. e h t y b May 29 e s a e The “Babelsberg” production group takes on the treatment for Daniel . l e R D V June 29 D A The DEFA Studio for Feature Films signs a contract with Gusner about the development of a scenario for f o o R Daniel . e h t n o July 16 e v o D On behalf of the film studio, Prof. Dr. Staufenbiel, a cultural sociologist from the Academy for Social Science e h T at the Central Committee of the SED [Socialist Unity Party], takes on the role of expert consultant for the film • m l “in view of cultural-theoretical and culture-prognostic questions, of problems facing the developing socialist i F e collective in East Germany, and of the collaboration of a collective of student-and-farmer in the present.” h t f o y r o Dec. 8 t s i Gusner delivers the first version of the scenario for Daniel to Dieter Wolf, the dramaturg responsible for the film. H 1971 Apr. 1 Günter Schröder, the artistic director of the studio, accepts the first version of the scenario.