Europawanderung 2020 1. Etappe: Auf Dem Hans
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Burg Berwartstein Bei Erlenbach Bärbelstein, Bärwelstein
Burg Berwartstein bei Erlenbach Bärbelstein, Bärwelstein Schlagwörter: Burg, Aussichtspunkt Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege Gemeinde(n): Erlenbach bei Dahn Kreis(e): Südwestpfalz Bundesland: Rheinland-Pfalz Burg Berwartstein im Winter (2012) Fotograf/Urheber: Harald Kröher Die im 13. Jahrhundert erbaute Burg Berwartstein ist eine der beliebtesten und meistbesuchten Burgen der Westpfalz und befindet sich in der Gemeinde Erlenbach im Landkreis Südwestpfalz. Die Burg liegt auf einem 280 Meter hohen Felsklotz in Gipfellage östlich des Dorfes Erlenbach. Angelegt wurde die Burg zur Überwachung der Straße zwischen Fleckenstein und der Reichsburg Trifels, aber auch als Konkurrenz zu den Gegnern auf der Burg Dahn. Geschichte Die Burg Berwartstein wurde wahrscheinlich zwischen 1125 und 1133 durch Friedrich den Einäugigen von Hohenstaufen in der Funktion des Schirmvogts der Abtei Weißenburg als Reichsburg gebaut. Erstmals urkundlich erwähnt wird Burg Berwartstein 1152, als Friedrich Barbarossa die Burg dem damaligen Bischof Günther von Speyer, der auch Abt der Weißenburg war, „für immer übergeben“ hatte (Schultz 2008, S. 9). In den Jahren zwischen 1152 und 1201 bleibt das Hochstift Speyer Eigentümer der Burg. Im 13. und im frühen 14. Jahrhundert ist die Burg Berwartstein Sitz des Rittergeschlechts von Berwartstein (Ministerialenfamilie im Hochstift Speyer). Im Thronfolgestreit zwischen Ludwig dem Bayern und Friedrich von Habsburg, stehen die Ritter von Berwartstein mit den Herren von Fleckenstein auf der Seite der Habsburger. Der Streit endet 1314 in einer fünfwöchigen Belagerung der Burg Berwartstein durch die Reichsstädte Straßburg und Hagenau, die sich in einem Bündnis gegen Eberhard von Berwartstein, Hugo von Fleckenstein und Nikolaus von Lützelstein zusammenschlossen. Eventuell wurden Bürger jener Städte von den Rittern beraubt oder gegen Lösegelder gefangen gehalten. -

Klein-Frankreich Und Berwartstein
Klein-Frankreich und Berwartstein Kurze Tour im Reich des Hans Trapp Diese kurze Tour ist den Besuchern der Burg Berwartstein gewidmet, die sich zusätzlich noch ein bisschen die Beine vertreten möchten. Nach einem steilen, aber kurzen Anstieg bietet sich die Umrundung des Nestelberges mit Aussichtspunkt nach Süden und Burg Klein-Frankreich optimal dafür an. Denn vom Talblick Niederschlettenbach reicht die Aussicht zu den Burgen Hohenbourg und Wegelnburg. Die zweite Aussicht der Tour befindet sich bei der Burg Klein-Frankreich, die wohl die schönste Sicht auf die Burg Berwartstein bietet. Zum Schluss steht die Besichtigung der Burg Berwartstein an, in der auch eingekehrt werden kann. Wer eine noch kürzere Tour gehen möchte, lässt die Umrundung des Nestelberges einfach weg. Praktische Informationen Interaktive Tourenkarte: http://umap.openstreetmap.fr/de/map/klein-frankreich-und- berwartstein_205764#15/49.1052/7.8630 Wanderkarte: Dahner Felsenland Startpunkt: Parkplatz unterhalb der Burg Berwartstein. Beschilderung ab Erlenbach bei Dahn. Koordinaten (Dezimalgrad - WGS 84): 49.107371° / 7.864220° oder mit Google Maps herkommen: https://goo.gl/maps/5VH593eLqRH2 Öffentliche Verkehrsmittel: Bus von Bad Bergzabern oder Dahn nach Erlenbach bei Dahn auf der Strecke Bad Bergzabern - Dahn (Linie 545) (VRN). https://www.vrn.de/ Hinweis: An Samstagen wird Erlenbach bei Dahn von der Buslinie 525 (Bad Bergzabern - Vorderweidenthal - Annweiler am Trifels) bedient. Kein Verkehr an Sonn- und Feiertagen von November bis April. An Sonn- und Feiertagen von Mai bis Oktober wird zusätzlich die Haltestelle Erlenbach bei Dahn (Burg Berwartstein) angefahren. Von Erlenbach bei Dahn (ca. 0,8 km): Wir folgen der Binsenhohlstraße nach Südosten und der Markierung Felsenland Sagenweg (Geist auf blauem Hintergrund) bis zur Burg Berwartstein. -

Aktionsgemeinschaft Bobenthal - St
Citizens for Europe Aktionsgemeinschaft Bobenthal - St. Germanshof e.V. Table of contents The Western Palatinate has been a border area for many centuries. Introduction Topics I. History of the border region St. Germanshof II. Student demonstration in 1950 III. New capital for Europa Aktionsgemeinschaft Bobenthal - St. Germanshof e.V. I 2019 3 Englisch Foreword The fact that the Palatinate is generally considered and French, found an impressively courageous way English the home of the early German nation-building and to formulate their visionary idea of peaceful Euro- democratic movement is particularly evident from pean unification-without shedding a drop of blood. the Hambach Festival in 1832 and the March Revo- Anglaise lution in 1848. Far less well known, however, is the Today, more than seventy years later, the demands storm of students on August 6th, 1950 at St. Ger- of the past have long since been overtaken by rea- manshof – less than 50 kilometers from Hambach lity and yet Europe no longer seems to be able to Castle-which represents a significant date for the get out of its crisis mode and is finding it difficult to European movement and is in no way inferior in its define its own role. The action group Bobenthal-St. symbolic power to the events mentioned above. Germanshof has set itself the goal of conveying the spirit of the storm of students to the European youth Shaped by the bitter experiences from the wars bet- and thereby re-inspiring the European movement. ween Germany and France, but also by the econo- There is hardly a place that can better explain the mic disadvantage due to its peripheral location, the need to overcome national differences than St. -

Annales Scientifiques 2017-2018
2017 2018 2017 2018 SOMMAIRE TOME / BAND 19 – 2017-2018 • Max BRUCIAMACCHIE & Valentin DEMETS - Audit du réseau actuel d’îlots de sénescence. Propositions d’évolution .......................................... 16-40 • Alban CAIRAULT - Observatoire de la qualité des rivières des Vosges du Nord. Bilan 2015 – 2016 ................................................................ 42-53 • Ludovic FUCHS & Philippe MILLARAKIS - Premier échantillonnage des coléoptères saproxyliques de la réserve biologique intégrale transfrontalière de Lutzelhardt-Adelsberg ........................................................... 54-88 • Lina HORN & Nicole AESCHBACH - Nachaltiger Tourismus im Deutschen Teil des Biosphärenreservats Pfälerwald-Nordvogesen. Entwicklung eines Indikatorenkatalog ............................................................. 90-104 • Philippe JEHIN - L’abondance du grand gibier dans les Vosges du Nord durant l’entre-deux-guerres ........................................................... 106-114 • Christoph LINNENWEBER, Holger SCHINDLER & Mathias RETTERMAYER Gewässerentwicklungskonzept im Biosphärenreservat Pfälzerwald- Nordvogesen .................................................................. 116-131 Wissenschaftliches Jahrbuch • Guido PFALZER, Hélène CHAUVIN, Dorothee JOUAN, Hans KÖNIG, Waltraud KÖNIG, Ludwig SEILER, Claudia WEBER & Heinz WISSING - Das grenzüberschreitende Biosphärenreservat‚ Pfälzerwald - Vosges du Nord als essenzielles Überwinterungshabitat der Wimperfledermaus (Myotis emarginatus GEOFFREY, 1806) ......................................................... -

Upper Rhine Bike Path
Upper Rhine Bike Path www.bike-valley.eu Germersheim Germersheim Landau in Landau in der Pfalz der Pfalz Eschbach Eschbach Rhein / Rhin / Rhine Rhein / Rhin / Rhine Bad Bergzabern ~ Bad Bergzabern Schweigen-Rechtenbach Wörth am Rhein ~ Wissembourg Germersheim Germersheim Karlsruhe Landau in Cleebourg Landau in Schweigen-Rechtenbach Wörth am Rhein Germersheim Hotels in the Upper Rhine Valley der Pfalz Landau in der Pfalz Wissembourg Lauterbourg der Pfalz Circuit Tour A Circuit Tour B Circuit Tour C Eschbach Circuit Tour D Hotel Pfälzer Wald Hôtel-Restaurant Kleiber Eschbach Karlsruhe Eschbach Kurtalstraße 77 37, Grand-Rue Rhein / Rhin / Rhine Cleebourg D-76887 Bad Bergzabern F-67700 Saint-Jean Saverne Wine and Rhine From the German Wine Gate to the Rhine Valley Czars and Emperors Along old railroad tracks through the Lauter Valley Romanesque Architecture and Wine Through Baden Wine Country to the North Vosges Medieval Gems Between Mount St. Odile and the heart of theRhein / Rhin / Rhine Black Forest +49(0)6343 989190 +33(0)388 911182 Bad Bergzabern Rhein / Rhin / Rhine www.hotel-pfaelzer-wald.de www.kleiber-fr.com ~ Lauterbourg THE CITY OF LANDAU, characte- river bank through the primeval following the path to the German ROUTE INFOS THE OLD RAILROAD TRACKS ferry ride allows bikers to cross the re they can once again use a ferry ROUTE INFOS THE FAVORITE TOWN of Em- Rhine Valley goes farther east un- ware: here, the temptation to stop ROUTE INFOS OFFENBURG is start and end ching Kappel-Grafenhausen, bikers majestic townBad of Bergzabern Obernai. Once in ROUTE INFOS Schweigen-Rechtenbach ~ Weingut & Landhaus Wilker Hôtel Couvent du Fransiscain to cross the river to Drusenheim. -
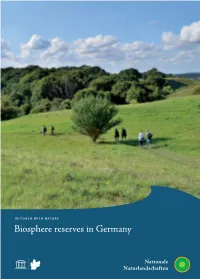
Biosphere Reserves in Germany 1 4
IN TOUCH WITH NATURE Biosphere reserves in Germany 1 4 2 3 5 6a 6c 6b 6d 7 8 9 6e 10 11 13 12 15 14 16 17 18 1 6a 7 11 15 2 6b 8 12 16 3 6c 9 13 17 4 6d 10 14 18 5 6e 1 4 2 3 5 6a 6c 6b 6d 7 8 Foreword 9 6e Seals, dippers, Rhön sheep, orchids, salt marshes UNESCO biosphere reserves must develop in line and more: the German biosphere reserves are char- with the 17 sustainability goals of Agenda 2030. acterized by a great diversity of habitats with a var- The Federal Government supports this by sup- 10 11 ied range of animal and plant species. With their porting protection and development measures, for ancient beech forests, clear lakes, rugged karst land- example in the context of large nature conservation scapes, and craggy peaks, they are representative of projects or research projects. unique natural and cultural landscapes. Their ob- Biosphere reserves also contribute to regional jective is to promote sustainable development in all value creation through sustainable tourism and areas of life and economy, where people and nature creating jobs in structurally weak rural regions. are in harmony. As such, they are internationally They offer space for leisure, recreation, and to 13 12 representative model regions. experience nature – be it on foot, by bike, or on In Germany, these fascinating landscapes and the water. In this way they inspire us about nature valuable ecosystems extend from the Wadden Sea and landscape, make us aware of the need to use to the Alps, from Neuwerk Island to Berchtes- them carefully, and invite us to help design a future gadener Land. -
Including Hiking Huts!
Including hiking huts! 1 WELCOME IMPRINT Editor Südwestpfalz Touristik e.V. Unterer Sommerwaldweg 40-42 D-66953 Pirmasens Phone: 0049 6331 809126 www.suedwestpfalz-touristik.de Concept and design das Team Agentur für Marketing GmbH www.dasteam.de Print pva Landau www.pva.de Photos Archives of the municipalities of the South-West-Palatinate and the cities of Pirmasens and Zweibrücken, archive of the Südwestpfalz Touristik e.V., Heimatmuseum Thaleischweiler-Fröschen, tourist office of Lemberg, Andreas Faass, Kurt E. Groß, Thomas Haltner, Harald Hartusch, Manfred Kuntz, Harald Kröher, Ludwig Mayer, Hans-Joachim Noll, Christoph Riemeyer, Stephanie Ser, Sonja Spieß, Peter Zimmermann, Cover photo: Dominik Ketz All data without guarantee, Castle ruin Wegelnburg as of January 2019 2 DEAR GUESTS AND VISITORS OF THE SOUTH-WEST-PALATINATE In this brochure you can find our most beautiful destinations with the most important information. Furthermore you can find our list of hiking huts with opening times. If you want to learn more about the individual holiday regions of the South-West-Palatinate, don‘t hesitate to contact the regional tourist information centres or the Südwestpfalz-Touristik. Experience a fascinating holiday region. Your Südwestpfalz-Touristik 3 CONTENTS TOURIST ATTRACTIONS Welcome 2 - 3 Selection of Hiking Trails 5 Overview map 6 - 7 Castles, Mills and Historical Peculiarities 8 - 23 Rocks 24 - 43 Museums & Exhibitions 44 - 55 Activities & Leiasure time 56 - 67 Things to do 68 - 79 Swimming lakes & pools 80 - 85 Shopping 86 - 91 Hiking -

SOTA-DM German Low Mountain Range (DM)
Summits on the Air – DM, German Low Mountain Range Association Reference Manual Summits on the Air SOTA-DM German Low Mountain Range (DM) Association Reference Manual Document Reference S8.3 Issue number 4.3 Issue date 01 – June - 2011 Commencement date 01 - July - 2003 Authorised John Linford, G3WGV Date 15-July 2003 Association Manager Andreas Bilsing, DL2LUX [email protected] Management Team Matthias Schüler, DL1JMS [email protected] Uli Fromm, DL2LTO [email protected] Notice ‘Summits on the Air’, SOTA and the SOTA logo are trademarks of the Programme. This document is copyright of the Programme. The source data used the TOP50 CD-ROM [1:50.000] by digital maps of the German federal bureau of ordnance survey and data processing. All other trademarks and copyrights referenced herein are acknowledged. Version V4.3 01-June-2011 [14/10/10] create by DL2LTO Page 1 from 39 Summits on the Air – DM, German Low Mountain Range Association Reference Manual Table of Contents 1. CHANGE CONTROL 4 2. GERMAN ASSOCIATIONS ARRANGEMENTS 7 2.1 Programme Basics 8 2.2 Maps 8 2.3 Summit Reference data 9 2.3.1 Reference data of Association 9 3. SUMMIT REFERENCE DATA 10 3.1 Region Bavarian Low Mountain Range 10 3.1.1 Regional Notes 10 3.1.2 Regional Maps 10 3.1.3 Helpful Links 10 3.1.4 Table of Summits 11 3.2 Region Baden-Württemberg 14 3.2.1 Regional Notes 14 3.2.2 Regional Maps 14 3.2.3 Helpful Links 14 3.2.4 Table of Summits 15 3.3 Region Hessen 18 3.3.1 Regional Notes 18 3.3.2 Regional Maps 18 3.3.3 Helpful Links 18 3.3.4 Table of Summits 19 3.4 Region Lower-Saxony -

BURG HOHENECKEN from SOUTHWEST GERMANY Aaron C
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Anthropology Department Theses and Anthropology, Department of Dissertations Spring 4-25-2016 INTEGRATIVE 3D RECORDING METHODS OF HISTORIC ARCHITECTURE: BURG HOHENECKEN FROM SOUTHWEST GERMANY Aaron C. Pattee University of Nebraska - Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.unl.edu/anthrotheses Part of the Archaeological Anthropology Commons Pattee, Aaron C., "INTEGRATIVE 3D RECORDING METHODS OF HISTORIC ARCHITECTURE: BURG HOHENECKEN FROM SOUTHWEST GERMANY" (2016). Anthropology Department Theses and Dissertations. 43. http://digitalcommons.unl.edu/anthrotheses/43 This Article is brought to you for free and open access by the Anthropology, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Anthropology Department Theses and Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. INTEGRATIVE 3D RECORDING METHODS OF HISTORIC ARCHITECTURE: BURG HOHENECKEN FROM SOUTHWEST GERMANY By Aaron C. Pattee A THESIS Presented to the Faculty of The Graduate College at the University of Nebraska In Partial Fulfillment of Requirements For the Degree of Master of Arts Major: Anthropology Under the Supervision of Professor Effie Athanassopoulos Lincoln, Nebraska May, 2016 INTEGRATIVE 3D RECORDING METHODS OF HISTORIC ARICHTECTURE: BURG HOHENECKEN FROM SOUTHWEST GERMANY Aaron C. Pattee, M.A. University of Nebraska, 2016 Advisor: Effie Athanassopoulos This research explores the methodology and application of photogrammetric and laser-scanning recording methods to a castle ruin, with the primary purpose of digitally preserving the castle. Both methods generated interactive 3D models via the combination of still images (photogrammetry) and precise laser measurements (laser-scanning), which were then combined into a single model. -

Leisure Tips
Leisure Tips The Palatinate Dyn_2018-148x210-E_Layout 1 13.01.18 12:27 Seite 1 dynamikum.de The The Palatinate is a paradise for wine Palatinate lovers, hobby bikers, hikers and culture enthusiasts and it offers the ideal pre requisites for everyone who wants a holiday experiments in the outdoor areas being active, relaxing and enjoying. Known for its zest for life, this region with its Mediterranean climate and unique cultural landscape inspires its people to celebrate life and invites its visitors to wholehearted ly join in. Whether in the Biosphere Reserve Pfälzerwald, travelling the length of the German Wine Route, in the Rhine plain or in the North Palatine Uplands: this is where your holiday really begins! discover And this leisure activity guide will help you discover what‘s happening where explore – regardless of what cultural, sporting challenge or outdoor recreation you are Further information on organizing your leisure time in the Palatinate, hiking trails and cycling tracks, tour looking for. Arranged across the four participate guides and lots more can be found at: vacation regions of the Palatinate, this www.pfalz.de/en/leisure-fun leisure guide will show you the way to over 480 excursion tips for your vacation. There is something to be found for everyone in Pfalz.Touristik e.V. the Palatinate with its 150 museums, more MartinLutherStrasse 69 experience than 100 particularly sightseeingworthy 67433 Neustadt an der Weinstrasse Tel. +49 (0)6321 39160 · Fax +49 (0)6321 391619 castles, stately manors and churches, info@pfalztouristik.de understand ... 60 swimming pool parks and bathing www.pfalz.de/en · www.wandermenue-pfalz.de lakes, 9 golf courses and more than www.pfalz.de/facebook 150 attractions ranging from the „Zipline Sponsored by: Park“ in Elmstein to a Roman ship.