Tätigkeitsbericht 2015 – 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Influence of Concrete Strength on Crack Development in SFRC Members
Cement & Concrete Composites 45 (2014) 176–185 Contents lists available at ScienceDirect Cement & Concrete Composites journal homepage: www.elsevier.com/locate/cemconcomp Influence of concrete strength on crack development in SFRC members ⇑ Giuseppe Tiberti a, Fausto Minelli a, , Giovanni A. Plizzari a, Frank J. Vecchio b a DICATAM – Department of Civil Engineering, Architecture, Environment, Land Planning and Mathematics, University of Brescia, Italy b FACI, Department of Structural Engineering, University of Toronto, Canada article info abstract Article history: Tension stiffening is still a matter of discussion into the scientific community; the study of this phenom- Received 8 January 2013 enon is even more relevant in structural members where the total reinforcement consists of a proper Received in revised form 15 July 2013 combination of traditional rebars and steel fibers. In fact, fiber reinforced concrete is now a world- Accepted 4 October 2013 wide-used material characterized by an enhanced behavior at ultimate limit states as well as at service- Available online 11 October 2013 ability limit states, thanks to its ability in providing a better crack control. This paper aims at investigating tension stiffening by discussing pure-tension tests on reinforced con- Keywords: crete prisms having different sizes, reinforcement ratios, amount of steel fibers and concrete strength. Fiber reinforced concrete The latter two parameters are deeply studied in order to determine the influence of fibers on crack pat- Steel fiber Crack widths terns as well as the significant effect of the concrete strength; both parameters determine narrower Crack spacing cracks characterized by a smaller crack width. Tension stiffening Ó 2013 Elsevier Ltd. -

International Standard Iso 21809-5:2017(E)
INTERNATIONAL ISO STANDARD 21809-5 Second edition 2017-06 Petroleum and natural gas industries — External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems — Part 5: iTeh STExternalANDAR Dconcrete PREVI EcoatingsW Industries du pétrole et du gaz naturel — Revêtements externes (stdesan conduitesdard senterrées.iteh .oua iimmergées) utilisées dans les systèmes de transport par conduites — ISO 21809-5:2017 https://standards.iteh.Partieai/catalo g5:/s tRevêtementsandards/sist/1f4 0externes8f00-99ae en-4d béton56-aad0- 95a5c5a98be2/iso-21809-5-2017 Reference number ISO 21809-5:2017(E) © ISO 2017 ISO 21809-5:2017(E) iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai) ISO 21809-5:2017 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1f408f00-99ae-4d56-aad0- 95a5c5a98be2/iso-21809-5-2017 COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT © ISO 2017, Published in Switzerland All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form orthe by requester. any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of Ch. de Blandonnet 8 • CP 401 ISOCH-1214 copyright Vernier, office Geneva, Switzerland Tel. +41 22 749 01 11 Fax +41 22 749 09 47 www.iso.org [email protected] ii © ISO 2017 – All rights reserved ISO 21809-5:2017(E) Contents Page Foreword ..........................................................................................................................................................................................................................................v -

EPD Precast Concrete Wall
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930 PRECAST CONCRETE WALL OÜ TMB ELEMENT Environmental Product Declaration created with One Click LCA GENERAL INFORMATION EPD standards This EPD is in accordance with EN 15804+A2 and ISO 14025 standards. MANUFACTURER INFORMATION Product category CEN standard 15804+A2 serves as the core rules PCR, RTS PCR (Finnish version, 1.6.2020) Manufacturer OÜ TMB Element EPD author Anni Oviir, Rangi Maja OÜ, Address Betooni 7, 51014 Tartu, Estonia www.lcasupport.com [email protected] Contact details EPD verification Independent verification of this EPD and Website www.tmbelement.ee data, according to ISO 14025: Internal certification External verification PRODUCT IDENTIFICATION Verification date 25.09.2020 Product name Precast Concrete Wall EPD verifier Panu Pasanen, Bionova Oy, www.oneclicklca.com Additional CE, FI, BVB, BBC label(s) EPD number RTS_77_20 Place(s) of ECO Platform nr. - Estonia, Tartu production Publishing date 30.09.2020 Valid 25.09.2020-24.09.2025 EPD INFORMATION EPDs of construction products may not be comparable if they do not Laura Sariola comply with EN 15804 and if they are not compared in a building context. Committee secretary EPD program The Building Information Foundation RTS sr operator Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki, Finland http://cer.rts.fi Markku Hedman RTS General Director 2 PRECAST CONCRETE WALL PRODUCT INFORMATION TECHNICAL SPECIFICATIONS The studied product is an average of all variations. PRODUCT DESCRIPTION Thickness of the -

VII Naučni/Stručni Simpozij Sa Međunarodnim Učešćem
Thermodynamic calculation of phase equilibria of the Cu-Al-Mn alloys Holjevac Grgurić, Tamara; Manasijević, Dragan; Živković, Dragana; Balanović, Ljubiša; Kožuh, Stjepan; Pezer, Robert; Ivanić, Ivana; Anžel, Ivan; Kosec, Borut; Vrsalović, Ladislav; ... Source / Izvornik: Proceedings of 11th Scientific - Research Symposium with International Participation Metallic and Nonmetallic Materials, 2016, 83 - 90 Conference paper / Rad u zborniku Publication status / Verzija rada: Published version / Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:115:372137 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-10 Repository / Repozitorij: Repository of Faculty of Metallurgy University of Zagreb - Repository of Faculty of Metallurgy University of Zagreb Univerzitet u Zenici University of Zenica Bosnia and Herzegovina FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE FACULTY OF METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE ZBORNIK RADOVA elektronsko izdanje PROCEEDINGS electronic edition XI Naučno - stručni simpozijum sa međunarodnim učešćem 11th Scientific - Research Symposium with International Participation METALNI I NEMETALNI MATERIJALI proizvodnja – osobine – primjena METALLIC AND NONMETALLIC MATERIALS production – properties – application Zenica, 21 – 22. april 2016. UREDNIK/EDITOR Dr Ilhan Bušatlić IZDAVAČ/PUBLISHER Univerzitet u Zenici Organizaciona jedinica Fakultet za metalurgiju i materijale Travnička cesta 1, 72000 Zenica Tel: ++ 387 401 831, 402 832, Fax: ++ 387 406 903 KOMPJUTERSKA OBRADA -

Effects of Design and Construction on the Carbon Footprint of Reinforced Concrete Columns in Residential Buildings
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Vol. 69, Issue 335, July–September 2019, e193 ISSN-L: 0465-2746 https://doi.org/10.3989/mc.2019.09918 Effects of Design and Construction on the Carbon Footprint of Reinforced Concrete Columns in Residential Buildings E. Fraile-Garciaa*, J. Ferreiro-Cabelloa, F.J. Martínez de Pisonb, A.V. Pernia-Espinozab a. Department of Mechanical Engineering, Structures Construction and Development of Industrial Processes.SCoDIP Group, University of La Rioja (Spain) b. Department of Mechanical Engineering, Engineering Data Mining And Numerical Simulation. EDMANS Group, University of La Rioja (Spain) *[email protected] Received 25 September 2018 Accepted 31 January 2019 Available on line 10 June 2019 ABSTRACT: Constructing structural elements requires high performance materials. Important decisions about geometry and materials are made during the design and execution phases. This study analyzes and evaluates the relevant factors for reinforced concrete columns made in situ for residential buildings. This article identifies and highlights the most sensitive aspects in column design: geometry, type of cement, and concrete strength performance. Using C-40 concrete mixed with CEM-II proved to cut costs (up to 17.83%) and emissions (up to 13.59%). The ideal combination of rebar and concrete is between 1.47 and 1.73: this is the percentage of the ratio between the area of rebar and the area of the concrete section. The means used during the execution phase affect resource optimization. The location of a building has only a minor impact, wherein the wind zone exercises more influence than topographic altitude. KEYWORDS: Portland cement; Concrete; Metal reinforcement; Mechanical properties; Modelization Citation/Citar como: Fraile-Gracía, E.; Ferreiro-Cabello, J.; Martínez de Pisón, F.J.; Pernia-Espinoza, A.V. -
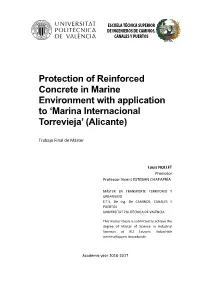
Protection of Reinforced Concrete in Marine Environment with Application to ‘Marina Internacional
Protection of Reinforced Concrete in Marine Environment with application to ‘Marina Internacional Torrevieja’ (Alicante) Trabajo Final de Máster Louis NOLLET Promotor Professor Vicent ESTEBAN CHAPAPRÍA MÁSTER EN TRANSPORTE TERRITORIO Y URBANISMO E.T.S. De Ing. De CAMINOS, CANALES Y PUERTOS UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA This master thesis is submitted to achieve the degree of Master of Science in Industrial Sciences at KU Leuven: Industriële wetenschappen, bouwkunde. Academic year 2016-2017 Preface This master thesis covers a very specific domain of the durability of constructions in marine environment. While most engineering educations cover the aspect of the design and construction of new structures, little information is provided over the maintenance and repair of existing structures. However, the application of these last terms enables to reach the optimal use of materials and to reduce costs, which is in my opinion a fundamental task of an engineer. The choice of a subject related to hydraulic engineering corresponds to my interests. My education of construction engineer started in the technology campus Ghent of university KU Leuven, in Belgium. After the achievement of the bachelor degree, I participated in a project in the north of Peru. Together with other students and local people, we designed and constructed a micro hydro power plant to provide a secluded village of green energy. This internship was a first introduction to water works and raised my interests. As a specialisation in hydraulic engineering is not provided at our campus, I participated in the exchange programme of Erasmus. This enabled the possibility to study at Universitat Politècnica de València where hydraulic engineering plays a strong role. -

Bond of Steel Reinforcement with Microwave Cured Concrete Repair Mortars
Materials and Structures (2017) 50:249 https://doi.org/10.1617/s11527-017-1115-6 ORIGINAL ARTICLE Bond of steel reinforcement with microwave cured concrete repair mortars P. S. Mangat . Shahriar Abubakri . Konstantinos Grigoriadis Received: 30 June 2017 / Accepted: 17 November 2017 / Published online: 28 November 2017 Ó The Author(s) 2017. This article is an open access publication Abstract This paper investigates the effect of A unique relationship exists between bond strength microwave curing on the bond strength of steel and both compressive strength and porosity of all reinforcement in concrete repair. Pull-out tests on matrix materials. Microwave curing reduced shrink- plain mild steel reinforcement bars embedded in four age but despite the wide variation in the shrinkage of repair materials in 100 mm cube specimens were the repair mortars, its effect on the bond strength was performed to determine the interfacial bond strength. small. The paper provides clear correlations between The porosity and pore structure of the matrix at the the three parameters (compressive strength, bond steel interface, which influence the bond strength, strength and porosity), which are common to both were also determined. Test results show that micro- the microwave and conventionally cured mortars. wave curing significantly reduces the bond strength of Therefore, bond-compressive strength relationships plain steel reinforcement. The reduction relative to used in the design of reinforced concrete structures normally cured (20 °C, 60% RH) specimens is will be also valid for microwave cured elements. between 21 and 40% with low density repair materials and about 10% for normal density cementitious Keywords Microwave curing Á Bond strength Á mortars. -

Concrete Industrial Ground Floors
Technical Report No. Third Edition Concrete industrial ground floors A guide to design and construction Report of a Concrete Society Working Party Concrete Society Report TR34- Concrete industrial ground floors Third Edition 2003 IMPORTANT Errata Notification Would you please amend your copy of TR34 to correct the following:- On page 50 - symbols and page 63 - Clause 9.11.3, change the word "percentage" to "ratio" in the definition of px and py. Concrete industrial ground floors A guide to design and construction Third Edition Concrete industrial ground floors - A guide to design and construction Concrete Society Technical Report No. 34 Third Edition ISBN 1 904482 01 5 © The Concrete Society 1988, 1994, 2003 Published by The Concrete Society, 2003 Further copies and information about membership of The Concrete Society may be obtained from: The Concrete Society Century House, Telford Avenue Crowthorne, Berkshire RG45 6YS, UK Tel: +44 (0)1344 466007, Fax: +44(0)1344 466008 E-mail: [email protected], www.concrete.org.uk Design and layout by Jon Webb Index compiled by Linda Sutherland Printed by Holbrooks Printers Ltd., Portsmouth, Hampshire All rights reserved. Except as permitted under current legislation no part of this work may be photocopied, stored in a retrieval system, published, performed in public, adapted, broadcast, transmitted, recorded or reproduced in any form or by any means, without the prior permission of the copyright owner. Enquiries should be addressed to The Concrete Society. The recommendations contained herein are intended only as a general guide and, before being used in connection with any report or specification, they should be reviewed with regard to the full circumstances of such use. -

Effect of Curing Time on Bond Strength Between Reinforcement and Fly-Ash Geopolymer Concrete
Applied Science and Engineering Progress, Vol. 13, No. 2, pp. 127–135, 2020 127 Research Article Effect of Curing Time on Bond Strength between Reinforcement and Fly-ash Geopolymer Concrete Aruz Petcherdchoo*, Tawan Hongubon and Nattawut Thanasisathit Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand Koonnamas Punthutaecha Department of Rural Roads, Ministry of Transport, Bangkok, Thailand Sung-Hwan Jang Department of Civil and Environmental Engineering, Hanyang University, South Korea * Corresponding author. E-mail: [email protected] DOI: 10.14416/j.asep.2020.03.006 Received: 13 December 2019; Revised: 14 February 2020; Accepted: 18 February 2020; Published online: 17 March 2020 © 2020 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved. Abstract This paper focuses on showing the effect of curing time on the bond strength between reinforcement and fly- ash geopolymer concrete. Various parameters are varied to compare between ordinary Portland cement (OPC) concrete and Class C fly-ash geopolymer concrete (GPC). These concretes are designed to have two different compressive strengths, and each of them is cured at 28 and 56 days. The diameter of reinforcement is selected as 12 and 16 mm with deformed type. From the study, it is found that the bond strength increase with increasing the compressive strength, while with decreasing the diameter of reinforcement, as expected. The bond strength of OPC embedded with smaller reinforcement is more sensitive to the increase of the curing time. However, its bond strength is significantly less sensitive to the compressive strength. The bond strength of GPC with higher design compressive strength is more sensitive to the increase of the curing time. -

European Technical Approval ETA-13/0840 English Translation, the Original Version Is in German
copy electronic European technical approval ETA-13/0840 English translation, the original version is in German Handelsbezeichnung Hochfestes Bewehrungssystem SAS 670 Trade name High strength reinforcing system SAS 670 Zulassungsinhaber Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG Holder of approval 83404 Ainring-Hammerau Deutschland Zulassungsgegenstand und Bausatz für Stahlbetonbauteile unter Druckbean- Verwendungszweck spruchung Generic type and use of Kit for reinforced concrete members subject to compression construction product load Geltungsdauer vom 28.06.2013 Validity from nic copy electronic bis zum 27.06.2018 to Herstellwerk Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG Manufacturing plant 83404 Ainring-Hammerau Deutschland Diese Europäische technische Zulassung umfasst 31 Seiten einschließlich 15 Anhängen This European technical approval contains 31 Pages including 15 Annexes electronic copy electro Page 2 of European technical approval ETA-13/0840 Validity from 28.06.2013 to 27.06.2018 Table of contents EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL ETA-13/0840 ...................................................................................... 1 TABLE OF CONTENTS .................................................................................................................................... 2 I LEGAL BASES AND GENERAL CONDITIONS ........................................................................................... 4 II SPECIFIC CONDITIONS OF THE EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL......................................................... 5 1 -
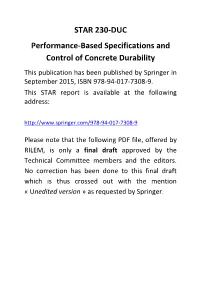
Performance-Based Specifications and Control of Concrete Durability This Publication Has Been Published by Springer in September 2015, ISBN 978-94-017-7308-9
STAR 230-DUC Performance-Based Specifications and Control of Concrete Durability This publication has been published by Springer in September 2015, ISBN 978-94-017-7308-9. This STAR report is available at the following address: http://www.springer.com/978-94-017-7308-9 Please note that the following PDF file, offered by RILEM, is only a final draft approved by the Technical Committee members and the editors. No correction has been done to this final draft which is thus crossed out with the mention « Unedited version » as requested by Springer. RILEM TC 230-PSC Performance-Based Specifications and Control of Concrete Durability State-of-the-Art Report Please note that the Table of Contents of the unedited version doesn’t include Chapter 6 which was in LateX format and added later.version Page numbering is not correct. Unedited version Unedited Contents Contents i 1. Introduction 5 H. Beushausen 5 1.1 Background to the work of TC 230-PSC 5 1.2 Terminology 7 References 10 2. Durability of Reinforced Concrete Structures and Penetrability 11 L.-O. Nilsson, S. Kamali-Bernard, M. Santhanam 11 2.1 Introduction 11 2.2 Mechanisms Causing Reinforcement Corrosion 11 2.2.1 Carbonation 11 2.2.2 Chloride Ingress 12 2.3 Concrete Properties Relating to the Ingress of Aggressive Agents 12 2.3.1 Resistance against Diffusion of CO2 12 2.3.2 Moisture Transport Properties 14 2.3.3 Resistance against Chloride Diffusion and Convection 15 2.4 Service Life and Deterioration Models (Principles) 16 2.4.1 Carbonation Models, In Principle 17 2.4.2 Chloride Ingress Models, In Principle 18 2.4.3 Discussion on the Influence of Cracks version 19 References 19 3. -

Analysis of Climate Change Impacts on the Deterioration of Concrete Infrastructure
Analysis of Climate Change Impacts on the Deterioration of Concrete Infrastructure Part 1: Mechanisms, Practices, Modelling and Simulations – A Review This report was prepared by Xiaoming Wang, Minh Nguyen, Michael Syme, Anne Leitch of CSIRO’s Climate Adaptation Flagship, and Mark G. Stewart of the University of Newcastle, based on the research of ‘An Analysis of the Implications of Climate Change Impacts for Concrete Deterioration’, co-funded by Department of Climate Change and Energy Efficiency (DCCEE) and CSIRO Climate Adaptation National Research Flagship (CAF). Part 1: Mechanisms, Practices, Modelling and Simulation – a Review; Part 2: Modelling and Simulation of Deterioration and Adaptation Options; Part 3: Case Studies of Concrete Deterioration and Adaptation. Citation Wang, X., Nguyen, M., Stewart, M.G., Syme, M., Leitch, A. (2010). Analysis of Climate Change Impacts on the Deterioration of Concrete Infrastructure – Part 1: Mechanisms, Practices, Modelling and Simulations – A review. Published by CSIRO, Canberra. ISBN 9780 4310365 8 For Further Information CSIRO Climate Adaptation Flagship Dr Xiaoming Wang Phone: 03 92526328 Fax: 03 92526246 Email: [email protected] Project Expert Panel Prof Mark Stewart (The University of Newcastle) Prof Priyan Mendis (University of Melbourne) Prof Hong Hao (University of Western Australia) Prof Sheriff Mohamed (Griffith University) Dr Shengjun Zhou (AECOM) Dr Daksh Baweja (Durability Committee, CIA) Ms Komal Krishna (CCAA) Dr Frank Collins (Monash University) Copyright and Disclaimer © 2010 CSIRO To the extent permitted by law, all rights are reserved and no part of this publication covered by copyright may be reproduced or copied in any form or by any means except with the written permission of CSIRO.