Adele Schopenhauer Und Sibylle Mertens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Handlungsspielräume Von Frauen in Weimar-Jena Um 1800. Sophie Mereau, Johanna Schopenhauer, Henriette Von Egloffstein
Handlungsspielräume von Frauen in Weimar-Jena um 1800. Sophie Mereau, Johanna Schopenhauer, Henriette von Egloffstein Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor philosophiae (Dr. phil.) vorgelegt dem Rat der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena von Julia Frindte geboren am 15. Juni 1976 in Erfurt Gutachter 1. Prof . Dr. Siegrid Westphal 2. Prof. Dr. Georg Schmidt 3. ....................................................................... Tag des Kolloquiums: 12.12.2005 Inhalt 1. EINLEITUNG ......................................................................................................... 1 1.1 FRAGESTELLUNG................................................................................................. 3 1.2 UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND .......................................................................... 6 1.3 FORSCHUNGSSTAND ............................................................................................10 1.4 QUELLENGRUNDLAGE .........................................................................................17 1.5 VORGEHENSWEISE...............................................................................................25 2. DAS KONZEPT ‚HANDLUNGSSPIELRAUM’...........................................................28 2.1 HANDLUNGSSPIELRAUM IN ALLTAGSSPRACHE UND FORSCHUNG .......................29 2.2 DAS KONZEPT ‚HANDLUNGSSPIELRAUM’ ...........................................................38 2.2.1 Begriffsverwendung............................................................................38 -
The Affirmation of the Will
Cambridge University Press 978-1-107-62695-9 - Schopenhauer: A Biography David E. Cartwright Excerpt More information 1 The Affirmation of the Will RTHUR SCHOPENHAUER VIEWED himself as homeless. This sense of A homelessness became the leitmotif of both his life and his philos- ophy. After the first five years of his life in Danzig, where he was born on 22 February 1788, his family fled the then free city to avoid Prus- sian control. From that point on, he said, “I have never acquired a new home.”1 He lived in Hamburg on and off for fourteen years, but he had his best times when he was away from that city. When he left Hamburg, he felt as if he were escaping a prison. He lived for four years in Dresden, but he would only view this city as the birthplace of his principal work, The World as Will and Representation. More than a decade in Berlin did nothing to give him a sense of belonging. He would angrily exclaim that he was no Berliner. After living as a noncitizen resident in Frankfurt am Main for the last twenty-eight years of his life, and after spending fifty years attempting to understand the nature and meaning of the world, he would ultimately conclude that the world itself was not his home. If one were to take this remark seriously, then even Danzig had not been his home. He was homeless from birth. But being homeless from birth did not mean that there was no point to his life. Schopenhauer would also conclude that from birth he had a mission in life. -

Stanford Encyclopedia of Philosophy) Stanford Encyclopedia of Philosophy Arthur Schopenhauer
03/05/2017 Arthur Schopenhauer (Stanford Encyclopedia of Philosophy) Stanford Encyclopedia of Philosophy Arthur Schopenhauer First published Mon May 12, 2003; substantive revision Sat Nov 19, 2011 Among 19th century philosophers, Arthur Schopenhauer was among the first to contend that at its core, the universe is not a rational place. Inspired by Plato and Kant, both of whom regarded the world as being more amenable to reason, Schopenhauer developed their philosophies into an instinctrecognizing and ultimately ascetic outlook, emphasizing that in the face of a world filled with endless strife, we ought to minimize our natural desires for the sake of achieving a more tranquil frame of mind and a disposition towards universal beneficence. Often considered to be a thoroughgoing pessimist, Schopenhauer in fact advocated ways — via artistic, moral and ascetic forms of awareness — to overcome a frustrationfilled and fundamentally painful human condition. Since his death in 1860, his philosophy has had a special attraction for those who wonder about life's meaning, along with those engaged in music, literature, and the visual arts. 1. Life: 1788–1860 2. The Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason 3. Schopenhauer's Critique of Kant 4. The World as Will 5. Transcending the Human Conditions of Conflict 5.1 Aesthetic Perception as a Mode of Transcendence 5.2 Moral Awareness as a Mode of Transcendence 5.3 Asceticism and the Denial of the WilltoLive 6. Schopenhauer's Later Works 7. Critical Reflections 8. Schopenhauer's Influence Bibliography Academic Tools Other Internet Resources Related Entries 1. Life: 1788–1860 Exactly a month younger than the English Romantic poet, Lord Byron (1788–1824), who was born on January 22, 1788, Arthur Schopenhauer came into the world on February 22, 1788 in Danzig [Gdansk, Poland] — a city that had a long history in international trade as a member of the Hanseatic League. -
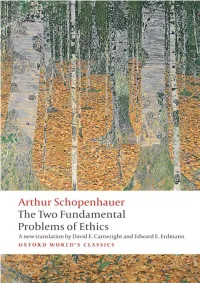
Two Fundamental Problems of Ethics
Great Clarendon Street, Oxford Ox2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With oces in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York Translation, Note on the Text and Translation, Select Bibliography, Chronology, Explanatory Notes © David E. Cartwright and Edward E. Erdmann 2010 Introduction © Christopher Janaway 2010 The moral rights of the authors have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published as an Oxford World’s Classics paperback 2010 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above -

|||GET||| Arthur Schopenhauer: the World As Will and Presentation 1St
ARTHUR SCHOPENHAUER: THE WORLD AS WILL AND PRESENTATION 1ST EDITION DOWNLOAD FREE Arthur Schopenhauer | 9781315507880 | | | | | Schopenhauer: 'The World as Will and Representation': Volume 1 I can say this was add-on because they really don't flow with how he dealt with Christianity anywhere else within the Volume. This volume is divided into four books. Essentially all of philosophy. The book is easy to read and assimilate compared to the works of other philosophers I have read. To be blunt: I cannot recommend this work to anyone. The Will wills, and the character and motivation of the person make it possible to learn, to gain knowledge, and this might alter the way the Will objectifies itself in us. If the whole world as representation is only the visibility of the will, then art is the elucidation of this visibility, the camera obscura which shows the objects more purely, and enables us to survey and comprehend them better. The happiness that we seek is more inclined towards self preservation and satisfaction of vanity. True, compared to Kant, Schopenhauer developed a more consistent and complete philosophy. With Schop, the Will, the thing-in-itself, is in you as much as it is in anything else. More generally, although S was an atheist, there is a lot of religion in the book, more of the order of religion as philosophy. Conceived and published before the philosopher was 30 and expanded 25 years later, it is the summation of a lifetime of thought. The only hope for the individual is to save his own soul; and even this he can do only by avoiding worldly entanglements. -

Jugendleben Und Wanderbilder
Brigham Young University BYU ScholarsArchive Prose Fiction Sophie 1839 Jugendleben und Wanderbilder Johanna Schopenhauer Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sophiefiction Part of the German Literature Commons BYU ScholarsArchive Citation Schopenhauer, Johanna, "Jugendleben und Wanderbilder" (1839). Prose Fiction. 125. https://scholarsarchive.byu.edu/sophiefiction/125 This Article is brought to you for free and open access by the Sophie at BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Prose Fiction by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Johanna Schopenhauer Jugendleben und Wanderbilder Johanna Schopenhauer: Jugendleben und Wanderbilder Unvollendet, mit Notizen zur geplanten Fortsetzung. Erstdruck in: Johanna Schopenhauer’s Nachlaß. Herausgegeben von ihrer Tochter [Adele Schopenhauer], 1.–2. Band, Braunschweig (George Westermann) 1839. Die im Anhang versammelten Fragmente und Briefe werden hier nicht wiedergegeben. Textgrundlage sind die Ausgaben: Johanna Schopenhauer’s Nachlaß. Herausgegeben von ihrer Tochter. Band 1, Braunschweig: Verlag von George Westermann, 1839. Johanna Schopenhauer’s Nachlaß. Herausgegeben von ihrer Tochter. Band 2, Braunschweig: Verlag von George Westermann, 1839. Dieses Buch folgt in Rechtschreibung und Zeichensetzung obiger Textgrundlage. Die Paginierung obiger Ausgaben wird hier als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Inhalt Erster Band .................................................................................................... -

"Reisen, Sollte Ich &En! England Sehen! " by a Thesis Submitted to The
"Reisen, sollte ich &en! England sehen! " A Study in Eighteent h-century Travel Accounts: Sophie von La Roche, Johanna Schopenhauer and Others by Helen Lowry A thesis submitted to the Department of German Language and Literature in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Queen's University Kingston, On tario, Canada October, 1998 Helen Lowry, 1998 National Library Bibliothèque nationale du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A W OüawaON K1AW Canada canada The author has granted a non- L'auteur a accordé une Licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distri-bute or sen reproduire, prêter, distniuer ou copies of this thesis in rnicroform, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic formats. la fome de microfiche/film, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantiai extracts fkom it Ni la thèse ni des extraits substantiels may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent êîre imprimes - reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. -. 11 ABSTRACT This study considers the travel accounts of Great Britain by Sophie von La Roche and Johanna Schopenhauer as disparate representatives of the Geman anglophilia prevalent in the latter stages of the long eighteenth century. These women journeyed to Britain as products of the burgeoning bourgeois inclination to travel in an age of gemgraphical and metaphysical discovery. -

Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS. Seite VORWORT DES HERAUSGERERS III PHILOSOPHISCHE ABTEILUNG. Die Bergsonsche Philosophie in ihrem Verhältnis zu Schopenhauer. Von Peter Knudsen (Glostrup bei Kopen hagen) 3 Vorstufen der Lehre Nietzsches von der ewigen Wiederkunft bei Schopenhauer. Von Heinrich Hasse (Frankfurta.M.) 45 Die Palingenesie bei Schopenhauer und die Frage der Identität in der Wiederverkörperung. Von Hermann Thomsen (Bolzano-Gries) 57 Anatole France et Schopenhauer. Par A. Baillot (Chinon) 67 BIOGRAPHISCHE ABTEILUNG. Neue Mitteilungen über Adele und Arthur Schopenhauer. Von H. H. Houben (Berlin) 79 I. Tod der Adele Schopenhauer 80 II. Adelens Nachlaß 108 III. Ein Briefwechsel mit Arthur Schopenhauer . 137 VERMISCHTE BEITRÄGE UND BEMERKUNGEN. Die Feier des 140. Geburtstages Schopenhauers in Danzig. Von Hans Cüsow (Danzig) 185 Nochmals über den Einfluß Schopenhauers auf die schöne Literatur. Von Richard Gebhard (Berlin-Wilmersdorf) 189 Schopenhauer in der Belletristik Italiens. Von Hans Zint (Danzig) . 190 Italo Svevo f. Von Carlo Franellich (Trieste) . 194 Julius Eichenwald f. Von Richard Gebhard (Berlin- Wilmersdorf) 198 — XII — Seite BIBLIOGRAPHIE. Zusammengestellt von Rudolf Borch (Braunschweig). Schopenhauer-Bibliographie für das Jahr 1926 . 201 , „ , ü'27 ... 204 . , „ 1928 ... 206 BESPRECHUNGEN. Arturo Schopenhauer, II Mondo come Volon!ä e Rap- presentazione. Vol. I. Trad. di P. Savj-Lopez e G. De Lorenzo. Von Hans Zint (Danzig) 209 Ernst Kilb, Schopenhauers Religionsphilosophie und die Religionsphilosophie des Als-Ob. Von Max Rudolph (Arnstadt) 210 Prabhu Dutt Shastri, The Essentials of Eastern Philo- sophy. Von Helmuth von Glasenapp (Königsberg i. Pr.) 213 Arthur Liebert, Die Philosophie in der Schule. Von Kurt Krippendorf (Berlin) 214 Hermann Thomsen, Tod und Neue Geburt. Die Wieder- verkörperung bei Schopenhauer und in einer Philosophie des Lebens. -

Volume 2. from Absolutism to Napoleon, 1648-1815 Johanna
Volume 2. From Absolutism to Napoleon, 1648-1815 Johanna Trosiener, the Daughter of a Danzig Merchant and Mother of Philosopher Arthur Schopenhauer and Writer Luise Adelaide Lavinia Schopenhauer, Reflects on her Childhood and Youth in the 1770s (Retrospective Account) These pages paint a lively picture of the prosperous and stable world of the merchant class in the urban republic of the great Baltic port city of Danzig, which enjoyed virtual self-government within the Commonwealth of Poland. In the following excerpts, Johanna Schopenhauer (1766- 1838) recounts her ambivalent education, which drew her toward higher learning and the arts, but still kept her far enough away to preserve her martial eligibility. Later she suffered an unhappy marriage imposed upon her by her father. Fortunately, however, she was able to develop her literary talents within the marriage, and after her husband’s death she became a notable intellectual in Hamburg, Weimar, and Bonn, and the first female writer in Germany to support herself with her royalties. Youthful Life and Scenes from Travels Johanna Schopenhauer [ . ] [Lessons at school, from a private tutor, and from a neighbor] [The preacher of Danzig’s English colony, Dr. Jameson, lived in the house next door.] [ . ] As I was growing up, Jameson became my teacher, my guide, my advisor, staying by my side, guarding over my young soul, not parting from me until the time came when another man assumed the responsibility to care for me by taking my hand at the altar. [ . ] I was hardly more than three years old, when I was already sent for a few hours to the school located barely two hundred feet from my parent’s house – twice a day, in the morning and in the afternoon. -

“A MUCH MILDER MEDIUM”: ENGLISH and GERMAN WOMEN WRITERS in ITALY 1840-1880 by Federica Belluccini Submitted in Partial Fulf
“A MUCH MILDER MEDIUM”: ENGLISH AND GERMAN WOMEN WRITERS IN ITALY 1840-1880 by Federica Belluccini Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at Dalhousie University Halifax, Nova Scotia December 2011 © Copyright by Federica Belluccini, 2011 DALHOUSIE UNIVERSITY INTERDISCIPLINARY PHD PROGRAM The undersigned hereby certify that they have read and recommend to the Faculty of Graduate Studies for acceptance a thesis entitled ““A MUCH MILDER MEDIUM”: ENGLISH AND GERMAN WOMEN WRITERS IN ITALY 1840-1880” by Federica Belluccini in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Dated: December 2, 2011 External Examiner: _________________________________ Research Supervisor: _________________________________ Examining Committee: _________________________________ _________________________________ Departmental Representative: _________________________________ ii DALHOUSIE UNIVERSITY DATE: December 2, 2011 AUTHOR: Federica Belluccini TITLE: “A MUCH MILDER MEDIUM”: ENGLISH AND GERMAN WOMEN WRITERS IN ITALY 1840-1880 DEPARTMENT OR SCHOOL: Interdisciplinary PhD Program DEGREE: PhD CONVOCATION: May YEAR: 2012 Permission is herewith granted to Dalhousie University to circulate and to have copied for non-commercial purposes, at its discretion, the above title upon the request of individuals or institutions. I understand that my thesis will be electronically available to the public. The author reserves other publication rights, and neither the thesis nor extensive extracts from it may be printed or otherwise reproduced without the author’s written permission. The author attests that permission has been obtained for the use of any copyrighted material appearing in the thesis (other than the brief excerpts requiring only proper acknowledgement in scholarly writing), and that all such use is clearly acknowledged. _______________________________ Signature of Author iii In Memory of Dr. -

Geschichte Einer Liebe. Adele Schopenhauer Und Sibylle Mertens
Angela Steidele Geschichte einer Liebe Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens Adele Schopenhauer (1797-1849) – Schriftstellerin, Künstlerin, die Schwester des Philosophen Arthur Schopenhauer – und die »Rheingräfin« Sibylle Mertens- Schaaffhausen (1797-1857) verband eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit den dazugehörigen Höhen und Tiefen. Seit 1828 waren sie ein Paar. Sibylle Mertens war eine der gebildetsten Frauen ihrer Zeit, Musikerin, Kom- ponistin, Archäologin, Antikensammlerin und Mäzenin. Ihre Salons in Bonn und Rom waren berühmt. Vom Vater an einen ungeliebten Mann verheiratet, pflegte sie zeit ihres Lebens intensive Beziehungen zu Frauen. Adeles Leben mit Sibylle Mertens wurde so nicht nur von deren Ehemann und ihren sechs Kindern beein- trächtigt, die ihre Beziehung als »Unrecht, Wahnwitz, Tollheit«torpedierten.Auch Sibylles Hang zu neuen Eroberungen ebenso wie ihre enge Freundschaft zu An- nette von Droste-Hülshoff lasteten schwer auf Adele. Aber selbst nach einer mehr- jährigen Trennung fanden sie wieder zusammen. Angela Steidele erzählt die Geschichte zweier ungewöhnlicher Frauen: Pionie- rinnen, die in Wissenschaft und Kultur, Wirtschaft, Politik und nicht zuletzt in ihrem Privatleben Grenzen einrissen – zu einer Zeit, als es Liebe zwischen Frauen offiziell gar nicht geben durfte. »Die Geschichte dieser beiden ist eine der großen Liebesgeschichten, wie sie in diesem Format – mal melodramatisch, mal opernhaft, mal von singspielartiger Komik,vollvonbösenKindernoderBrüdern,missgünstigenErbenundgroß- zügigenRevolutionären,mitSchauplätzeninWeimar,RomundKöln,mitUm- sturz, Bankrott und italienischen Höhepunkten – wohl nur das 19.Jahrhundert hervorbrachte ...« Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung Angela Steidele, geboren 1968, Dr. phil., erforscht die Geschichte der Frauenliebe vorErfindungder»Homosexualität«(1869).SielebtalsfreieAutorininKöln.Ihr erstes Buch In Männerkleidern. Das verwegene Leben der Catharina Margaretha Linck war ein Überraschungserfolg, »faszinierender als jeder Roman« (DIE ZEIT), ausgezeichnet mit dem Gleim-Literaturpreis. -

Schopenhauer's Theory of Justice
The Catholic University of America, Columbus School of Law CUA Law Scholarship Repository Scholarly Articles and Other Contributions Faculty Scholarship 1994 Schopenhauer's Theory of Justice Raymond B. Marcin The Catholic University of America, Columbus School of Law Follow this and additional works at: https://scholarship.law.edu/scholar Part of the Law and Philosophy Commons Recommended Citation Raymond B. Marcin, Schopenhauer's Theory of Justice, 43 CATH. U. L. REV. 813 (1994). This Article is brought to you for free and open access by the Faculty Scholarship at CUA Law Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Scholarly Articles and Other Contributions by an authorized administrator of CUA Law Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. SCHOPENHAUER'S THEORY OF JUSTICE Raymond B. Marcin* "[I]n all that happens or indeed can happen to the individual, justice is always done to it." Arthur Schopenhauer** There is a curiosity about Schopenhauer. Most people know his name but little or nothing about his philosophy. If pressed, many would iden- tify him as a precursor of some aspects of fascism or Hitlerism, and per- haps he might have been, but his philosophy was not. The truth is that we would all be much better off if we knew something about his philosophy, but forgot his name, for Arthur Schopenhauer was a strange rarity-a true prophet who did not practice what he preached. Schopenhauer's theory of justice, the reader should be cautioned, is radical in the extreme. Justice, in Schopenhauer's system, is not an epis- temological construct.