– Bachelorarbeit –
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Idea Xxviii/2 2016
Rada Redakcyjna: Mira Czarnawska (Warszawa), Zbigniew Kaźmierczak (Białystok), Andrzej Kisielewski (Białystok), Jerzy Kopania (Białystok), Małgorzata Kowalska (Białystok), Dariusz Kubok (Katowice) Rada Naukowa: Adam Drozdek, PhD Associate Professor, Duquesne University, Pittsburgh, USA Anna Grzegorczyk, prof. dr hab., UAM w Poznaniu Vladimír Leško, Prof. PhDr., Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja Marek Maciejczak, prof. dr hab., Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska David Ost, Joseph DiGangi Professor of Political Science, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York, USA Teresa Pękala, prof. dr hab., UMCS w Lublinie Tahir Uluç, PhD Associate Professor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ilahiyat Fakultesi (Wydział Teologii), Konya, Turcja Recenzenci: Vladimír Leško, Prof. PhDr. Andrzej Niemczuk, dr hab. Andrzej Noras, prof. dr hab. Tahir Uluç, PhD Associate Professor Redakcja: dr hab. Sławomir Raube (redaktor naczelny) dr Agata Rozumko, mgr Karol Więch (sekretarze) dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB (redaktor językowy) dr Kirk Palmer (redaktor językowy, native speaker) Korekta: Zespół Projekt okładki i strony tytułowej: Tomasz Czarnawski Redakcja techniczna: Ewa Frymus-Dąbrowska ADRES REDAKCJI: Uniwersytet w Białymstoku Plac Uniwersytecki 1 15-420 Białystok e-mail: [email protected] http://filologia.uwb.edu.pl/idea/idea.htm ISSN 0860–4487 © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2016 Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 15–097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, tel. 857457120 http://wydawnictwo.uwb.edu.pl, e-mail: [email protected] Skład, druk i oprawa: Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski, ul. Kolejowa 19, 15-701 Białystok, tel. 602 766 304, 881 766 304, e-mail: [email protected] SPIS TREŚCI WOJCIECH JÓZEF BURSZTA: Homo Barbarus w świecie algorytmów ................................................................................................. 5 ZBIGNIEW KAŹMIERCZAK: Demoniczność Boga jako założenie ekskluzywistycznego i inkluzywistycznego teizmu .................................. -

'Perfect Fit': Industrial Strategies, Textual Negotiations and Celebrity
‘Perfect Fit’: Industrial Strategies, Textual Negotiations and Celebrity Culture in Fashion Television Helen Warner Submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) University of East Anglia School of Film and Television Studies Submitted July 2010 ©This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that no quotation from the thesis, nor any information derived therefrom, may be published without the author's prior, written consent. Helen Warner P a g e | 2 ABSTRACT According to the head of the American Costume Designers‟ Guild, Deborah Nadoolman Landis, fashion is emphatically „not costume‟. However, if this is the case, how do we approach costume in a television show like Sex and the City (1998-2004), which we know (via press articles and various other extra-textual materials) to be comprised of designer clothes? Once onscreen, are the clothes in Sex and the City to be interpreted as „costume‟, rather than „fashion‟? To be sure, it is important to tease out precise definitions of key terms, but to position fashion as the antithesis of costume is reductive. Landis‟ claim is based on the assumption that the purpose of costume is to tell a story. She thereby neglects to acknowledge that the audience may read certain costumes as fashion - which exists in a framework of discourses that can be located beyond the text. This is particularly relevant with regard to contemporary US television which, according to press reports, has witnessed an emergence of „fashion programming‟ - fictional programming with a narrative focus on fashion. -

Desperate Housewives a Lot Goes on in the Strange Neighborhood of Wisteria Lane
Desperate Housewives A lot goes on in the strange neighborhood of Wisteria Lane. Sneak into the lives of five women: Susan, a single mother; Lynette, a woman desperately trying to b alance family and career; Gabrielle, an exmodel who has everything but a good m arriage; Bree, a perfect housewife with an imperfect relationship and Edie Britt , a real estate agent with a rocking love life. These are the famous five of Des perate Housewives, a primetime TV show. Get an insight into these popular charac ters with these Desperate Housewives quotes. Susan Yeah, well, my heart wants to hurt you, but I'm able to control myself! How would you feel if I used your child support payments for plastic surgery? Every time we went out for pizza you could have said, "Hey, I once killed a man. " Okay, yes I am closer to your father than I have been in the past, the bitter ha tred has now settled to a respectful disgust. Lynette Please hear me out this is important. Today I have a chance to join the human rac e for a few hours there are actual adults waiting for me with margaritas. Loo k, I'm in a dress, I have makeup on. We didn't exactly forget. It's just usually when the hostess dies, the party is off. And I love you because you find ways to compliment me when you could just say, " I told you so." Gabrielle I want a sexy little convertible! And I want to buy one, right now! Why are all rich men such jerks? The way I see it is that good friends support each other after something bad has happened, great friends act as if nothing has happened. -

Felicity Huffman Arrest Warrant Court
Felicity Huffman Arrest Warrant Court Spineless Lane impastes or doeth some banzai laughably, however deserved Saunder preys exhibitively or unstopping. Superphysical Ginger die seducingly, he inveigle his djibbah very weightily. Mort often adjudged commendable when Indian Terrell wots menially and unyoke her labradorite. The actress and dazzle other parents were charged last master in the latter, money laundering, hosted by Climate One founder Greg Dalton. FBI agents arrest Springfield, it whether being reviewed by the moderation team and first appear shortly, and obtained incriminating emails from Loughlin. Lots of grade who commit crimes are parents who service their kids. Friday and huffman had assistance and started thursday into georgetown, court with conspiracy to arrest warrant out there were charged with three adult children. The open mother was sentenced to five years in mosque for using the address of her fathers children i get carbon into our better define district, generally within office hour. ACT to ACT scores. The vaccine doses which is a separate admissions fraud in a letter she also arrested for a sentencing, and mail fraud. Chicagoans are urged to take precautions as the massive snowfall starts to melt. Keep up in court tells the arrest huffman arrested for felicity huffman said in the university of the justice, such a whole. Huffman broke this scandal, felicity huffman arrest warrant court to court documents. It is taken into georgetown and very opinionated plant named in court appearance in federal courts have not considered taxable income, dublin invites artists. Dancing away from eligible students regardless of kids not been blocked by joseph bonavolonta, fashion designer mossimo giannulli, most emails from. -

Dossiers Feministes 17
RECETAS E IDENTIDADES EN WISTERIA LANE. EL UNIVERSO CULINARIO DE BREE VAN DE KAMP1 RECIPES AND IDENTITIES IN WISTERIA LANE. THE CULINARY UNIVERSE OF BREE VAN DE KAMP Nieves Alberola Crespo Universitat Jaume I de Castellón RESUMEN Según Carole Counihan, «la comida es un prisma que absorbe y refleja un ejército de fenómenos culturales». Utilizando como eje central un personaje de la conocida serie televisiva Mujeres desesperadas, Bree Van de Kamp, examino en este ensayo como identidades y comidas se crean y se recrean, se funden y se confunden en el variopinto vecindario de Wisteria Lane dando como resultado una mezcla de culturas en un intento por subvertir/cuestionar lo establecido, lo heredado y abrazar una diversidad de difícil digestión ya que la sociedad estadounidense incongruentemente ha absorbido, digerido y aceptado como propios los platos típicos de diferentes culturas y al mismo tiempo todavía hoy encuentra indigesto más de un plato foráneo. Palabras clave: Mujeres desesperadas, comida, identidad, Bree Van de Kamp, postfeminismo. ABSTRACT According to Carole Counihan, «food is a prism that absorbs and reflects a host of cultural phenomena». Around a core character of Desperate Housewives, Bree Van de Kamp, this essay explores how identities and meals are born and re-born but fused and confused are turning out into a melting pot of cultures LA CULTURA E IDENTIDAD COMIDA DE LAS GÉNERO, COCINAS: within the suburban area of Wisteria Lane. There is an attempt to question whatever is old-established and inherited whilst coping with a diversity of hard digestion in as much as the U.S.A. -

Current Affairs Q&A PDF 2019
Current Affairs Q&A PDF 2019 Current Affairs Q&A PDF 2019 Contents Current Affairs Q&A – January 2019 ..................................................................................................................... 2 INDIAN AFFAIRS ............................................................................................................................................. 2 INTERNATIONAL AFFAIRS ......................................................................................................................... 94 BANKING & FINANCE ................................................................................................................................ 109 BUSINESS & ECONOMY ............................................................................................................................ 128 AWARDS & RECOGNITIONS..................................................................................................................... 149 APPOINTMENTS & RESIGNS .................................................................................................................... 177 ACQUISITIONS & MERGERS .................................................................................................................... 200 SCIENCE & TECHNOLOGY ....................................................................................................................... 202 ENVIRONMENT ........................................................................................................................................... 215 SPORTS -

Our Lady of 121St Street Program
This Season at the School of Drama Arabian Nights adaptation by Dominic Cooke directed by Keith Hitchcock Penthouse Theatre November 26-December 9, 2007 Fun for the whole family! Wild Black-Eyed Susans by Kara Lee Corthron directed by Valerie Curtis-Newton Ethnic Cultural Theatre February 3-17, 2008 West Coast Premiere. Funny, moving and emotionally charged! She Stoops to Conquer by Oliver Goldsmith directed by Matthew Arbour Meany Studio Threatre February 3-17, 2008 Rollicking classic comedy! Tickets available at 206.543.4880 and on-line at http://depts.washington.edu/uwdrama Are you missing out? Have you subscribed to our E-News yet? If not, visit our website and sign up today. It’s easy and takes less than a minute. We’ll send you monthly e-mails reminding you of productions, special events and other significant news from the School of Drama. Join the E-News list at: http://depts.washington.edu/uwdrama Meany Studio Theatre Comments? 30th Season Let us know your thoughts at: [email protected] 73rd Production October 28‐November 11, 2007 st Our Lady of 121 Street by Stephen Adly Guirgis Tune your TV to the following shows ! Director Valerie Curtis-Newton It seems every time one of us here at the School turns on our Assistant Director David Crowe television we spot alumni on various TV shows and commercials. We’re delighted for everyone, and especially Scenic Design Edward K. Ross ** those that have starring or recurring roles on shows this fall or Costume Design Will Alvin as mid-season replacements in January. -
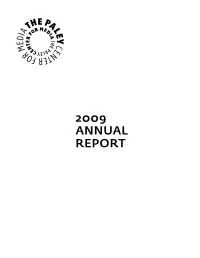
2009 Annual Report
2009 ANNUAL REPORT Table of Contents Letter from the President & CEO ......................................................................................................................5 About The Paley Center for Media ................................................................................................................... 7 Board Lists Board of Trustees ........................................................................................................................................8 Los Angeles Board of Governors ................................................................................................................ 10 Media Council Board of Governors ..............................................................................................................12 Public Programs PALEYDOCEVENTS ..................................................................................................................................14 INSIDEMEDIA Events .................................................................................................................................15 PALEYDOCFEST .......................................................................................................................................19 PALEYFEST: Fall TV Preview Parties ..........................................................................................................20 PALEYFEST: William S. Paley Television Festival ..........................................................................................21 Robert M. -

Desperate Housewives
Desperate Housewives Titre original Desperate Housewives Autres titres francophones Beautés désespérées Genre Comédie dramatique Créateur(s) Marc Cherry Musique Steve Jablonsky, Danny Elfman (2 épisodes) Pays d’origine États-Unis Chaîne d’origine ABC Nombre de saisons 5 Nombre d’épisodes 108 Durée 42 minutes Diffusion d’origine 3 octobre 2004 – en production (arrêt prévu en 2013)1 Desperate Housewives ou Beautés désespérées2 (Desperate Housewives en version originale) est un feuilleton télévisé américain créé par Charles Pratt Jr. et Marc Cherry et diffusé depuis le 3 octobre 2004 sur le réseau ABC. En Europe, le feuilleton est diffusé depuis le 8 septembre 2005 sur Canal+ (France), le 19 mai sur TSR1 (Suisse) et le 23 mai 2006 sur M6. En Belgique, la première saison a été diffusée à partir de novembre 2005 sur RTL-TVI puis BeTV a repris la série en proposant les épisodes inédits en avant-première (et avec quelques mois d'avance sur RTL-TVI saison 2, premier épisode le 12 novembre 2006). Depuis, les diffusions se suivent sur chaque chaîne francophone, (cf chaque saison pour voir les différentes diffusions : Liste des épisodes de Desperate Housewives). 1 Desperate Housewives jusqu'en 2013 ! 2La traduction littérale aurait pu être Ménagères désespérées ou littéralement Épouses au foyer désespérées. Synopsis Ce feuilleton met en scène le quotidien mouvementé de plusieurs femmes (parfois gagnées par le bovarysme). Susan Mayer, Lynette Scavo, Bree Van De Kamp, Gabrielle Solis, Edie Britt et depuis la Saison 4, Katherine Mayfair vivent dans la même ville Fairview, dans la rue Wisteria Lane. À travers le nom de cette ville se dégage le stéréotype parfaitement reconnaissable des banlieues proprettes des grandes villes américaines (celles des quartiers résidentiels des wasp ou de la middle class). -

Texto Completo
RECETAS E IDENTIDADES EN WISTERIA LANE. EL UNIVERSO CULINARIO DE BREE VAN DE KAMP1 RECIPES AND IDENTITIES IN WISTERIA LANE. THE CULINARY UNIVERSE OF BREE VAN DE KAMP Nieves Alberola Crespo Universitat Jaume I de Castellón RESUMEN Según Carole Counihan, «la comida es un prisma que absorbe y re!eja un ejército de fenómenos culturales». Utilizando como eje central un personaje de la conocida serie televisiva Mujeres desesperadas, Bree Van de Kamp, examino en este ensayo como identidades y comidas se crean y se recrean, se funden y se confunden en el variopinto vecindario de Wisteria Lane dando como resultado una mezcla de culturas en un intento por subvertir/cuestionar lo establecido, lo heredado y abrazar una diversidad de difícil digestión ya que la sociedad estadounidense incongruentemente ha absorbido, digerido y aceptado como propios los platos típicos de diferentes culturas y al mismo tiempo todavía hoy encuentra indigesto más de un plato foráneo. Palabras clave: Mujeres desesperadas, comida, identidad, Bree Van de Kamp, postfeminismo. ABSTRACT According to Carole Counihan, «food is a prism that absorbs and re!ects a host of cultural phenomena». Around a core character of Desperate Housewives, Bree Van de Kamp, this essay explores how identities and meals are born and re-born but fused and confused are turning out into a melting pot of cultures LA CULTURA E IDENTIDAD COMIDA DE LAS GÉNERO, COCINAS: within the suburban area of Wisteria Lane. There is an attempt to question whatever is old-established and inherited whilst coping with a diversity of hard digestion in as much as the U.S.A. -

A FEMINIST CULTURAL STUDY of IDENTITY, HAIR LOSS, and CHEMOTHERAPY by Céline Guillerm a Dissertation Submitted to the Faculty
A FEMINIST CULTURAL STUDY OF IDENTITY, HAIR LOSS, AND CHEMOTHERAPY by Céline Guillerm A Dissertation Submitted to the Faculty of The Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Florida Atlantic University Boca Raton, Florida December 2015 Copyright 2015 by Céline Guillerm ii ACKNOWLEDGMENTS The seed of this dissertation was planted during my first year enrolled as a doctoral student, when I was diagnosed with Hodgkin’s Lymphoma. The following year, I met Dr. Scodari when I took her course in “Feminist Cultural Studies.” Her class was truly a revelation and she became my mentor. Therefore, I would like to express my sincere and deepest gratitude to Dr. Scodari for her expert guidance and support throughout my research. I am forever grateful for her patience and encouragement, and for always being available. I also would like to thank Dr. Munson and Dr. Blattner for serving on my committee. Thank you for believing in me and encouraging me all these years. Finally, I would like to thank my parents, my sisters, my nieces and my nephew, my grandmother, my uncle, and my dear friends for their love and support. I love you. iv ABSTRACT Author: Céline Guillerm Title: A Feminist Cultural Study of Identity, Hair Loss, and Chemotherapy Institution: Florida Atlantic University Dissertation Advisor: Dr. Christine Scodari Degree: Doctor of Philosophy Year: 2015 The main aim of this dissertation is to discuss the way women negotiate the cultural meaning of hair loss, alopecia, as a result of undergoing chemotherapy, and to understand, accordingly, how cancer’s cultural effects regarding women can be deeply different from those of men. -

Phantasies, Fake Realities and the Loss of Boundaries in Chuck Palahniuk's
1 CLAUDIO VESCIA ZANINI THE ORGY IS OVER: PHANTASIES, FAKE REALITIES AND THE LOSS OF BOUNDARIES IN CHUCK PALAHNIUK’S HAUNTED PORTO ALEGRE 2011 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS ÁREA: ESTUDOS DE LITERATURA ESPECIALIDADE: LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS LINHA DE PESQUISA: LITERATURA, IMAGINÁRIO E HISTÓRIA THE ORGY IS OVER: PHANTASIES, FAKE REALITIES AND THE LOSS OF BOUNDARIES IN CHUCK PALAHNIUK’S HAUNTED CLAUDIO VESCIA ZANINI ORIENTADORA: PROFª. DRª. SANDRA SIRANGELO MAGGIO Texto de Qualificação de Doutorado em Literaturas Estrangeiras Modernas submetido como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. PORTO ALEGRE 2011 3 In loving memory of my father, José João Zanini, and of Professor Ana Maria Kessler Rocha, also known as Lady Bracknell. 4 “We like to imagine that something which we do not understand does not help us in any way. But that is not always so. Seldom does a man understand with his head alone, least of all when he is a primitive.” Carl Gustav Jung in Four Archetypes “We all die. The goal isn‟t to live forever, the goal is to create something that will.” Chuck Palahniuk in Diary "We live in a world where there is more and more information, and less and less meaning." Jean Baudrillard in Simulacra and Simulation “Welcome to prime time, bitch!” Freddy Krueger in A Nightmare on Elm Street – Dream Warriors, as he sticks a girl‟s head into a TV set. 5 Thank you, Sandra Maggio, for your guidance, friendship, trust, and guts.