Jahrbuch 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cumulated Bibliography of Biographies of Ocean Scientists Deborah Day, Scripps Institution of Oceanography Archives Revised December 3, 2001
Cumulated Bibliography of Biographies of Ocean Scientists Deborah Day, Scripps Institution of Oceanography Archives Revised December 3, 2001. Preface This bibliography attempts to list all substantial autobiographies, biographies, festschrifts and obituaries of prominent oceanographers, marine biologists, fisheries scientists, and other scientists who worked in the marine environment published in journals and books after 1922, the publication date of Herdman’s Founders of Oceanography. The bibliography does not include newspaper obituaries, government documents, or citations to brief entries in general biographical sources. Items are listed alphabetically by author, and then chronologically by date of publication under a legend that includes the full name of the individual, his/her date of birth in European style(day, month in roman numeral, year), followed by his/her place of birth, then his date of death and place of death. Entries are in author-editor style following the Chicago Manual of Style (Chicago and London: University of Chicago Press, 14th ed., 1993). Citations are annotated to list the language if it is not obvious from the text. Annotations will also indicate if the citation includes a list of the scientist’s papers, if there is a relationship between the author of the citation and the scientist, or if the citation is written for a particular audience. This bibliography of biographies of scientists of the sea is based on Jacqueline Carpine-Lancre’s bibliography of biographies first published annually beginning with issue 4 of the History of Oceanography Newsletter (September 1992). It was supplemented by a bibliography maintained by Eric L. Mills and citations in the biographical files of the Archives of the Scripps Institution of Oceanography, UCSD. -

Nupecc Handbook 2004
NuPECC Handbook 2004 e lu Fifth Edition :B ur lo Co ge pa ed er numb Sponsored by CEC DGXII odd- under Contract Number HPRI-CT-1999-40004 ook ndb Ha CC PE Nu 3 Introduction The fourth edition of the NuPECC Handbook on "International Access to Nuclear Physics Facilities in Europe" was published in December 1998, exactly six years ago. In the meanwhile, many developments have occurred on the nuclear physics landscape in Europe. Some facilities have been upgraded and others have ceased to exist. Also directors, facility managers and contact persons have in many cases been replaced during this period. With NuPECC's stated objectives to promote collaboration in nuclear science through the promotion of nuclear physics and its trans-disciplinary use and to define a network of complementary facilities within Europe and encourage optimisation of their usage, NuPECC decided it was time to have an update of the NuPECC Handbook to provide the European nuclear physics community with the most recent information on nuclear physics facilities in Europe, and how to apply for their usage. This fifth edition of NuPECC Handbook has an extensive section on facilities in Europe giving details on accelerators, instrumentation, and coordinates of di- e lu rectors, facility managers and contact persons. Other relevant information for outside users is given. Another section provides information on funding agencies :B ur and research councils as well as nuclear physics institutes in member countries of lo NuPECC. Co NuPECC is an Expert Committee of the European Science Foundation (ESF). The terms of reference of NuPECC and its current members are given in the following pages. -

Pharmaziehistorische Bibliographie 12. Jahrgang 2004
Pharmaziehistorische Bibliographie 12. Jahrgang gegründet 1952 als Pharmaziegeschichtliche Rundschau Redaktion: Lektorat Phannaziegeschichte - Govi-Verlag Phannazeutischer Verlag GmbH Carl-Mannich-Straße 26 - 65760 Eschborn ISSN 0945-7704 Inhalt 1. Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken ....................................................................................... Seiten 1-18 2. Rezensionen aus Zeitschriften ................................................................................................................. Seiten 19-27 3. Monografien/Bücher ................................................................................................................................ Seiten 28-31 4. Originalrezensionen ................................................................................................................................. Seiten 32-45 5. Verzeichnis der regelmäßig ausgewerteten Zeitschriften ........................................................................ Seite 46 6. Register .......................................................................................... , ..........................•.............................. Seiten 47-55 Aufsätze aus Zeitschriften Müller-Jahncke, Wolf-Dieter: Apotheke und Publikum. Die und Sammelwerken Vorträge der Pharmaziehistorischen Biennale in Karlsruhe 1 vom 26. bis 28. April 2002. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2003. 221 S. ISBN: 3-8047-2052-8 (Veröffentlichungen zur Abel-Wanek, Ulrike: Der Weg war das Ziel. Carl Pharmaziegeschichte; Bd. 3), S. 53-70. 9 -

Annals of the History and Philosophy of Biology
he name DGGTB (Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Deutsche Gesellschaft für Theorie der Biologie; German Society for the History and Philosophy of BioT logy) refl ects recent history as well as German tradition. Geschichte und Theorie der Biologie The Society is a relatively late addition to a series of German societies of science and medicine that began with the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften”, Annals of the History founded in 1910 by Leipzig University‘s Karl Sudhoff (1853-1938), who wrote: “We want to establish a ‘German’ society in order to gather Ger- and Philosophy of Biology man-speaking historians together in our special disciplines so that they form the core of an international society…”. Yet Sudhoff, at this Volume 17 (2012) time of burgeoning academic internationalism, was “quite willing” to accommodate the wishes of a number of founding members and formerly Jahrbuch für “drop the word German in the title of the Society and have it merge Geschichte und Theorie der Biologie with an international society”. The founding and naming of the Society at that time derived from a specifi c set of histori- cal circumstances, and the same was true some 80 years lat- er when in 1991, in the wake of German reunifi cation, the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie” was founded. From the start, the Society has been committed to bringing stud- ies in the history and philosophy of biology to a wide audience, us- ing for this purpose its Jahrbuch für Geschichte und Theorie der Biologie. Parallel to the Jahrbuch, the Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie has become the by now traditional medi- Annals of the History and Philosophy Biology, Vol. -

November 27, 2012 Dear Members of The
November 27, 2012 Dear Members of the NSAC Subcommittee on the Implementation of the Long Range Plan: We the undersigned 824 members of the FRIB Users Organization are writing to express the importance of the timely completion of the FRIB project. FRIB is a central component of our future research plans and will enable forefront research and discovery into the nature of atomic nuclei, the origin of elements in WKHFRVPRVWHVWVRIQDWXUH¶VIXQGDPHQWDOODZVDQGVRFLHWDO applications of isotopes. The exciting science case for FRIB and the other rationale for its completion are summarized in the document "FRIB: Opening New Frontiers in Nuclear Science" that we submitted to you in September. The field of nuclear science now encompasses a broad and exciting scientific landscape. Within this landscape, the study of nuclei remains a vital component of the field. Major discoveries are on the horizon into the interactions that govern the properties of nuclei and in the understanding of nuclear processes that drive astrophysical environments. It is likely that other unexpected discoveries will accompany the vast new view of nuclear systems with extreme neutron-to-proton ratios made available by the next generation of rare isotope facilities. The 2007 Long Range Plan outlined the steps needed to achieve a vibrant future for nuclear physics in the U.S. The plan envisions a program where QCD phenomena, nuclei, and fundamental symmetries are studied. It also describes the set of capabilities required to achieve this vision. Specifically, the LRP recognized that a new capability, FRIB, was needed in the area of nuclear structure and nuclear DVWURSK\VLFVDQGFDOOHGWKLVQHHG³PRVWDFXWH´)5,%LVWKH second priority of the 2007 Long Range Plan (the first for new construction) and the first recommendation of the 2012 National Research Council study of Nuclear Physics. -
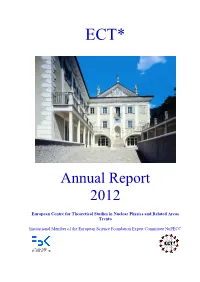
2012 Annual Report (PDF)
ECT* Annual Report 2012 European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas Trento Institutional Member of the European Science Foundation Expert Committee NuPECC Edited by Gian Maria Ziglio and Susan Driessen 1 Preface The European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*) is one of the Research Centres of the Fondazione Bruno Kessler (FBK) and an Institutional Member of the European Science Foundation Expert Committee NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee). Its objectives – as stipulated in its statutes – are: • to arrange in-depth research at the forefront of contemporary developments in nuclear physics; • to foster interdisciplinary contacts between nuclear physics and neighboring fields such as astrophysics, condensed matter physics, particle physics and the quantal physics of small systems; • to encourage talented young physicists to participate in the activities of the ECT* and • to strengthen the interaction between theoretical and experimental physics. As shown on p. 4 of this Annual Report, altogether 684 scientists from 39 countries worldwide have visited the ECT* in 2012 and have participated in the activities of the Centre. This demonstrates once again impressively ECT*’s high visibility and its key importance for the European and international communities. In 2012 ECT* held: • 17 Workshops and 1 Collaboration Meeting on new developments in nuclear and hadronic physics from the lowest to the highest energies, nuclear astrophysics, topics in QCD, many-body systems and physics at the borders of the Standard Model; • a Doctoral Training Programme on “The Three-dimensional Nucleon Structure” lasting for 6 weeks and attended by 15 students; • the first TALENT course on Computational Many-Body Methods for Nuclear Physics lasting for 4 weeks and attended by 22 students. -

Consortium Agreement
HadronPhysics3 Consortium Agreement CONSORTIUM AGREEMENT BY AND BETWEEN ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, established in Via Enrico Fermi 40, FRASCATI, 00044, Italy represented by Fernando Ferroni, President or his authorised representative, the Beneficiary acting as "coordinator" of the consortium (the "coordinator"), ("Beneficiary no. 1"), hereinafter referred to with the short name INFN, and OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, established in Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, WIEN, 1010, Austria represented by Arnold Suppan, Vice President or his authorised representative ("Beneficiary no. 2"), hereinafter referred to with the short name OeAW, and UNIVERSITAET GRAZ, established in Universitaetsplatz 3, GRAZ, 8010, Austria represented by Irmtraud Fischer, Rector for Research and Continuing Education or her authorised representative ("Beneficiary no. 3"), hereinafter referred to with the short name UNIGRAZ, and UNIVERSITY OF CYPRUS, established in Kallipoleos Street 75, NICOSIA, 1678, Cyprus, represented by Evis Drousiotis, Officer of Service for Research and International Relations and/or Gregory Makrides, Head of Service for Research and International Relations or their authorised representative ("Beneficiary no. 4"), hereinafter referred to with the short name UCY, and UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, established in Ovocny trh 5, PRAHA 1, 11636, Czech Republic represented by Zdenek Nemecek, Dean of the Faculty of Mathematics and Physics or his authorised representative ("Beneficiary no. 5"), hereinafter referred to with the short -

Entomologica Austriaca
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Entomologica Austriaca Jahr/Year: 2020 Band/Volume: 0027 Autor(en)/Author(s): Landmann Armin Artikel/Article: Meisterwerke der Entomologie: Die Zoologischen Wandtafeln von Paul Pfurtscheller 107-135 Entomologica Austriaca www.entomologie.org Band 27: 107–135 Wien, 14.03.2020 Meisterwerke der Entomologie: Die Zoologischen Wandtafeln von Paul Pfurtscheller Armin Landmann Abstract: Masterpieces of Entomology: The zoological wall plates by Paul Pfurtscheller. The Austrian biologist and high school teacher Dr. Paul Pfurtscheller (1856–1927) in the early 20th century gained worldwide recognition for his outstanding zoological wall charts. The Pfurtscheller large-scale drawings (size 130 × 140 cm) with exploded views of animal anatomy were valued not only as ideal for higher educational purposes due to their scientific accuracy but also were praised for their aesthetic and artistic quality. For decades (and even nowadays) the wall charts were (are) not only used for teaching purposes but also have been an inspiration for illustrations in biological textbooks. The wall charts (No 1–28) were first published in Vienna from 1902 to at least 1915 by A. Pichlers Witwe & Sohn, later editions (charts No 29 to 39) were edited by the Dutch company Martinus Nijhoff, Gravenhage from around 1923 until at least 1953. The early series were elaborately produced as chromolithographs, a process, that contributed to the extraordinary depth and unusual longevity of the colours of the “Zoological wall charts”. Later editions used offset-printing. Twelve out of the overall 39 drawings of Pfurtscheller deal with arthropod species and eight of them with insects. -

Nuclear Astrophysics and Neutron Stars, Many-Body Theory, Computational Physics
NuPECC Meeting Kraków 11-12 October 2013 European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas Wolfram Weise ECT* andand Technische Universität München 3FTFBSDI*OGSBTUSVDUVSFTBOE/FUXPSLJOH 3FTFBSDI*OGSBTUSVDUVSFTBOE/FUXPSLJOH 3FTFBSDI*OGSBTUSVDUVSFTBOE/FUXPSLJOH3FTFBSDI*OGSBTUSVDUVSFTBOE/FUXPSLJOHIn this chapter, we present the European landscape ing function in the European and international scienti!c 3FTFBSDI*OGSBTUSVDUVSFTBOE/FUXPSLJOHof current Nuclear Physics facilities, plans for build- community by: ing new large-scale research infrastructures (RIs) r 1FSGPSNJOHJOEFQUISFTFBSDIPOUPQJDBMQSPCMFNTBU In this chapter, we present the European landscapeor performing ing function major in upgrades the European of existing and international ones, and scienti !cUIFGPSFGSPOUPGDPOUFNQPSBSZEFWFMPQNFOUTJO/VDMFBS of current Nuclear Physics facilities, plans for buildthe- collaborationcommunity in by: the field at European and global 1IZTJDT /VDMFBS4USVDUVSFBOE/VDMFBS3FBDUJPOTPG ing new large-scale research infrastructures (RIs)level. r 1FSGPSNJOHJOEFQUISFTFBSDIPOUPQJDBMQSPCMFNTBU/VDMFJGBSPGGUIF-JOFPG4UBCJMJUZ )BESPOTBOE2$% 3FTFBSDI*OGSBTUSVDUVSFTBOE/FUXPSLJOH Matter under Extreme Conditions), and related !elds or performing majorIn this chapter,upgrades we of present existing the ones, European and landscapeUIFGPSFGSPOUPGDPOUFNQPSBSZEFWFMPQNFOUTJO/VDMFBS ing function in the European and international scienti!c In this chapter, we present the European landscape ing function in the European and international scienti!c the -

Program Book of Abstracts List of Participants
Workshop on Level Density and Gamma Strength in Continuum Oslo, May 21 - 24, 2007 Program Book of Abstracts List of Participants DEPARTMENT OF PHYSICS UNIVERSITY OF OSLO Program Sunday May 20 19:00 – 21:00 Registration and reception with wine and cheese (Location: Physics building, room FV139) Monday May 21 08:30 – 09:00 Registration and coffee (Location: Physics building, outside room FV232, Lille Fy) 09:00 Welcome and opening of workshop Sunniva Siem (chairman) and Pro-rector Haakon Breien Benestad First session Chair: Eivind Osnes 09:40 Nuclear physics aspects of p-process nucleosynthesis Sotirios Harrisopulos 10:20 Continuous spectroscopy for nuclear structure and astrophysics: from stable to exotic nuclei Andreas Schiller 11:00 Coffee break Second session Chair: Lee Bernstein 11:30 Systematics of level density parameters Till von Egidy 12:10 Nuclear Level Densities Steve Grimes 12:50 Masses and fission barriers of atomic nuclei Krzysztof Pomorski 13:30 Lunch Third session Chair: Magne Guttormsen 15:00 Two-step cascade method Frantisek Beckvar 15:40 Neutron capture measurements with DANCE Gary Mitchell 16:20 Is there an enhancement of photon strength at low gamma-ray energies in Mo isotopes? Milan Krticka 17:00 End of day 17:30 Pizza and beer in Blindernkjelleren Tuesday May 22 08:30 – 09:00 Coffee (Location: Physics building, outside room FV232, Lille Fy) First session Chair: Milan Krticka 09:00 Giant resonances, fine structure, wavelets and spin- and parity-resolved level densities Achim Richter 09:40 Properties of hot nuclei at -

Dynamics and Statistical Physics Division Fachverband Dynamik Und Statistische Physik (DY)
Dynamics and Statistical Physics Division (DY) Overview Dynamics and Statistical Physics Division Fachverband Dynamik und Statistische Physik (DY) Klaus Richter Universit¨atRegensburg Naturwissenschaftliche Fakult¨atII-Physik 93040 Regensburg [email protected] Overview of Invited Talks and Sessions (lecture rooms HUL¨ 386, ZEU 118, ZEU 255 and WIL B321; Poster P1A and P1B) Plenary Talk The plenary talk related to the division DY by Prof. P. H¨anggi takes place Monday, 8:30, HSZ 01. See the plenary section for title and abstract. Prize Talk The prize talk (Gentner-Kastler-Prize) by Prof. T. Geisel takes place Tuesday, 13:00, HSZ 01. See the plenary section for title and abstract. Invited Talks DY 1.1 Mon 10:15–10:45 HUL¨ 386 Heat transfer on the nanometer scale — Near-field thermal scan- ning microscopy — •Achim Kittel DY 4.1 Mon 14:00–14:30 HUL¨ 386 Mechanisms of tissue maintenance: a laboratory for statistical physics — •Benjamin Simons DY 7.1 Tue 9:30–10:00 HUL¨ 386 Statistical Mechanics of sytems with long range interactions. — •David Mukamel DY 10.1 Tue 14:00–14:30 HUL¨ 386 Self-Dynamics of a Slender Rod — •Thomas Franosch DY 14.1 Wed 9:45–10:15 HUL¨ 386 Turbulent convective transport - news and challenges — •Siegfried Grossmann DY 14.5 Wed 12:00–12:30 HUL¨ 386 Towards a quantum Church-Turing Theorem — •Reinhard F. Werner DY 15.1 Wed 14:00–14:30 HUL¨ 386 Time-reversed waves and super-resolution — •Mathias Fink DY 20.1 Thu 9:30–10:00 HUL¨ 386 Magnetic granular matter: from lattices to self-assembled swim- mers — •Igor Aranson, Alexey Snezhko, Maxim Belkin, Wai Kwok DY 23.1 Thu 14:00–14:30 HUL¨ 386 Work and Fluctuation Theorems for quantum systems — •Peter Talkner Focused Session ”50 years DY: Trends in dynamics and statistical physics” Organization: H. -
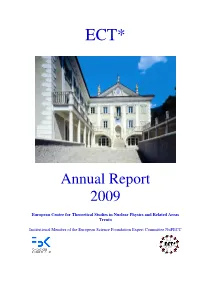
2009 Annual Report (PDF)
ECT* Annual Report 2009 European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas Trento Institutional Member of the European Science Foundation Expert Committee NuPECC Edited by Silvia Tomasi and Gian Maria Ziglio 1 Preface The objectives of the European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*), which is an Institutional Member of the European Science Foundation Expert Committee NuPECC, concern fundamental research. With 648 visiting scientists in 2009 from all over the world spending from a week to several months at the Centre, ECT* has maintained and increased its high visibility and coordinating function in the European and international scientific community by holding during the year • 17 Workshops and Collaboration Meetings on topical problems at the forefront of contemporary developments in nuclear physics and related fields like astrophysics, condensed matter physics and quantal physics of small systems, • a Doctoral Training Programme on “The physics of strongly correlated systems: from quark matter to ultra cold atoms” lasting 3 months for 16 talented young physicists selected out of a large number of applicants,and by fostering • basic research on low energy nuclear theory, effective field theory, the pion-nucleon interaction and the nuclear force, non-perturbative QCD, the colour glass condensate and the quark gluon plasma done by an in-house group of Postdoctoral Fellows and Senior Research Associates having interacted closely scientifically with the Director and the Vice-Director of the Centre and visitors and collaborating physicists elsewhere. Furthermore, in 2009 ECT* has started to administer scientifically a new research project named • AuroraScience, which consists of interdisciplinary proposals that explore the architectural opportunities for high performance computing (HPC) systems optimized for a number of highly relevant scientific computing applications in physics, biology, fluid dynamics, molecular dynamics, protein folding, genomics and medical physics.