Kopulation Und Sexualethologie Von Schmetterlingshaften
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
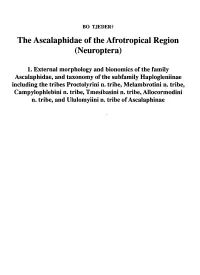
The Ascalaphidae of the Afrotropical Region (Neurop Tera)
The Ascalaphidae of the Afrotropical Region (Neuroptera) 1. External morphology and bionomics of the family Ascalaphidae, and taxonomy of the subfamily Haplogleniinae including the tribes Proctolyrini n. tribe, Melambrotini n. tribe, Campylophlebini n. tribe, Tmesibasini n. tribe, Allocormodini n. tribe, and Ululomyiini n. tribe of Ascalaphinae Contents Tjeder, B. T: The Ascalaphidae of the Afrotropical Region (Neuroptera). 1. External morphology and bionomics of the family Ascalaphidae, and taxonomy of the subfamily Haplogleniinae including the tribes Proctolyrini n. tribe, Melambro- tinin. tribe, Campylophlebinin. tribe, Tmesibasini n. tribe, Allocormodini n. tribe, and Ululomyiini n. tribe of Ascalaphinae ............................................................................. 3 Tjeder, B t &Hansson,Ch.: The Ascalaphidaeof the Afrotropical Region (Neuroptera). 2. Revision of the hibe Ascalaphini (subfam. Ascalaphinae) excluding the genus Ascalaphus Fabricius ... .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 1 Contents Proctolyrini n. tribe ................................... .. .................60 Proctolyra n . gen .............................................................61 Introduction .........................................................................7 Key to species .............................................................62 Family Ascalaphidae Lefebvre ......................... ..... .. ..... 8 Proctolyra hessei n . sp.......................................... 63 Fossils ............................. -

Research Article Selection of Oviposition Sites by Libelloides
Hindawi Publishing Corporation Journal of Insects Volume 2014, Article ID 542489, 10 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/542489 Research Article Selection of Oviposition Sites by Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) (Neuroptera: Ascalaphidae), North of the Alps: Implications for Nature Conservation Markus Müller,1 Jürg Schlegel,2 and Bertil O. Krüsi2 1 SKK Landschaftsarchitekten, Lindenplatz 5, 5430 Wettingen, Switzerland 2 Institute of Natural Resource Sciences, ZHAW Zurich University of Applied Sciences, Gruental,8820W¨ adenswil,¨ Switzerland Correspondence should be addressed to Markus Muller;¨ [email protected] Received 27 November 2013; Accepted 18 February 2014; Published 27 March 2014 Academic Editor: Jose´ A. Martinez-Ibarra Copyright © 2014 Markus Muller¨ et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. (1) The survival of peripheral populations is often threatened, especially in a changing environment. Furthermore, such populations frequently show adaptations to local conditions which, in turn, may enhance the ability of a species to adapt to changing environmental conditions. In conservation biology, peripheral populations are therefore of particular interest. (2) In northern Switzerland and southern Germany, Libelloides coccajus is an example of such a peripheral species. (3) Assuming that suitable oviposition sites are crucial to its long-term survival, we compared oviposition sites and adjacent control plots with regard to structure and composition of the vegetation. (4) Vegetation structure at and around oviposition sites seems to follow fairly stringent rules leading to at least two benefits for the egg clutches: (i) reduced risk of contact with adjacent plants, avoiding delayed drying after rainfall or morning dew and (ii) reduced shading and therefore higher temperatures. -
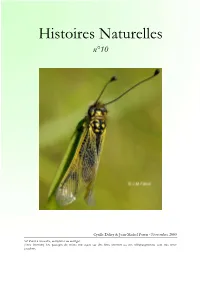
Libelloides Coccajus
Histoires Naturelles n°10 - Novembre 2009 Histoires Naturelles n°10 Cyrille Deliry & Jean-Michel Faton - Novembre 2009 !w! Point à résoudre, compléter ou corriger. [liens Internet] Les passages de textes renvoyant sur des liens Internet ou des téléchargements sont mis entre crochets. 1 Histoires Naturelles n°10 - Novembre 2009 Sur mon âme ! s'écria tout à coup Gringoire, nous sommes allègres et joyeux comme des ascalaphes ! Nous observons un silence de pythagoriciens ou de poissons ! Pasque-Dieu ! mes amis, je voudrais bien que quelqu'un me parlât. Notre-Dame de Paris (Victor Hugo) 2 Histoires Naturelles n°10 - Novembre 2009 HISTOIRE NATURELLE DES ASCALAPHES 1999-2009 - Diverses versions antérieures déposées sur le Web Villette de Vienne, le 7 novembre 2009 Les Ascalaphes sont apparentés à l’ordre des Neuroptères, comme les fourmilions et les chrysopes en raison des caractéristiques de l'appareil buccal des larves et de leurs ailes membraneuses armées de fortes nervures. Il existe 300 espèces d’Ascalaphidés dans le monde, une douzaine seulement réside dans la France méridionale. Leur aspect peut être considéré comme intermédiaire entre des Libellules et des Papillons, ce qui leur donne un charme tout particulier. Au repos, ils tiennent leurs ailes en toit, comme les Cigales. Ascalaphes de France Ordre Neuroptera Famille des Ascalaphidae Rambur, 1842 Sous-famille des Ascalaphinae Rambur 1842 Bubopsis Mac Lachlan 1898 o Bubopsis agrionoides (Rambur 1838) Delecproctophylla Lefebvre 1842 o Delecproctophylla australis (Fabricius 1787) o Delecproctophylla dusmeti (Navas 1914) Libelloides Tjeder 1972 Les noms scientifiques des Neuroptera ont été revus au niveau international en 1991. Ainsi le genre Ascalaphus semble réservé à des espèces américaines, le genre Libelloides concernant les espèces d’Europe. -

Algunos Neurłpteros (Neuroptera: Ascalaphidae Y Nemopteridae) De La Colecciłn De Artrłpodos De Louriz˘N (Pontevedra, No España)
Boletín BIGA 16 (2018). ISSN: 1886-5453 PINO PÉREZ: ASCALAPHIDAE NEMOPTERIDAE: 69-72 ALGUNOS NEURŁPTEROS (NEUROPTERA: ASCALAPHIDAE Y NEMOPTERIDAE) DE LA COLECCIŁN DE ARTRŁPODOS DE LOURIZ˘N (PONTEVEDRA, NO ESPAÑA) 1 Juan José Pino Pérez 1 Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende E-36310 Vigo (Pontevedra, España). (Recibido el 1 de marzo de 2018 aceptado el 10 de octubre de 2018) Resumen En esta nota aportamos la información de las etiquetas y otras fuentes de los ejemplares de Neuroptera (Ascalaphidae y Nemopteridae), depositados en la colección de artrópodos ABIGA, LOU-Arthr, del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra, Galicia, NO España). Palabras clave: Neuroptera, Ascalaphidae, Nemopteridae, colección ABIGA, colección LOU-Arthr, corología, Galicia, NO España. Abstract The present work gives information about the Neuroptera specimens deposited in the arthropod collection, ABIGA, LOU- Arthr, of the Centro de Investigación Forestal (CIF) of Lourizán (Pontevedra, NW Spain). Key words: Neuroptera, Ascalaphidae, Nemopteridae, ABIGA collection, LOU-Arthr collection, chorology, Galicia, NW Spain. INTRODUCCION1 portal http://www.gbif.org/, así como en la plataforma IPT (Integrated Publishing Tool-kit), disponible en Para Monserrat et al. (2014: 149), los ascaláfidos apenas http://www.gbif.es:8080/ipt/. tienen carácter antrópico y son por tanto buenos indicado- res del estado del ecosistema. En Galicia (NO España), es evidente que aquellas zonas con mayor densidad de pobla- MATERIAL Y MÉTODOS ción, las costeras en general, han perdido buena parte de Todos los ejemplares han sido recolectados mediante man- su biodiversidad debido al cambio en los usos del suelo y ga entomológica. -

Checklist of the Belgian Neuroptera
Bulletin de la Société royale belge d’Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie, 149 (2013) : 233-239 Checklist of the Belgian Neuroptera Koen LOCK1 & Gilles SAN MARTIN2 1 eCOAST Marine Research, Esplanadestraat 1, B-8400 Oostende (e-mail: [email protected]) ² Walloon Agricultural Research Centre, Life Sciences Department, Plant Protection and Ecotoxicology Unit, Rue de Liroux 2, B-5030 Gembloux, Belgium (e-mail: [email protected]) Abstract Historically, Neuroptera received a lot of attention in Belgium by entomologists such as WESMAEL, DE SELYS-LONGCHAMPS, LAMEERE and NAVAS. However, since more than a century, no updated checklist has been published. Recently, only the family Chrysopidae has been studied, while the other families belonging to the Neuroptera hardly received any attention. Here, 56 species of Neuroptera are listed for the fauna of Belgium. Six species are reported here for the first time for Belgium: Coniopteryx (Coniopteryx) borealis Tjeder, 1930, Coniopteryx (Coniopteryx) pygmaea Enderlein, 1906, Semidalis pseudouncinata Meinander 1963 (Coniopterygidae), Psectra diptera (Burmeister, 1839), Wesmaelius (Wesmaelius) quadrifasciatus (Reuter, 1894) (Hemerobiidae) and Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775 (Ascalaphidae). However, the latter one was not included in the checklist because it was not considered as an indigenous species as the only observation was either a vagrant or an imported specimen. Megalomus hirtus (Linnaeus, 1761) was misidentified and it is actually Megalomus tortricoides Rambur, 1842 (Hemerobiidae) that occurs in Belgium. The species complex Chrysopa phyllochroma Wesmael, 1841 and Chrysopa commata Kis & Ùjhelyi, 1965 clearly consists of two species, however, it seems likely that for the description of both species, holotype material of the same species was used and a revision of both species is thus needed. -

Libelloides Coccajus) Im Kanton Aargau: Aktuelles Vorkommen Und Empfehlungen Zum Artenschutz
SKK Landschaftsarchitekten AG - Postfach - Lindenplatz 5 - CH-5430 Wettingen 1 - Tel. 056 437 30 20 - Fax 056 426 02 17 [email protected] www.skk.ch Der Libellen-Schmetterlingshaft (Libelloides coccajus) im Kanton Aargau: aktuelles Vorkommen und Empfehlungen zum Artenschutz Markus Müller, Jürg Schlegel & Bertil O. Krüsi Separatdruck aus „Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft" 85: 177–199, 2012 Muller et al.qxd 3.12.2012 17:35 Uhr Seite 177 MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE 85: 177–199, 2012 Der Libellen-Schmetterlingshaft Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) (Neuropterida: Neuroptera: Ascalaphidae) im Kanton Aargau: aktuelles Vorkommen und Empfehlungen zum Artenschutz The Owly Sulphur Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) (Neuropterida: Neuroptera: Ascalaphidae) in the canton of Aargau: actual distribution and recommendations for species conservation MARKUS MÜLLER1, JÜRG SCHLEGEL2 & BERTIL O. KRÜSI2 1 SKK Landschaftsarchitekten AG, Lindenplatz 5, CH-5430 Wettingen, [email protected] 2 Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wis- senschaften, CH-8820 Wädenswil A comprehensive survey on a threatened owlfly, Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) in the canton of Aargau revealed only two remaining populations. One of them consisted of three sub- populations found within a few hundred meters, and two of them with very few individuals only. Exchanges among the three subpopulations were not investigated but seem likely. Analysis of the cur- rent land use suggests that date of mowing is crucial for the survival of L. coccajus. Mechanical de- struction of egg clutches can be avoided by mowing at the beginning of August or later. Comparison of old and recent maps (1880–2006) of all the surveyed areas revealed that the most frequent change was the replacement of vineyards by grassland. -

Neuroptera: Ascalaphidae), an Extinct Family in Poland, Have Occurred in Poland in the Past?
FRAGMENTA FAUNISTICA 52 (2): 99–103, 2009 PL ISSN 0015-9301 © MUSEUM AND INSTITUTE OF ZOOLOGY PAS What species of owlflies (Neuroptera: Ascalaphidae), an extinct family in Poland, have occurred in Poland in the past? Roland DOBOSZ Department of The Natural History, Upper Silesian Museum, Pl. Sobieskiego 2, 41–902 Bytom, Poland e-mail: [email protected] Abstract. Literature data on Ascalaphidae in Poland are critically discussed. Libelloides macaronius has never been found in the present-day territory of Poland . Libelloides coccajus most likely occurred in Poland at the end of the 18th century. Evidence for this statement comprises a drawing and a note in a manuscript of Charles de Perthées from 1802–1803. Key words: Neuroptera, Ascalaphidae, Libelloides coccajus , Libelloides macaronius , Poland, distribution, extinct species. The intensive research on the Neuropterida carried out in Poland up to the end of 1980’s revealed several species new to the Polish fauna. Nevertheless, most of the faunistic data available come from papers written 50 or even 100 years ago. Even if the data from papers published after the end of the Second World War are not to be doubted, the information from earlier times is difficult to verify. The reasons are: lack of voucher specimens and unclear data on specimens mentioned in the papers or presented on the labels. These problems mounted enormously following changes to the borders of Poland due to political and historical changes. Therefore, besides a revision of the scarce specimens and collections available, a review of the bibliographical data presented in this paper, both Polish and non-Polish, must be undertaken before the number and a list of species recorded within borders of Poland up to the Second World War can be presented. -

Lacewing News
Lacewing News NEWSLETTER OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF NEUROPTEROLOGY No. 20 Spring 2014 Presentation Hi all! Here’s the 20th issue of Lacewing News. Once again, I remember to all of you that this is NOT a formal journal for sharing scientific researches! Prof. Principi and I Only few weeks before next neuropterological symposium in Mexico: I have unsuccessfully tried to get contributions for “Who is who in neuropterology” and “Nouvelles frontiers” sections from the organizers of this important appointment, so this time that sections are not present. Any voluntary and willing contributions for next issue of LN will be greatly appreciated! From Rinaldo Nicoli Aldini So don’t hesitate and go on to send any kind of pleasant and informal news for the next issue! Please send all communications concerning Lacewing News to [email protected] (Agostino Letardi). Questions about the International Association of Neuropterology may be addressed to our current president, Dr. Michael Ohl ([email protected]). Questions about the XII IAN Symposium (http://www.neuropterology.unam.mx/) may be addressed to Atilano Contreras-Ramos ([email protected]). Ciao! I remember my first meeting with Prof. Maria Matilde Principi, on 9 March 1977. Back then I was a medical student at the local University in my hometown, Bologna. When I was not in class, I would spend time at the Institute of Entomology, located in the park surrounding the School of Agriculture. I would consult the 1 volumes of its very rich library and cultivate the be very happy to help me. She asked me to passion for insects I’d had since childhood, follow her to her office, to talk about my interest which, at the time, mostly took the form of in lacewings. -

Beitrag Zur Biologie Von Libelloides Coccajus (D&S) (Neuroptera
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. Jahr/Year: 2012 Band/Volume: 28 Autor(en)/Author(s): Dunk Klaus von der Artikel/Article: Beitrag zur Biologie von Libelloides coccajus (D&S) (Neuroptera, Ascalaphidae) 9-21 ©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.biologiezentrum.at Beitrag zur Biologie vonLibelloides coccajus (D&S) (Neuroptera, Ascalaphidae) Kl a u s v o n der Du n k Zusammenfassung Zwei Eigelege des Schmetterlingshaftes Libelloides coccajus aus dem Wallis (Schweiz) wurden untersucht. Ein Gelege war parasitiert von der Erzwespe (Chalcidoidea) Echthroplexis (Coenocercus) puncticollis Thomson, 1876, (Encyrtidae). Diese Parasit-Wirt-Kombination war bisher nicht bekannt. Abstract Two clutches of eggs from a Sulfur Owl (Ascalaphidae) were investigated. Collected in County Wallis in Southern Switzerland they probably belonged to the more frequent speciesLibelloides coccajus. The number of eggs in one clutch proved to be rather fixed. 44 eggs were counted in each of the two clutches. Photos of egg laying Ascalaphid females, published in the internet, show the same number of eggs. Morphological details are described. While one clutch developed regularly, though several larvae did not hatch, the second clutch gave birth to tiny Chalcidoid wasps. These parasitoids were determinated as Echthroplexis (Coenocercus) puncticollis Thomson, 1876, Encyrtidae, This species was known to parasitize inHemerobius only. The parasite combination with Libelloides is new to science. Key words Neuroptera, Libelloides coccajus, Ascalaphid eggs, parasitoidEchthroplexis puncticollis (Thomson, 1876) [syn.Coenocercus puncticollis Thomson, 1876.] Chalcidoidea, Encyrtidae 9 Einleitung: ©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.biologiezentrum.at Im Jahr 1992 bekam ich von Dr. -

Névroptères Ascalaphidae NÉVRO
INSECTES Névroptères Ascalaphidae NÉVRO PT È RES © J.-M. Faton J.-M. © Libelloides longicornis Position systématique Classe : Insecta Ordre : Neuroptera Famille : Ascalaphidae Présentation générale du groupe taxonomique Bien que ressemblant vaguement aux libellules, les Ascalaphes (famille des Ascalaphidae) figurent dans l’ordre des Névroptères, au même titre que les fourmilions (Myrmeleonidae) et les chrysopes (Chrysopidae), caractérisés entre autres par l’appareil buccal particulier des larves et de leurs ailes membraneuses ornées de fortes nervures. A l'état larvaire mais partiellement comme adultes aussi, les Névroptères se nourrissent d'insectes et d'acariens. De ce fait, ils jouent un rôle non négligeable dans la prédation de populations d'insectes parasites des cultures. Les larves sont caractérisées par leurs robustes pinces buccales. La famille des Ascalaphidae comporte 300 espèces dans le monde, mais une quinzaine seulement existerait en France (quelques espèces sont à confirmer). Parmi elles, seules trois espèces s’étendent au- delà du sud de la France : Libelloides longicornis , Libelloides coccajus et Libelloides lacteus . L’espèce la plus répandue en France est Libelloides longicornis , bien reconnaissable à ses nervures alaires jaunes. C’est la seule espèce présente dans la région. Eléments de biologie et d’écologie Les Ascalaphes se reconnaissent facilement parmi les autres Névroptères. Ce sont des insectes assez grands, comme les Myrmeleontidae, mais qui possèdent des antennes très longues et dilatées à leur extrémité en palette ou massue. La tête et le thorax sont très velus, et surtout leurs ailes sont généralement très colorées (fond jaune soufre ou laiteux) : ces insectes sont ainsi les seuls, au sein de cet ordre, à arborer des couleurs vives sur leurs ailes. -

Ultraviolet Vision in European Owlflies (Neuroptera: Ascalaphidae): a Critical Review
REVIEW Eur. J. Entomol. 99: 1-4, 2002 ISSN 1210-5759 Ultraviolet vision in European owlflies (Neuroptera: Ascalaphidae): a critical review Ka r l KRAL Institut fur Zoologie, Karl-Franzens-Universitat Graz, A-8010 Graz, Austria; e-mail: [email protected] Key words.Owlfly, Ascalaphus, Neuroptera, insect vision, ultraviolet sensitivity, visual acuity, visual behaviour, visual pigment Abstract. This review critically examines the ecological costs and benefits of ultraviolet vision in European owlflies. On the one hand it permits the accurate pursuit of flying prey, but on the other, it limits hunting to sunny periods. First the physics of detecting short wave radiation are presented. Then the advantages and disadvantages of the optical specializations necessary for UV vision are discussed. Finally the question of why several visual pigments are involved in UV vision is addressed. UV vision in predatory European owlflies of R7 means that the former receives only the longer The European owlflies, like Ascalaphus macaronius, wavelengths, since the short wavelengths are absorbed by A. libelluloides, A. longicornis and Libelloides coccajus the latter. However, intracellular electrophysiological are rapidly-flying neuropteran insects, which hunt in open recordings or microspectrophotometry on these tiny pho country for flying insects. These owlflies are only adapted toreceptors have not been done so their spectral sensi for daytime activity. They have large double eyes, which tivity is unknown (P. Stušek, personal communication). structurally correspond to optical refracting superposition Advantages of UV vision eyes (Ast, 1920; Gogala & Michieli, 1965; Schneider et What are the advantages of using UV light for locating al., 1978; forreview, seeNilsson, 1989). -

Том 14. Приложение Vol. 14. Supplement
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Южный научный центр RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES Southern Scientific Centre ISSN 1814−3326 CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN Том 14. Приложение Насекомые Средиземноморья: старые вопросы, новые направления исследований Vol. 14. Supplement Insects of the Mediterranean region: old questions, new research trends Ростов-на-Дону Rostov-on-Don 2018 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD Главный редактор Кирилл Глебович Михайлов Максим Витальевич Набоженко Dr Kirill Glebovich Mikhailov Editor-in-chief Зоомузей МГУ, ул. Большая Никитская, 6, Москва 125009 Россия Dr Maxim Vitalievich Nabozhenko Zoological Museum, Moscow Lomonosov State University, Bolshaya Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского Nititskaya str., 6, Moscow 125009 Russia научного центра Российской академии наук, ул. М. Гаджиева, 45, Махачкала, Республика Дагестан 367000 Россия Владимир Иванович Ланцов Caspian Institute of Biological Resources of Dagestan Scientific Centre Dr Vladimir Ivanovich Lantsov of the Russian Academy of Sciences, M. Gadzhiev str., 45, Makhachkala, Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН, Republic of Dagestan 367000 Russia ул. И. Арманд, 37а, Нальчик 360051 Россия Дагестанский государственный университет, ул. М. Гаджиева, 43а, A.K. Tembotov Institute of Ecology of Mountainous Territories of the Russian Махачкала, Республика Дагестан 367000 Россия Academy of Sciences, I. Armand str., 37a, Nalchik 360051 Russia Dagestan State University, M. Gadzhiev str., 43a, Makhachkala, Republic of Dagestan 367000 Russia Dr Zsolt Bálint Hungarian Natural History Museum, Baross utca 13., or 1431, Pf. 137., Ответственный редактор Budapest 1088 Hungary Игорь Владимирович Шохин Managing editor Dr Jan Bezděk Dr Igor Vladimirovich Shokhin Mendel University, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Apiculture, Zemědělská, 1, Brno CZ-613 00 Czech Republic Российской академии наук, пр.