Praktikumsbericht Evobus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Weltpremiere Concept EQV: Mercedes-Benz Zeigt Ausblick Auf
Après-Vente Communiqué Un Sprinter atelier mobile à Perpignan 25 juillet 2019 La concession Monopole Automobliles (Groupe LG Automobiles) met en service un Sprinter « atelier mobile » pour réparer les clients VP, VUL et VI « flottes » dans un rayon de 80 kilomètres autour de Perpignan. Perpignan – La concession Monopole Automobiles (groupe LG Automobiles) vient de mettre en service un Sprinter pas comme les autres. Aménagé par la société Luro en atelier mobile, ce Sprinter316 37S sillonne l’agglomération perpignanaise pour effectuer des réparations au plus près des clients VP, VUL et VI. Pour Benoît Lopez, responsable après-vente de Monopole Automobiles, « Nos entreprises clientes n’ont plus envie mobiliser du personnel et de perdre plusieurs heures à déplacer leurs camions jusqu’à l’atelier. Nous avons donc décidé de venir à eux. Cela nous permet par ailleurs de désengorger notre atelier, gagner des mètres carrés et donner davantage d’autonomie à nos techniciens qui se sont, sans hésiter, portés volontaires. » Vidange, disques, plaquettes etc. : le Sprinter stické « Atelier à domicile » dispose de tout le nécessaire pour dépanner ou réaliser l’entretien des voitures particulières, utilitaires légers, camions mais aussi des bus et des autocars. Valise de diagnostic, caisses à outils pour chaque type de véhicule, récupérateur d’huile auxquels s’ajoutent les pièces détachées préalablement commandées pour la réparation des véhicules. Cette organisation très efficace permet au Sprinter d’entretenir ou réparer jusqu’à neuf véhicules – tout type confondu - en une journée. Monopole Automobiles propose au démarrage exclusivement ce service aux clients flottes, mais n’exclut pas de l’étendre aux particuliers et aux possesseurs de camions d’autres marques que Mercedes-Benz. -

Die Zukunft Der Automobiltechnik the Future of Automotive Technology 19. VDA Technischer Kongress 19Th VDA Technical Congress
19. VDA Technischer Kongress 19 th VDA Technical Congress Programm Program 5./6. April 2017, Kosmos, Berlin April 5 – 6, 2017, Kosmos, Berlin Finales Programm Final Program! Melden Sie sich jetzt an! please register now! www.vda.de/ technischer-kongress Die Zukunft der Automobiltechnik The Future of Automotive Technology Kongress-Premiumpartner Kongress-Partner Kongress-Unterstützer TECHNISCHER KONGRESS 2017 • TECHNICAL CONGRESS 2017 3 lierung beleuchten. Wir wollen die derzeit so intensiv diskutierte Zukunft des Verbrennungsmotors und die zunehmende Elektrifizierung der Antriebe thematisie- ren. Die Automobilindustrie sucht nach Lösungen für die umweltfreundliche Mobilität und nach Wegen zur Erreichung der CO2-Reduktionsziele des Straßenver- kehrs. Dabei spielen die klassischen Verbrennungs- motoren eine ebenso bedeutende Rolle, wie neue Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Natürlich wollen wir uns auch mit der neuen anspruchsvollen Abgasge- setzgebung auseinandersetzen und Wege zu deren Erfüllung aufzeigen. Ergänzt wird unsere Antriebs- strategie durch Konzepte zur De-Karbonisierung der Kraftstoffe wie z.B. E-Fuels. Des Weiteren stehen derzeit wichtige Entscheidungen Matthias Wissmann, Präsident des VDA bei der Weiterentwicklung der Fahrzeugsicherheit an. In Brüssel werden 2017 die Weichen für die Fort- schreibung der „General Safety Regulation“ gestellt. Dies wird nicht nur Auswirkungen auf Europa, son- dern auch auf andere Länder wie Japan, Korea, Indien, Russland und China haben. Darüber hinaus nehmen in einem der weltweit wichtigsten Verbrau- cherschutzkonsortien im Bereich der Fahrzeugsicher- am 25. und 26. Februar 2010 wird der 9. VDA-Logistikkongress im Congress Center Leipzig den Teilnehmern die Möglichkeit zu umfassender Information und Kommunikation bieten. Besonders heit,in der aktuellenEuro NCAP,Situation die Überlegungen zur Weiterent- derSehrAutomobilindustrie geehrte Damenwird der undAustausch Herren,von Erfahrungen, Strategien und LösungenMatthiaswichtigeWissmann,BeiträgePräsidentzurdes VDA Sicherstellung des Unternehmenserfolgs leisten. -

Annual Report 1998 Daimlerchrysler 98 98 98 97 96 DM 1) US $ 2) € € € Amounts in Millions
Merger of Growth Annual Report 1998 DaimlerChrysler 98 98 98 97 96 DM 1) US $ 2) € € € Amounts in Millions Revenues 257,744 154,615 131,782 117, 572 101,415 Europe 94,794 56,868 48,468 42,115 37,270 United States 127,716 76,616 65,300 56,615 49,485 Other markets 35,234 21,136 18,014 18,842 14,660 Employees (at Year-End) 441,502 425,649 418,811 Research and Development Costs 13,090 7,853 6,693 6,501 5,751 Investments in Property, Plant and Equipment 15,950 9,568 8,155 8,051 6,721 Cash Provided by Operating Activities 32,625 19,571 16,681 12,337 9,956 Operating Profit 16,807 10,082 8,593 6,230 6,212 Net Operating Income 12,862 7,716 6,576 5.252 - Net Income 9,428 5,656 4,820 4,057 3) 4,022 Per Share 10.09 6.05 5.16 4.28 3) 4.24 Net Income Adjusted 4) 10,212 6,126 5,221 4,057 - Per Share Adjusted 4) 10.90 6.55 5.58 4.28 - Total dividend 4,608 2,764 2,356 - - Dividend per Share 4.60 2.76 2.35 - - 1) Conversion rate: € 1 = DM 1.95583 2) Rate of exchange: € 1 = US $ 1.1733 (based on the noon buying rate on Dec. 31, 1998 of US $1 = DM 1.6670 and the conversion rate of € 1 = DM 1.95583); the average US $/DM rate of exchange in 1998 was 1.7597. -
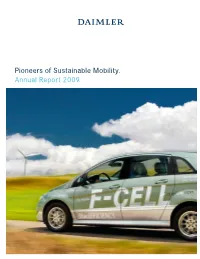
Daimler Annual Report 2009
Pioneers of Sustainable Mobility. Annual Report 2009. Key Figures Daimler Group 2009 20082007 09/08 Amounts in millions of € % change Revenue 78,924 98,469 101,569 -20 1 Western Europe 36,458 46,276 49,753 -21 thereof Germany 18,788 21,832 22,582 -14 NAFTA 19,380 23,243 25,136 -17 thereof United States 16,569 19,956 21,846 -17 Asia 12,435 13,840 11,918 -10 thereof China 4,349 3,226 1,951 +35 Other markets 10,651 15,110 14,762 -30 Employees (December 31) 256,407 273,216 272,382 -6 Investment in property, plant and equipment 2,423 3,559 2,927 -32 Research and development expenditure 4,181 4,442 4,148 -6 thereof capitalized 1,285 1,387 990 -7 Cash provided by (used for) operating activities (including discontinued operations) 10,961 (786) 7,146 . EBIT (1,513) 2,730 8,710 . Value added (including discontinued operations) (4,644) (1,147) 1,380 . Net profit (loss) (2,644) 1,414 3,985 . Net profit (loss) from continuing operations (2,644) 1,704 4,855 . Earnings (loss) per share (in €) (2.63) 1.41 3.83 . Earnings (loss) per share, continuing operations (in €) (2.63) 1.71 4.67 . Total dividend 0 556 1,928 . Dividend per share (in €) 0.00 0.60 2.00 . 1 Adjusted for the effects of currency translation and changes in the consolidated group, decrease in revenue of 21%. With the B-Class F-CELL, Mercedes-Benz is the world’s first manufacturer to put a fuel-cell car on the road that was produced under series conditions. -

Environmental Statement 2020 Evobus Gmbh Neu-Ulm Location 2 Environmental Statement 2020
Environmental Statement 2020 EvoBus GmbH Neu-Ulm Location 2 ENVIRONMenTAL STATEMenT 2020 Inhalt 3 Preface 4 The Neu-Ulm Location 10 Our Environmental Policy 12 Environmental Management System 16 Environmental Aspects 18 Our Environmental Program 22 Figures, Data, Facts 36 Validity Declaration Legal Information: Responsible Chief Environmental Officer: Dr. Oytun Hanhan, BUS/OPP Responsible Editor: Dr. Oytun Hanhan Department BUS/OPP Telephone: +49 731 181 2150 Fax: +49 711 1779091110 E-mail: [email protected] Head of Production and Chief Environmental Officer of Daimler Buses: Dr. Marcus Nicolai Printout permitted if reference source is indicated precisely. ENVIRONMenTAL STATEMenT 2020 3 Preface In the spirit of “Arriving today – thinking about tomorrow”, we aim for sustainability along the entire bus line. Our objective is to integrate this as a fixed integral part of our actions in all business processes. With our consistent sustainability strategy and the objective of producing environmentally acceptable and safe buses in an environmentally friendly manner, we are setting benchmarks in terms of safety, quality, design, environmental protection and energy management. The new energy and environmental objective system for the sustainable further development of the product and the entire product creation process adopted by the Daimler Board of Management in April 2018 was revised in April 2019. The objective system will continue to be implemented worldwide within Daimler Buses at all relevant production locations together with the tracking of the achievement of objectives. For the continuous improvement of our environmental management system, we have the effective- ness checked externally according to EMAS, the regulation issued by the European Union for a voluntary environmental management system. -

Table of Contents
Table of Contents Plenary Session Cold fire: how living organisms use bioluminescence and what we can learn from this Dr. S. Kircher, Institut fur Biologie II, Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Freiburg im Breisgau 1 project i - the BMW Group's response to the future challenges of sustainable and personal mobility Dr. J. Topker, BMW Group, Munchen 5 Use of fiber-reinforced plastics in the sports industry: trends and challenges Dipl.-lng. F. Huber, KTM Technologies GmbH, Salzburg/Anif, Austria 9 Polymer nanocomposites: their potential for the automotive industry Prof. Dr.-lng. K. Schulte, Institut fur Kunststoffe und Verbundwerkstoffe, Technische Universitat Hamburg-Harburg 23 Future vehicle concepts: plastics in a supporting role Univ.-Prof. Dr.-lng. L. Eckstein, Dipl.-lng. L. Ickert, Institut fur Kraftfahrzeuge (ika), RWTH Aachen University 31 Plenary Session - Electromobility Polymers in the Opel Ampera Rechargeable Energy Storage System M. E. Carroll, D. A. Okonski, K. Sonta, General Motors Company, Warren, Michigan, USA; Dr. R. Langendorf, Dr. M. Kueppers, Adam Opel AG, Russelsheim 43 Plastics for electromobility - Charging plugs for electric vehicles Dipl.-lng. B. Deutschen, Dipl.-Wirt.-lng. B. Horrmeyer, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg 61 Interior The future cockpit concept as exemplified in the BMW 1 Series and 3 Series Dipl.-lng. (FH) T. Reisch, Dr.-lng. T. Pflamm-Jonas, BMW Group Landshut; Dipl.-lng. T. Radlewitz, Dipl.-lng. R. Steiger, BMW Group Munich 71 Components with an acoustic effect in vehicles and the corresponding technologies Prof. Dr. N. Nicolai, HP Pelzer Group, Witten 83 http://d-nb.info/1021524514 Transparent liquid silicone rubbers for lighting applications in automotive engineering Dipl.-lng. -
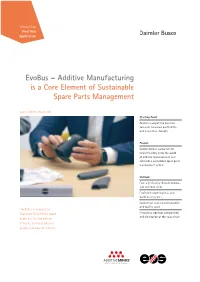
Evobus – Additive Manufacturing Is a Core Element of Sustainable Spare Parts Management
Consulting: Find Your Application EvoBus – Additive Manufacturing is a Core Element of Sustainable Spare Parts Management Source: Daimler Buses, EOS Starting Point Growing competitive pressure demands increased profitability and innovative strength Project Comprehensive consulting to help efficiently enter the world of additive manufacturing and establish a sustainable spare parts management system Outlook Fast: significantly reduced produc- tion and lead times Profitable: lower logistics and warehousing costs Economical: avoid overproduction and tooling costs Flexibility in production: Thanks to 3D printing, spare Innovative: optimize components and digitization of the value chain parts, e.g. for the interior of buses, can be produced quickly and cost-efficiently. Establishing a Sustainable Spare Parts Management System with field of Customer Services & Parts “The close cooperation between Daimler Buses (CSP) would be far more difficult Additive Manufacturing for EvoBus GmbH. By contrast, and Additive Minds enables us to fully exploit the company sees a great deal of the potential offered by additive manufacturing potential in the production flexibility offered by additive manufacturing: EvoBus GmbH, a subsidiary of the Daimler Group, is one of the leading in the CSP field by defining key steps to defend “By implementing 3D printing within manufacturers in the global omnibus segment. In order to continue Short Profile our CSP business model, we hope to our pioneering position on the bus market and expanding its pioneering role in times of increasing competi tive EvoBus GmbH is the largest reduce the rising warehousing and expand this position in the long term.” pressure, EvoBus is pursuing two strategic aims: sustainably increase European subsidiary of tool costs caused by our growing its profitability and enhance its capacity to innovate. -

La RSE Au Sein De Daimler Buses – Evobus France Un Engagement Fort Au Quotidien ! La RSE Au Sein De Daimler Buses : Un Engagement Fort Au Quotidien
La RSE au sein de Daimler Buses – EvoBus France Un engagement fort au quotidien ! La RSE au sein de Daimler Buses : un engagement fort au quotidien 1. Les 4 piliers de la RSE au sein du groupe Daimler 2. Daimler Buses et la RSE 3. Pilier n°1 : les véhicules 4. Pilier n°2 : Services de mobilité 5. Pilier n°3 : Digitalisation 6. Pilier n°4 : Respect des droits de chacun Daimler Buses Présentation RSE EvoBus France | Marketing et Communication | 2019 Page 2 Le groupe Daimler, un acteur engagé dans le développement durable Le développement durable constitue un aspect important de notre vision d’entreprise. Il implique la compatibilité de nos intérêts économiques, écologiques et sociétaux. Fidèles à notre mot d’ordre « Réaliser les objectifs d’aujourd’hui. Penser à demain », nous contribuons par nos activités de développement durable à la résolution des enjeux planétaires de notre temps. Nous soutenons activement les 17 objectifs pour le développement durable de l’ONU. *Source : globalcompact-france.org Daimler Buses Présentation RSE EvoBus France | Marketing et Communication | 2019 Page 3 Les préoccupations sociétales et environnementales : au cœur de notre ADN La RSE au coeur de notre ADN La RSE est une de nos valeurs clés et est profondément ancrée dans notre entreprise. L’engagement sociétal fait partie de notre culture d’entreprise et est mis en place à travers toutes nos unites par de nombreux employés. Ce sont eux qui agissent au niveau local. Et chaque année, ils mettent en place de nouvelles initiatives. Penser mondialement et agir localement Chacun des sites du groupe Daimler met en place des projets et programmes adaptés à leurs activités locales, que ce soit pour des donations, des sponsorings, des activités bénévoles avec une dimension supra-régionale ou de petites initiatives par équipes. -

Werkstattinformation Informations D´Atelier Informazioni Di Officina Workshop-Information Información De Taller
Werkstattinformation Informations d´atelier Informazioni di officina Workshop-information Información de taller Marke MB/TRAVEGO Gruppe 54.286 Verteiler D Datum 19.08.04 WI-Nr. 04/009 Marque Groupe Distribution Date WI-N°. Marchio SETRA/ Gruppo Distribuzione Data WI-N. Brand Group Distribution Date WI-No. Marca TopClass 400 Grupo Distribución Fecha WI-N°. ComfortClass 400 Replaces WI 02/002/3 – supplement to “Automated programming” item added, extended to include ComfortClass 400 bus model EvoBus-specific cables for Star diagnosis (SD) and their usage 1. Use of connection cable for Star diagnosis (SD) (diagnosis interfaces on vehicle) and use of replacement adapter (FPS self-sealing connector) 2. Job instructions for FPS download 3. Job instructions for DMUX download 4. Job instructions for "Automated parameter setting" 5. Job instructions for self-sealing 1.) Use of connection cable for Star diagnosis (SD) (diagnosis interfaces on vehicle) and use of replacement adapter (FPS self- sealing connector) Various connection cables are available as accessories for Star diagnosis. Their usage in the field is not always clear. 1.1 Download cable for the FPS download W 628 589 02 63 00 (refer to W number on download cable) This cable is intended for connecting to the 9-pin download socket (05X02) in the E box, driver's cab. The cable is used to download FPC electronics. 1.2 Combi download cable for the DMUX download W 000 589 838 63 00 (refer to W number on download cable) N DMUX (Display Multiplexer) combination instrument (driver's cab) EvoBus GmbH 1 – 54.286/4 AST This cable is required for the DMUX download and is also connected to the 9-pin download socket (05X02) in the E box, driver's cab. -
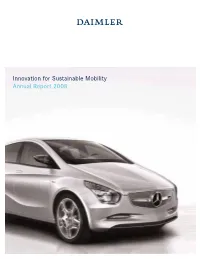
Innovation for Sustainable Mobility Annual Report 2008 Key Figures
Innovation for Sustainable Mobility Annual Report 2008 Key Figures Daimler Group 2008 20072006 08/07 Amounts in millions of € Change in % Revenue 95,873 99,399 99,222 -41 Western Europe 45,916 49,289 46,999 -7 thereof Germany 21,817 22,582 21,652 -3 NAFTA 21,139 23,499 27,857 -10 thereof United States 17,922 20,270 24,943 -12 Other markets 28,818 26,611 24,366 +8 Employees (Dec. 31) 273,216 272,382 274,024 +0 Investment in property, plant and equipment 3,559 2,927 3,005 +22 Research and development expenditure 4,442 4,148 3,733 +7 thereof capitalized 1,387 990 715 +40 Cash provided by operating activities (including discontinued operations) 3,205 13,088 14,337 -76 EBIT 2,730 8,710 4,992 -69 Value added (including discontinued operations) (1,147) 1,380 631 . Net profit 1,414 3,985 3,783 -65 Net profit from continuing operations 1,704 4,855 3,166 -65 Earnings per share (in €) 1.41 3.83 3.66 -63 Earnings per share, continuing operations (in €) 1.71 4.67 3.06 -63 Total dividend 556 1,928 1,542 -71 Dividend per share (in €) 0.60 2.00 1.50 -70 1 Adjusted for the effects of currency translation and changes in the consolidated group, decrease in revenue of 1%. Cover: Mercedes-Benz showed the way ahead in environmentally responsible electro-mobility in January 2009 by presenting its near-series Concept BlueZERO at the North American International Auto Show in Detroit. -

Press Kit (English)
PRESS KIT EXPO DAY 6 July 16th, 2019 Startup Autobahn is not just an innovation platform; it is a platform that continues to innovate itself. Table of contents: Europe’s biggest innovation platform is growing and Startup Autobahn’s Expo Day reveals new projects .......................................................................................................2 Webasto presents innovation projects together with young enterprises at sixth EXPO Day of Startup Autobahn .........................................................................................................5 T-Systems celebrates 100 days of partnership with STARTUP AUTOBAHN .......................7 AND vs. BUT: The value of partnerships for Linde Digitalization. .......................................9 Wieland Ventures continues and broadens its active involvement and partnership in the startup ecosystem via Startup Autobahn ......................................................................11 TÜV Rheinland Expands Partnership with Start Up Accelerator Plug and Play to U.S. ...13 Schnellecke Logistics- Ecosystem Partner since March 2019 .........................................15 STARTUP AUTOBAHN: into the seventh round with "THE NEXT GREEN THING" ............17 100 days of innovation platform STARTUP AUTOBAHN: holoride passes tests in Porsche, Mercedes-Benz and EvoBus vehicles ...........................................................................23 Porsche presents VR entertainment for the back seat with “holoride” ........................... 26 +++ Embargo +++ -

Daimler AG Jahresabschluss 2020 Einzelabschluss
Jahresabschluss 2020 Daimler AG Titelmotiv Der VISION EQS gibt einen Ausblick auf zukünftige große elektrische Luxuslimousinen. Mercedes-EQ setzt mit diesem Fahrzeug ein klares Statement für progressiven Luxus. Wir sind davon überzeugt, dass handwerkliche Perfektion, emotionales Design, luxuriöse Materialen und individueller Fahrspaß auch in Zukunft begehrenswert bleiben. Daimler AG Jahresabschluss 2020 Der Lagebericht der Daimler AG und der Konzernlagebericht sind nach § 315 Abs. 5 HGB zusammengefasst und im Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht. Der Jahresabschluss und der mit dem Konzern lagebericht zusammengefasste Lagebericht der Daimler AG für das Geschäftsjahr 2020 werden beim Betreiber des Bundes anzeigers eingereicht und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Jahresabschluss der Daimler AG sowie der Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2020 stehen auch im Internet unterw www.daimler.com/investoren/ berichte-news/ zur Verfügung. JAHRESABSCHLUSS 2020 DER DAIMLER AG | InhalTsveRzeiChnis 5 Inhaltsverzeichnis A | Bilanz der Daimler AG 6 Sonstige Angaben 20 – 47 Personalaufwand/ Beschäftigte 20 B | Gewinn- und Verlustrechnung der Materialaufwand 20 Daimler AG 7 Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten 21 Haftungsverhältnisse 23 C | Anhang der Daimler AG 8 –10 Nachhaftung 24 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 24 Grundlagen und Methoden 8 Beziehungen zu nahestehenden Personen und Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 8 Unternehmen gem. § 285 Nr. 21 HGB 24 Entwicklung des Anlagevermögens 10 Nachtragsbericht 24 Rechtliche