Verleihung Der Karl-Weyprecht-Medaille an Professor Dr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

IOC. Executive Council; 23Rd Session; (Report); IOC. Reports of Governing
Intergovernmental Oceanographic Commission Reports of Governing and Major Subsidiary Bodies Twenty-third Session of the Executive Council Paris, 7-14 March 1990 Unesco lOC/EC-XXI 11/3 Paris, 15 May 1990 Original: English In this Sortes Languages Reports of Governing and Major Subsidiary Bodies, which was initiated at the beginning ol 1984, the reports of the following meetings have already been issued: 1. Eleventh Session of the Working Committee on international E. F. S. R Oceanographic Data Exchange 2. Seventeenth Session of the Executive Council E, F, S. R. Ar 3. Fourth Session of the Working Committee for Training, E, F. S. R Education and Mutual Assistance 4. Fifth Session of the Working Committeo for the Global E, F, S, R Investigation of Pollution in the Marine Environment 5. First Session of the IOC Sub-Commission for the Caribbean E, F, S and Adjacent Regions 3. Third Session of the ad hoc Task Team to Study the Implications, E, F, S. R lor the Commission, of the UN Convention on the Law of the Soa and the New Ocean Regime 7. First Session of the Programme Group on Ocean Processes E, F. S, R and Climate 8. Eighteentli Sossion of the Exocutivo Council E, F. S. R, Ar 9. Thirteenth Sossion of the Assombly E. F. S, R, Ar 10. Tonth Sossion of the International Co-ordination Group G. F. S, R for the Tsunami Warning System in the Pacific 11. Nineteenth Session of tho Executive Council E, F, S. R. Ar 12. Sixth Session of tho IOC Scientific Committee for tho Global E. -

The Expedition ARKTIS-Xvl2 of "Polarstern" in 1999 Edited
The Expedition ARKTIS-XVl2 of "Polarstern" in 1999 Edited by Wilfried Jokat with contributions of the participants Ber. Polarforsch. 368 (2000) ISSN 0176 - 5027 Contents ARK XVl2 Tromsoe .Tron~soe 2 1 July .08 September 1999 Summary ............................................................................................................................2 Meteorological conditions ..................................................................................................5 Marine Geophysics ...........................................................................................................8 Marine Geology ...............................................................................................................27 Subbottom profiling using PARASOUND ......................................................................29 Geological sampling .........................................................................................................40 Sediment characteristics ...................................................................................................43 Smear-slide analyses ........................................................................................................46 Watersampling for Ra-226 analysis .................................................................................47 Summary ..........................................................................................................................47 Physical Properties of the Sediments ..............................................................................48 -

The Crew of the Alliance
NEWSLETTER 1/2019 THE CREW OF THE ALLIANCE ZMT’s involvement in the European Union’s All Atlantic Research Alliance ON EXPEDITION Water does not respect national borders. When the world’s most important ocean current – thermohaline circulation, which links all the oceans with one another – alters due to climate change or transports ever more plastic waste, the effects are felt by all the nations on Earth. It is time for an alliance, for a global fleet of ocean researchers, for joint expeditions. The European Union’s aim in creating the All Atlantic Research Alliance is to pool re- search on the entire North and South Atlantic, embracing not only Arctic and Antarctic wa- ters but also the Caribbean Sea. To ensure the successful launch of this flagship, an ex- perienced crew is needed, which includes ZMT. Since the German-South African Year of Science in 2012, the Bremen institute has also inspired this extensive collaboration. Based on long-term, joint research projects in southern Africa and Brazil – countries that are linked by the major currents in the South Atlantic – ZMT and its collaborative partners, the German Marine Research Consortium and the French IFREMER, brought these partners together with the EU and thus helped to get the so-called Belém Statement signed in 2017. After the signing of the Galway Statement on Atlantic Ocean Cooperation for the North Atlantic in May 2013, the efforts of the EU Alliance have now been extended to the South Atlantic as well. The ideas for joint research activities amongst the 17 institutes currently involved in nine countries on three continents include, for instance, cooperation on climate variability, ocean monitoring and ocean pollution, fisheries management, aquaculture and polar research. -

Professor Gotthilf Hempel's 90Th Birthday
2020 Fisheries Centre Research Reports 28(2) PROFESSOR GOTTHILF HEMPEL’S 90TH BIRTHDAY* Daniel Pauly Sea Around Us, Institute for the Oceans and Fisheries, 2202 Main Mall, University of British Columbia, Vancouver, Canada [email protected] Abstract This brief contribution presents an English translation followed by the original German text of the short speech given by the author on behalf of the graduate students of Professor Dr. Gotthilf Hempel on April 4, 2019, at the celebration of his 90th birthday in Bremen’s City Hall. A list of the doctoral theses supervised by Professor Hempel is appended. Introduction On April 4, 2019, an event was held in Bremen’s City Hall to celebrate the 90th birthday of Professor Gotthilf Hempel (https://en.wikipedia.org/wiki/Gotthilf_Hempel; Figure 1). This contribution presents the short speech the author gave on behalf of Professor Hempel’s many graduate students (Figure 2; also see Appendix), first in an English translation, then in the original German. English translation Ladies and Gentlemen: In addition to science and institute-building, Professor Hempel has had many students. There have been some 70 doctoral students and uncounted MSc students. That's a whole lot. I am here to speak on their behalf. Although I am now an old man, I was young once, and Figure 1. Professor Gotthilf Hempel with one of his Professor Hempel was both my MSc and doctoral former doctoral students, Dr. Cornelia Nauen (Photo: David Grémillet) supervisor. I asked some of my former classmates about their experiences with Professor Hempel and each shared with me a different story. -

CRUISE REPORT: ARK-II 3 Highlights
CRUISE REPORT: ARK-II_3 (Updated JAN 2013) Highlights Cruise Summary Information WOCE Section Designation ARK-II_3 Expedition designation (ExpoCodes) 06AQ19840719 Alias ARCHY, ARKTIS II/3, NFS Chief Scientists Gotthilf Hempel Ret. / AWI Dates 1984 Jul 19 - 1984 Aug 7 Ship FS Polarstern Ports of call Longyearbyen, Norway - Tromsö, Norway 82° 46' N Geographic Boundaries 10° 38.6' W 18° 35.3' E 76° 20' N Stations 32 Floats and drifters deployed 0 Moorings deployed or recovered 0 Contact Information: Alfred-Wegener-Institut P.O. Box 12 01 61 27515 Bremerhaven Links To Select Topics Shaded sections are not relevant to this cruise or were not available when this report was compiled. Cruise Summary Information Hydrographic Measurements Description of Scientific Program CTD Data: Geographic Boundaries Acquisition Cruise Track (Figure): PI CCHDO Processing Description of Stations Calibration Description of Parameters Sampled Temperature Pressure Bottle Depth Distributions (Figure) Salinities Oxygens Floats and Drifters Deployed Bottle Data Moorings Deployed or Recovered Salinity Oxygen Principal Investigators Nutrients Cruise Participants Carbon System Parameters CFCs Problems and Goals Not Achieved Helium / Tritium Other Incidents of Note Radioisotopes Underway Data Information References Navigation Bathymetry Nutrients Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) CFCs Thermosalinograph Carbon System Parameters XBT and/or XCTD Meteorological Observations Acknowledgments Atmospheric Chemistry Data Data Report Processing Notes 3. WASSERMASSEN IN DER FRAM-STRASSE UND IM NORDPOLARMEER WATER MASSES IN FRAM STRAIT AND IN THE ARCTIC OCEAN Dritter Fahrtabschnitt (Third Cruise Leg) des FS Polarstern: Arktis 11/3 Fahrtleiter (Chief Scientist): Gotthilf Hempel (AWI)* 3.1. Aufgaben Die Fraxn-Straße zwischen Grönland und Spitzbergen ist die einzige Tiefwasserverbindung zwischen dem Arktischen Ozean und dem übrigen Weltmeer. -
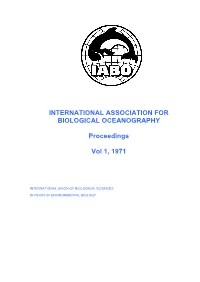
IABO Proc Until 1971
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY Proceedings Vol 1, 1971 INTERNATIONAL UNION OF BIOLOGICAL SCIENCES DIVISION OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY IABO is an association under the Division of Environmental Biology of the International Union of Biological Sciences (IUBS). It is affiliated to the Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR). THE EXECUTIVE COMMITTEE President: Professor Dr. Gotthilf Hempel Institut für Meereskunde an der Universität Kiel 23 KIEL Niemannsweg 11 Germany (F.R.G.) Secretary: Dr. Torben Wolff Zoological Museum Universitetsparken 15 DK 2100 COPENHAGEN 0. Denmark Past President and Treasurer: Mr. Ronald I. Currie Scottish Marine Biological Association Dunstaffnage Marine Research Laboratory P. 0. Box 3 OBAN, Argyll Scotland Dr. R. C. Dugdale Ex officio: University of Washington Dr. M. Ruivo Department of Oceanography Secretary ACMRR SEATTLE, Washington 98105 Food and Agriculture Organization of the U. S. A. UN Via delle Terme di Caracalla Professor R. Marumo ROME Ocean Research Institute Italy University of Tokyo Minamidai Adviser: NAKANOKU Dr. C. E. Lucas J a p a n Department of Agriculture and Fisheries for Scotland Professor Petr. A. Moiseev Marine Laboratory AURI P.O. Box 101 VNIRO Victoria Road 17, Krasnoselskaya TORRY, Aberdeen MOSCOW B-140 Scotland U. S. S. R. CONTENTS 1. Preface 2. The Establishment of IABO 3. Statutes of IABO 4. National Correspondents List of IABO National Correspondents 5. Report of the 2nd General Meeting, Tokyo, 1970 Income and Expenditure Account 6. Report of Executive Meetings, Kiel, 1971 7. Report of Meeting of National Correspondents, Kiel, 1971 8. Report of the IABO Symposia, Tokyo, 1970 9. -

Newsletter 1/2012 HAPPY BIRTHDAY
Newsletter 1/2012 HAPPY BIRTHDAY Newsletter 1/2012 Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT) GmbH Leibniz Center for Tropical Proud of ZMT's success: founding director Gotthilf Hempel, present director Marine Ecology Hildegard Westphal and former director Venugopalan Ittekkot Fahrenheitstrasse 6 D-28359 Bremen Dear colleagues, dear friends and partners of ZMT, dear alumni, Telefon: +49 (421)23800-21 Fax: +49 (421)23800-30 A happy new year to you all! In 2012, ZMT is launching a newsletter that will inform you twice a year about new developments, projects, and people at ZMT. We invite E-Mail:[email protected] you to enjoy the news and follow the links given in the texts that lead you to the ZMT www.zmt-bremen.de web presentations. Celebrating an impressive past ZMT turned 20 in 2011. The past year has thus offered us the opportunity to reflect on the impressive development of our institute – its growth, its path into the Leibniz Association, the uniqueness of its approach – and to celebrate! On the 4th of November, many dear guests from all over the world honoured us with their presence and attended the function and talks at the large concert hall “die Glocke” in Bremen. We enjoyed the reflections of founding director Gotthilf Hempel and former director Venugopalan Ittekkot, the speeches by Leibniz president Karl Ulrich Mayer and the Senator for Education and Science in Bremen, Renate Jürgens-Pieper, as well as the talk by Indra Jaya, Dean of the Department of Fisheries and Marine Sciences at Bogor University. It was also a great opportunity to meet former and current colleagues, partners, and friends. -

„Ich Wollte Etwas Bewegen“ Kiel – „Vielfalt Leben“ Ist Das Motto Von „Campus In- Ternational“, Einer Veran- Forscher, Lehrer, Botschafter Und Macher: Prof
Donnerstag, 9. April 2009 24 Kieler Hochschulen Nr. 84 CAMPUS-NEWS Improvisationstheater mit „Tante Salzmann“ „Ich wollte etwas bewegen“ Kiel – „Vielfalt leben“ ist das Motto von „campus in- ternational“, einer Veran- Forscher, Lehrer, Botschafter und Macher: Prof. Gotthilf Hempel feierte seinen 80. Geburtstag staltungsreihe, die das Präsidium der CAU zu- Kiel – Dass er 80 Jahre alt gelangte Hempel 1967 nach fie. Trotzdem ist er seit 1952 sammen mit dem Studen- geworden ist, sieht und Kiel, das für ihn trotz nach glücklich mit der Meeresbio- tenwerk Schleswig-Hol- merkt man ihm nicht an. wie vor weitreichender „Ne- login Dr. Irmtraut Hempel stein und dem AStA der Noch immer steckt Prof. benbeschäftigungen“ in an- verheiratet und gründete mit CAU ins Leben gerufen Gotthilf Hempel voller deren Städten der erklärte ihr eine Familie mit zwei Söh- hat, um das Interesse an In- Heimathafen ist. nen und mittlerweile fünf En- ternationalität zu fördern Elan und intellektueller Am damaligen Institut für kelkindern. und die Integration aus- Kraft. Beides konnte der Meereskunde war der gebür- 80 Jahre und Aber auch wissenschaftlich ländischer Studierender große alte Mann der Kieler tige Göttinger nicht nur Inha- kein bisschen kann Hempel, der mehr als zu unterstützen. Die Auf- Meeresforschung in seiner ber des Lehrstuhls für Fische- leise: Prof. 1000 Tage auf „Polarstern“, taktveranstalung mit dem 60-jährigen akademischen reibiologie, sondern auch vier Gotthilf Hem- „Meteor“ und anderen For- Improvisationstheater Laufbahn gut gebrauchen. Jahre geschäftsführender Di- pel ist immer schungsschiffen verbrachte, „Tante Salzmann“ findet Hempel war federführend rektor. Diesen Job muss er gut noch eine Grö- auf eine respektable Nach- am 16. -

Erinnerungen an Ein Halbes Jahrhundert Deutscher
www.ssoar.info Erinnerungen an ein halbes Jahrhundert deutscher Meeresforschung Hempel, Gotthilf Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Hempel, G. (2016). Erinnerungen an ein halbes Jahrhundert deutscher Meeresforschung. Deutsches Schiffahrtsarchiv, 39, 9-28. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-57922-4 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie -

Of Marine Fish
MASkU-T-79-003 C. 2 EARLY LIFE HISTORY OF MARINE FISH The Egg Stage GotthilfHempel gQ I3$-;;,~at<i t;.-.C SitGPJ prier Copyright 0 1979 by the Division of Marine Resources/University of Washington. Printed in the United States of America. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without Permission in writing f'rom the publisher. The series of lectures on which this publication is based were supported by grant number 04-5-158-58 from the National Oceanic and Atmospheric Administration to the Washington Sea Grant Program. The U.S, Government is authorized to produce and distribute reprints for governmental purposes notwithstanding any copyright notation that may appear hereon. Library of Congress Cataloging in Publication Data Hempel, Gotthilf Early life history of marine fish Bib!i ography: p. 1. Marine fishes--Development. 2. Fishes--Develop- ment. 3. Fishes--Eggs. 4. Fishes--Fecundity. I. Title. }L639.25.H45 597'.03 79-14549 ISBN 0-295-95672-0 CONTENTS ILLUSTRATIONS vi i TABLES xi FOREWORDxiii PREFACExv I NTROOUCTION 1 TheStudy of EarlyLife Mistoryof Fishas Partof MarineFisheries Biology 1 Historical Noteson the MainLines of IchthyoplanktonResearch 3 Conclusions 8 Literature on Marine Fish Eggsand Larvae 9 PRODUCTIONOF EGGS 11 Developmentof Gonadsand EggCells 11 Maturity Stages 16 Morphologyof the Eggand Its Usefor SpeciesIdentification 19 Fecundity 22 Measuring -

Scar Group of Specialists
,..,..,....-=---------------~---- ---~~---------,----- Dr. R. M. Laws SCAR GROUP OF SPECIALISTS MARINE LIVING RESOURCES OF THE SOUTHERN OCEAN 6- 8 OCTOBER, 1975 SCOTT POLAR RESEARCH INSTITUTE CAMBRIDGE, ENGLAND SCAR GROUP OF SPECIALISTS Marine Living Resources of the "Southern Ocean Scott Polar Institute Cambridge, England 6 - 8 October, 1975 CONTENTS Members of SCAR Group of Specialists SCAR Group of Specialists on Marine Living Resources - Background Information - Dr. S. Z. El-Sayed Agenda of Meeting Outline of a Proposal to SCAR for the Study of Marine Living Resources of the Southern Ocean Provision of Information Base for Conservation - Dr. J. A. Gulland Conservation and Management of the Living Resources -Dr. J. A. Gulland Population Dynamics and Population Ecology of Krill - Dr. M. A. McWhinnie ~~ Outl~ne of Research Program to Study Antarctic Krill - Lie. A. P. Tomo Population Dynamics and Ecology of Marine Mammals - Dr. R. M. Laws Ecology of Fishes, Squids and Other Living Resources - Dr. J-C Hureau International Coordination and Cooperation- Dr. S. J. Halt Research and Exploration of Antarctic Krill from the Federal Republic of Germany - Dr. D. Sahrhage Figure showing Marine Living Resources of the Southern Ocean. *From a letter to Dr. T. Nemoto dated 12 September, 1975. Members of the SCAR Group of Specialists on the Marine Living Resources of the Southern Ocean ~Dr. Sayed Z. El-Sayed (Convenor) ,./ ·Dr. Garth G. Newrnan Department of Oceanography Sea Fisheries Board Texas A&M University Department of Industries College Station, Texas 77843, U.S.A. P. 0. Box 251 Cape Town, South Africa 8000 v Dr. John A. Gulland Fish Stock Evaluation Branch >1 Dr. -
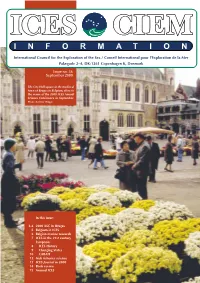
I N F O R M a T I
INFORMATION International Council for the Exploration of the Sea / Conseil International pour l’Exploration de la Mer Palægade 2–4, DK-1261 Copenhagen K, Denmark Issue no. 36 September 2000 The City Hall square in the medieval town of Bruges in Belgium, close to the venue of the 2000 ICES Annual Science Conference in September. Photo: Toerisme Brugge In this issue: 2-4 2000 ASC in Bruges 5 Belgium in ICES 6 Belgian marine research 7 ICES in the 21st century Symposia: 8 ICES History 9 Changing States 10 CARAH 12 Irish fi sheries science 13 ICES Journal in 2000 14 Book review 15 Around ICES 2000 ASC overview Immediately preceding the Annual Sci- X – Development of Reference Points and Oceanography and Marine Ecology ence Conference an Open Forum will be Management Systems for Fisheries and L – North Atlantic Processes held on Tuesday, 26 September, to dis- the Marine Ecosystem Dr W. R. Turrell and Prof. T. Rossby cuss the ICES Strategic Plan. Dr J. Horwood, Dr N. A. Nielsen, Dr G. van Balsfoort, and Dr M. Sissenwine M – Environment–Plankton–Fish Linkages The 2000 ICES Annual Science Confer- Dr K. Drinkwater, P. Wiebe, Prof. K. ence in itself offers an Open Lecture by Fisheries Technology and Surveying Tande, and Dr J. Runge Dr Daniel Pauly on “Fisheries and Con- J – Effi ciency, Selectivity and Impacts of servation. A Programme for Their Recon- Passive Fishing Gears N – Spatial and Temporal Patterns in ciliation”. As an innovation this year there H. A. Carr and G. Brothers Recruitment Processes will be two additional Invited Lectures, Prof.