Liportal Das Länder-Informations-Portal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ibrahim Boubacar Keita
Ibrahim Boubacar Keita Malí, Presidente de la República Duración del mandato: 04 de Septiembre de 2013 - En funciones Nacimiento: Koutiala, región de Sikasso, 29 de Enero de 1945 Partido político: RPM Profesión : Politólogo y consultor ResumenLas elecciones celebradas en Malí en julio y agosto de 2013, tras año y medio de gravísima crisis nacional, sentaron en la Presidencia de la República a Ibrahim Boubacar Keita, veterano dirigente político que ya había intentado ganar el mandato en las votaciones de 2002 y 2007. El respetado Keita, un experto en cuestiones del desarrollo y con buenas conexiones en el exterior, se distinguió en la oposición a la dictadura de Moussa Traoré (1968-1991) y luego fue uno de los pilares de la democracia malí, a la que sirvió como cofundador del partido ADEMA, primer ministro (1994-2000) con el presidente Alpha Oumar Konaré y jefe de la Asamblea Nacional (2002-2007) con Amadou Toumani Touré. Desde 2001 lidera una formación, el RPM, orientada al centro-izquierda.A los ojos de la comunidad internacional y de la gran mayoría de sus paisanos, Keita, llamado habitualmente IBK, con su reputación de hombre firme y a la vez pragmático, es la única figura capaz de asegurar la integridad de este empobrecido Estado del área sahelo-sahariana, que en enero de 2012 vio saltar por los aires dos décadas de estabilidad considerada modélica.La revuelta tuareg -la cuarta o quinta desde la independencia en 1960- en las vastas regiones desérticas del norte, el inicuo golpe del capitán Sanogo, que derrocó al presidente Touré, la proclamación por los rebeldes separatistas del Estado Independiente de Azawad y el auge espectacular de la subversión jihadista al socaire de todo lo anterior dibujaron un aciago escenario de guerra civil, usurpación castrense y partición territorial de facto que la intervención internacional por etapas, civil y militar, de los gobiernos de la región, de Francia y de la ONU pudo revertir en buena medida, aunque no del todo. -

2016 Country Review
Mali 2016 Country Review http://www.countrywatch.com Table of Contents Chapter 1 1 Country Overview 1 Country Overview 2 Key Data 5 Mali 6 Africa 7 Chapter 2 9 Political Overview 9 History 10 Political Conditions 12 Political Risk Index 66 Political Stability 81 Freedom Rankings 96 Human Rights 108 Government Functions 110 Government Structure 111 Principal Government Officials 121 Leader Biography 122 Leader Biography 122 Foreign Relations 131 National Security 143 Defense Forces 154 Chapter 3 156 Economic Overview 156 Economic Overview 157 Nominal GDP and Components 159 Population and GDP Per Capita 160 Real GDP and Inflation 161 Government Spending and Taxation 162 Money Supply, Interest Rates and Unemployment 163 Foreign Trade and the Exchange Rate 164 Data in US Dollars 165 Energy Consumption and Production Standard Units 166 Energy Consumption and Production QUADS 167 World Energy Price Summary 168 CO2 Emissions 169 Agriculture Consumption and Production 170 World Agriculture Pricing Summary 172 Metals Consumption and Production 173 World Metals Pricing Summary 175 Economic Performance Index 176 Chapter 4 188 Investment Overview 188 Foreign Investment Climate 189 Foreign Investment Index 193 Corruption Perceptions Index 206 Competitiveness Ranking 217 Taxation 226 Stock Market 227 Partner Links 227 Chapter 5 229 Social Overview 229 People 230 Human Development Index 232 Life Satisfaction Index 236 Happy Planet Index 247 Status of Women 256 Global Gender Gap Index 259 Culture and Arts 268 Etiquette 268 Travel Information 269 Diseases/Health Data 280 Chapter 6 287 Environmental Overview 287 Environmental Issues 288 Environmental Policy 288 Greenhouse Gas Ranking 290 Global Environmental Snapshot 301 Global Environmental Concepts 312 International Environmental Agreements and Associations 326 Appendices 350 Bibliography 351 Mali Chapter 1 Country Overview Mali Review 2016 Page 1 of 363 pages Mali Country Overview MALI Located in western Africa, the landlocked Mali is one of the poorest countries in the world. -
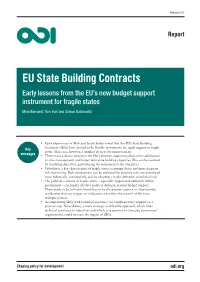
EU State Building Contracts Early Lessons from the EU’S New Budget Support Instrument for Fragile States
February 2015 Report EU State Building Contracts Early lessons from the EU’s new budget support instrument for fragile states Myra Bernardi, Tom Hart and Gideon Rabinowitz • Early experiences in Mali and South Sudan reveal that the EU’s State Building Key Contracts (SBCs) have proved to be flexible instruments for rapid support to fragile states. There are, however, a number of areas for improvement. messages • There exists a design tension in the SBCs between supporting short-term stabilisation or crisis management, and longer-term state-building objectives. This can be resolved by clarifying objectives, and tailoring the instrument to the objectives. • Volatility is a key characteristic of fragile states, requiring closer and more frequent risk monitoring. Risk management can be improved by ensuring risks are monitored more holistically and regularly, and by adopting a wider definition of political risk. • The political economy of fragile states – especially fragmented authority within government – can hinder effective political dialogue around budget support. There needs to be sufficient broad buy-in by the partner country, or alternatively, verification that any triggers or indicators are within the control of the main dialogue partner. • Accompanying SBCs with technical assistance (or complementary support) is a positive step. Nevertheless, a more strategic and flexible approach, which links technical assistance to objectives and which is responsive to changing government requirements, could increase the impact of SBCs. Shaping policy for development developmentprogress.orgodi.org Acknowledgments We thank officials from the Governments of Mali and South Sudan; bilateral and multilateral agency representatives involved in Mali and South Sudan; and EU officials in Bamako, Brussels and Juba for giving their time for interviews during this study. -

The Executive Survey General Information and Guidelines
The Executive Survey General Information and Guidelines Dear Country Expert, In this section, we distinguish between the head of state (HOS) and the head of government (HOG). • The Head of State (HOS) is an individual or collective body that serves as the chief public representative of the country; his or her function could be purely ceremonial. • The Head of Government (HOG) is the chief officer(s) of the executive branch of government; the HOG may also be HOS, in which case the executive survey only pertains to the HOS. • The executive survey applies to the person who effectively holds these positions in practice. • The HOS/HOG pair will always include the effective ruler of the country, even if for a period this is the commander of foreign occupying forces. • The HOS and/or HOG must rule over a significant part of the country’s territory. • The HOS and/or HOG must be a resident of the country — governments in exile are not listed. • By implication, if you are considering a semi-sovereign territory, such as a colony or an annexed territory, the HOS and/or HOG will be a person located in the territory in question, not in the capital of the colonizing/annexing country. • Only HOSs and/or HOGs who stay in power for 100 consecutive days or more will be included in the surveys. • A country may go without a HOG but there will be no period listed with only a HOG and no HOS. • If a HOG also becomes HOS (interim or full), s/he is moved to the HOS list and removed from the HOG list for the duration of their tenure. -

Annuaire Statistique Du Mali 2016
ANNUAIRE STATISTIQUE DU MALI 2016 ANNUAIRE STATISTIQUE DU MALI SOMMAIRE PAGE SOMMAIRE I LISTE DES TABLEAUX II AVANT - PROPOS V LISTE DES SIGLES ET DEFINITIONS VI APERÇU GEOGRAPHIQUE VIII APERÇU HISTORIQUE X CLIMATOLOGIE - HYDROGRAPHIE 1 DÉMOGRAPHIE 6 SANTE 13 ENSEIGNEMENT 25 MAIN D’ŒUVRE 31 RESSOURCES ECONOMIQUES 36 ECHANGES ET MOYENS DE COMMUNICATION 48 COMPTES NATIONAUX 62 FINANCES PUBLIQUES 66 PRIX 72 ANNUAIRE STATISTIQUE DU MALI I Liste des tableaux (1) Titres Pages Tableau 1: Cumul pluviométrique (mm) par mois et par région pour l'année 2016 1 Tableau 2: Nombre de jour de pluie par mois et par région pour l'année 2016 2 Tableau 3: Moyenne des températures mensuelles (°C) des régions 3 Tableau 4: Moyenne des températures mensuelles (°C) des régions 4 Tableau 5: Moyenne des températures mensuelles en (°C) des régions 5 Tableau 6: Population par groupe d'age quinquennal et par sexe selon les régions de 2015 à 2016 7 Tableau 7: Evolution de quelques indicateurs démographiques de 2013 à 2016 12 Tableau 8: Extention des centres de santé communautaires (CSCOM) fonctionnels par région jusqu'au 31 Décembre 2016 14 Tableau 9: Situation du personnel de santé (ratio population/personnel) par région en 2016 15 Tableau 10: Répartition du nombre moyen de consultation prénatale (CPN) par région en 2016 16 Tableau 11: Activité de Planification Familiale en structure, tous niveaux (utilisation de services) en 2016 16 Tableau 12: Les indicateurs de surveillance (PFA) par région en 2016 17 Tableau 13: La situation de la rougeole par région en 2016 18 -

Current Affairs Mega Capsule 2014
Current Affairs Mega Capsule 2014 New Updated Current Affairs Mega GK Capsule 2014 April 2014 to October 2014 This is a the latest updated mega current affairs GK capsule with more than 1000 objective questions, more than 1000 Points to Remember and more than 200 pages. This capsule covers period from April 2014 to October 2014. Subsequent add on will be added every week. You can download this free Current Affairs Capsule which is specially designed for upcoming IBPS Clerk, SBI Associates PO and SSC Exams. These questions are in sequential order and answer of some earlier questions may have changed. Objective Questions on Current Affairs April 2014 to October 2014 Question: Japan signed on April 1, 2014 a loan agreement with India to provide ______ for the development of water supply project in Agra? A) 350 cr B) 960 cr C) 700 cr D) 1000 cr Answer & Explanation: Japan signed on April 1, 2014 a loan agreement with India to provide “960 cr” for the development of water supply project in Agra. Question: The armies of Nepal and India held a joint military exercise named ______ at the Integrated Army Training Centre (IATC) at Saljhandi in Rupanddehi district of southern Nepal. A) Indra B) Combat C) Surya Kiran D) Yudh Abhyas A compilation of www.study-places.com Page 1 Current Affairs Mega Capsule 2014 Answer & Explanation: Nepal and India held a joint military exercise named Surya Kiran. Question: The third edition of the global Nuclear Security Summit (NSS) 2014 was held at? A) Brussels B) Hague C) Belgium D) New Delhi Answer & Explanation: Third edition of the global Nuclear Security Summit (NSS) 2014 was held at Hague. -

Annuaire Statistique Du Mali 2018
ANNUAIRE STATISTIQUE DU MALI 2018 ANNUAIRE STATISTIQUE DU MALI SOMMAIRE SOMMAIRE... ...…………………………..…………………………….…………………………..…………………………………………I LISTE DES TABLEAUX (1)…….………………………………………….……………..…….........……………..…...….………….II LISTE DES TABLEAUX(2)…….………………………..……………………………..………………………………….....…………..III AVANT - PROPOS…. .……………..………………...…………………………………………………………………………………….IV LISTE DES SIGLES ET DEFINITIONS(1)……………..………...…..…………………………………………….…………………IV LISTE DES SIGLES ET DEFINITIONS(2)…….…..……..…….....……………………………………………………….…………V APERÇU GÉOGRAPHIQUE………...…..…………………………………………………..…….…………………………………… VI APERÇU HISTORIQUE ………………………………………………………………...………………………………..……….……….VII APERÇU HISTORIQUE ………………………………………………………………...………………………………..……….……….VIII APERÇU HISTORIQUE ………………………………………………………………...………………………………..……….……….IX APERÇU HISTORIQUE ………………………………………………………………...………………………………..……….……….X CLIMATOLOGIE - HYDROGRAPHIE………….…..…………………..………………………………………………………………1 DÉMOGRAPHIE……………………………...………………..………………………………………………………..……...……………5 SANTÉ…………………..……………………………………………………………………..………………………..……………………….11 ENSEIGNEMENT………………..…………………………………………………………………..…..…………..………………………23 MAIN D’ŒUVRE…………………………………….…………………………………………………………………..…….…..…..……29 RESSOURCES ÉCONOMIQUES………….….………………………………………….………………..……………....……………34 ÉCHANGES ET MOYENS DE COMMUNICATION ….……..…………………...……………….…..……….……………….44 COMPTES NATIONAUX ………………………………………………………..…..…………………….……….………………..……58 FINANCES PUBLIQUES …………………………………...………………………………………..…..……………………...………..62 PRIX ………………………………….….…………………………………………………………………………….………………………..….64 -

The Conflict in Northern Mali STUDENT OFFICER: Charles King-Tenison POSITION: Deputy Chair
FORUM: Special Political and Decolonisation Committee TOPIC: The Conflict in Northern Mali STUDENT OFFICER: Charles King-Tenison POSITION: Deputy Chair Introduction Ethnically, politically and militarily divided Mali is a precarious state in West Africa. Once home to several pre-colonial empires, the landlocked and arid country of Mali is one of the largest on the continent. Historically seeing major African Empires of Songhai and the Mali Empire, the state has been under French colonial rule from 1898 till 1960. After independence from France in 1960, Mali suffered droughts, rebellions, a coup and 23 years of military dictatorship until democratic elections in 1992. In 2013, France intervened militarily upon the government's request following the capture of the town of Konna and its troops overran Islamist strongholds. Authorities agreed a United Nations- sponsored ceasefire with Tuareg separatists in 2015, but parts of the country remain tense, with Tuareg rebels sporadically active. Meanwhile, a jihadist insurgency in Mali's north and central regions continues, with al-Qaeda-linked militants carrying out attacks. The country’s predominant religion, Islam, has led to many groups from Islamic State and Al-Qaeda to the National Movement for the Liberation of Azawad being active in the region: especially northern areas. Social division in the country has 4 languages and corresponding ethnic divides: French, Bambara, Berber and Arabic. Mali has a capital at Bamako, with a total population of 18.5 million and country area of 1.25 million square km (482,077 square miles). The most shocking statistic is due, in part to conflict, the life expectancy is 57 years for men, 84 years for women. -

República De Mali
OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA FICHA PAÍS Mali República de Mali La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa. ENERO 2018 nianka (4,3%), Tamasheq (3,5%), Senoufo (2,6%), Bobo (2,1), no especificado Mali (0,7%), otros (6,3%) (estimación 2009) Religión: 94.8% musulmanas, cristianas 2,4%, animistas 2%, ninguna 0,5%, no especificada 0,3%.(estimación 2009) Moneda: Franco CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Forma de Estado: República multipartidista. Grupos étnicos: Bambara (34,1%), Peul (14,7%), Sarakole (10,8%), Senufo (10,5%), Dogon (8,9%), Malínke (8,7%), Bobo (2,9%), Songhai (1,6%), Tuareg (0,9%), otros malienses (6,1%), CEDEAO (0,3%), otros (0,4%) (estimación 2012-2013). Fuente: CIA the World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ ARGELIA geos/ml.html 1.2. Geografía MAURITANIA La superficie del país es llana, con mesetas y llanuras en las que apenas destacan algunos promontorios. Las mesetas del sur y del suroeste alcanzan los 640 m de altitud en Sabadugu y están surcadas por valles fluviales. Las del sureste y el este se caracterizan por pequeñas colinas que alcanzan altitudes entre los 305 y los Gao 520 m. -

Comisión Española De Ayuda Al Refugiado Hayat Traspas Ismail Ana Villalobos Prada Madrid, Mayo De 2015 Servicios Centrales: Avda
Malí Comisión Española de Ayuda al Refugiado Hayat Traspas Ismail Ana Villalobos Prada Madrid, Mayo de 2015 www.cear.es Servicios Centrales: Avda. de General Perón 32, 2˚ derecha 28020 Madrid 1 ÍNDICE ÍNDICE ........................................................................................................................ 2 Parte 1: Breve Introducción General al País ............................................................... 3 1. Geografía ........................................................................................................... 4 1.2 Clima .............................................................................................................. 6 1.3 Demografía y población .................................................................................. 7 1.4 Etnología ........................................................................................................ 7 1.5 Economía ........................................................................................................ 9 1.6 Educación ..................................................................................................... 11 1.7 Organización política y Constitución.............................................................. 13 1.8 Historia- Cronología ...................................................................................... 14 Parte 2: Situación de los Derechos Humanos ........................................................... 23 2. Introducción .................................................................................................... -

Wegweiser-Mali-Data.Pdf
Autorinnen und Autoren Marie Theres Beumler (MTB), Führungsakademie der Bundeswehr, Ham- burg ([email protected]) Jan Henrik Fahlbusch (JHF), Friedrich-Ebert-Stiftung, Bamako Über Jahrzehnte hin nahmen große Teile der deutschen Gesell- Wegweiser zur Geschichte ([email protected]) schaft die Entwicklung in der Republik Mali kaum war. In politisch Dr. Gerald Hainzl, Landesverteidigungsakademie, Wien interessierten Kreisen galt der westafrikanische Binnenstaat bis ([email protected]) zur Krise von 2012 als politische »Vorzeigedemokratie« in Afri- Charlotte Heyl (CH),M.A., GIGA Institut für Afrika-Studien, Hamburg ka. Nur wenige kulturinteressierte Reisende und moderne Aben- ([email protected]) Oberstleutnant i.G. Dr. Martin Hofbauer,Bundesministerium der Verteidi- teurer hatten jedoch zuvor die Große Moschee des UNESCO- gung, Berlin, ([email protected]) Weltkulturerbes in Djenné aufgesucht, das legendäre Timbuktu Prof. Dr. Georg Klute, Universität Bayreuth besucht oder sich von der atemberaubenden Schönheit der un- ([email protected]) endlich wirkenden Wüste berauschen lassen. Dr. Tobias Koepf, Stiftung Genshagen, Genshagen Mit dem Aufstand bewaffneter Gruppen im Norden des Lan- ([email protected]) des und dem Militärputsch in der Hauptstadt Bamako im März Oberstleutnant i.G. Dr. Dieter Kollmer, ZMSBw, Potsdam 2012 änderte sich die Situation schlagartig. Der Einsatz fran- ([email protected]) zösischer Streitkräfte im Januar, die Entsendung einer euro- Prof. Dr. Baz Lecocq, Humboldt Universität Berlin päischen Ausbildungsmission (EUTM Mali) im Frühjahr sowie ([email protected]) die Aufstellung einer robusten Mission der Vereinten Nationen Oberleutnant d.R. Torsten Konopka (TK), M.A., Potsdam (MINUSMA) im Sommer 2013 dynamisierten die Entwicklung ([email protected]) schließlich noch weiter. -

GAO / MALI UNCLASSIFIED Information Bulletin Page 1 of 74
GAO / MALI UNCLASSIFIED Information Bulletin MALI: Information bulletin 1 Civil Military Interaction Command APELDOORN December 2013 Cut-off date: December 18th, 2013 Page 1 of 74 GAO / MALI UNCLASSIFIED Information Bulletin Table of Contents: MALI: Information Bulletin/1CMI Co 1 Civil Military Interaction Command 1 Table of Contents 2 Introduction 5 Summary 7 1 Political structure and people 9 1.0 Overview: regions, circles and communes 9 1.1 Responsibilities of the government on the ‘région’-level in Gao 10 1.2 Main offices/departments on the ‘région’-level in Gao 10 1.3 Actual people employed/elected in Gao 10 1.4 Responsibilities of the government on the ‘cercle’-level in the Gao-cercles 11 1.5 Main offices/departments on the ‘cercle’-level in the Gao-cercles 12 1.6 Actual people employed/elected in the Gao-cercles 12 1.7 Responsibilities of the government on the ´commune´ level 12 1.8 Main offices/departments on the ´commune´ level 13 1.9 Actual people employed/elected 14 1.10 Physical locations of government institutions in Gao (city) 17 1.11 Political parties which were active in the elections of November 2013 17 1.12 Local representatives/leaders of these parties 18 2 Informal power structures 21 2.1 Shadow governments 21 2.2 Local power brokers operating outside the state apparatus 22 2.3 Incorporation of traditional power brokers within formal power structures 24 2.4 The most powerful informal power brokers 25 3 IOs / NGOs 27 3.1 Locations of the current activities of IOs/NGOs in Gao region 27 3.2 Current spokespersons / LNOs for said IOs/NGOs 27 3.3 Assessment of the capability and the intent of currently active IOs/NGOs 27 4 Social-cultural structures 37 4.1 Role of religion in the daily life for the average Gaoan 37 4.2 Role of ethnicity in daily life/common social interaction in the Gao society 40 Page 2 of 74 GAO / MALI UNCLASSIFIED Information Bulletin 4.2.1 Peaceful ethnic relations before the conflict 40 4.2.2.