Bajohr Johe Lohalm Zivilisation Und Barbarei.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jhering's Concept of Rechtsgefühl and Its Role in the Struggle For
TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 4/2017 ISSN 1641–1609 JOSEFA BIRR* Jhering’s concept OF RECHTSGEFÜHL AND ITS ROLE IN THE STRUGGLE FOR LAW “It is the energy of our moral nature protesting against the violation of the law; it is the most beautiful and the highest testimony which Rechtsgefühl can bear to itself […]”. With these words, Rudolf von Jhering captured the attention of his audience at his Vienna lecture of The Struggle for Law in 872. The following paper is divided into three parts. I begin with a review of Jher- ing’s concept of Rechtsgefühl2. I then go on to look at its particular meaning in The Struggle for Law. Finally, I show how the function of Rechtsgefühl in The Struggle for Law fits into Jhering’s overall concept ofR echtsgefühl. In the late 9th and early 20th centuries, German jurisprudence was concerned with the phenomenology of Rechtsgefühl. This concept is enigmatic. Its range of meaning extends from an inner psychological disposition, or something that is given a priori, to an educated feeling for legal right, similar to legal intuition. Re- lated terms and frequently used synonyms such as Rechtsbewusstsein, Rechtsemp- finden, Gewissen and Sittlichkeit make a clear definition difficult. Rechtsgefühl is widely translated as “the feeling of the legal right” or “sense of justice”. The concept of “legal sentiment” comes closest. Still, in my opinion, none of these is quite accurate. Thus, in the following I use the term Rechtsgefühl. * Dipl.-Jur., Göttingen. R. von Jhering: The Struggle for Law (1872), translated from the fifth German edition by J.J. -
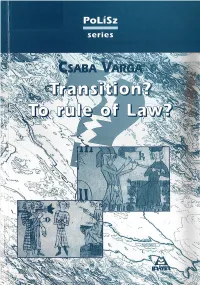
CSABA VARGA Transition? to Rule of Law? Varga Jogallami Angol Proba Tartalek Ks Korr01.Qxp 2008.01.23
PoLíSz series CSABA VARGA Transition? To rule of law? varga_jogallami_angol_proba_tartalek_ks_korr01.qxp 2008.01.23. 12:28 Page 1 CSABA VARGA TRANSITION? TO RULE OF LAW? Constitutionalism and Transitional Justice Challenged in Central & Eastern Europe varga_jogallami_angol_proba_tartalek_ks_korr01.qxp 2008.01.23. 12:28 Page 2 CSABA VARGA was born in Pécs. Since graduation in law in 1965, he has been an academic researcher at the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, since 1991 as scientific adviser. He became a Professor of Law at the metropolitan Eötvös Loránd University in the same year. By the foundation of the Faculty of Law of the Pázmány Péter Catholic University of Hungary in 1995, he founded and has also been heading its Institute for Legal Philosophy, granted by the National Accreditation Committee in 2006 the sole title “Place of Excellence” for a chair in the country. One of the founders (as its secretary between 1976–2006 and since then as its chairman) of the Hungarian National Section of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR); a political adviser to and a member of the Advisory Board of the first free-elected Prime Minister of Hungary (1991–1994), serving as an editorial board member of Current Legal Theory (1983–1998), Ratio Juris (1988–), Legal Theory (1993–1999), as well as of Világosság [a philosophical forum] (2003–). In 2004, he was elected as an associated member of the International Academy of Comparative Law. His bibliography is available in both http://varga.jak.ppke.hu and Theatrvm legale mvndi Symbola Cs. -

Virus 7.Indd
VIRUS VIRUS BEITRÄGE ZUR SOZIALGESCHICHTE DER MEDIZIN HERAUSGEGEBENVIRUS VOM VEREIN FÜR SOZIALGESCHICHTE DER MEDIZIN BEITRÄGE ZUR SOZIALGESCHICHTE DER MEDIZIN 6 HERAUSGEGEBEN VOM VEREIN FÜR SOZIALGESCHICHTE DER MEDIZIN 7 VERLAGSHAUSVERLAGSHAUS DER DER ÄRZTE ÄRZTE GESELLSCHAFTGESELLSCHAFT FÜR MEDIENPRODUKTION FÜR MEDIENPRODUKTION UND UNDKOMMUNIKATIONSBERATUNG KOMMUNIKATIONSBERATUNG GMBH GMBH Vorstand: Präsidentin: Univ.-Doz. Mag. Dr. phil. Dr. med. Sonia Horn Präsidentin-Stv.: Mag. phil. Dr.med. Ingrid Arias Kassier: Mag. Dr. phil. Thomas Aigner, MAS Kassier-Stv.: Mag. pharm. Gilbert Zinsler Schriftführerin: Mag. phil. Karin Maringgele © 2008 Verlagshaus der Ärzte Schriftführerin-Stv.: Mag. Marcel Chahrour GmbH, Nibelungengasse 13, A 1010 Wien, Wissenschaftlicher Beirat: www.aerzteverlagshaus.at Univ.-Prof. Dr. phil. Gunda Barth-Scalmani, Innsbruck Das Werk ist urheberrechtlich Univ.-Prof. Dr. phil. Birgit Bolognese-Leuchtenmüller, Wien geschützt. Die dadurch begründeten Univ.-Prof. Dr. phil. Elisabeth Dietrich-Daum, Innsbruck Rechte, insbesondere das der Über- Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. med. Michael Hubenstorf, Wien setzung, des Nachdrucks, der Pflegedir. DKS Maria Jesse, Wien Entnahme von Abbildungen, der Univ.-Prof. Dr. phil. Robert Jütte, Stuttgart Funksendung, der Wiedergabe auf Univ.-Prof. Dr. med. Christine Marosi, Wien fotomechanischem oder ähnli- Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Dr. med. Werner Mohl, Wien chem Wege und der Speicherung PD Dr. Carlos Watzka in Datenverarbeitungsanlagen, Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Wiesemann, Göttingen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten. Verein für Sozialgeschichte der Medizin Autoren und Verlag haben alle Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Sozialgeschichte der Medizin mit dem Buchinhalte sorgfältig erwogen Ziel, eine Vielfalt von Herangehensweisen und Methoden zu unterstützen – Veran- und geprüft, dennoch kann keine staltung von Vorträgen, Seminaren, Tagungen, Ausstellungen und ähnlichen wis- Garantie übernommen werden. -

Hart and Fuller on Radbruch
The Catholic Lawyer Volume 5 Number 2 Volume 5, Spring 1959, Number 2 Article 5 One Phase of the New Debate on the Iniquitous Law - Hart and Fuller on Radbruch William F. Cahill, B.A., LL.B., J.C.D. Follow this and additional works at: https://scholarship.law.stjohns.edu/tcl Part of the Catholic Studies Commons, and the Ethics and Political Philosophy Commons This Article is brought to you for free and open access by the Journals at St. John's Law Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in The Catholic Lawyer by an authorized editor of St. John's Law Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. ONE PHASE OF THE NEW DEBATE ON THE INIQUITOUS LAW- Hart and Fuller on Radbruch WILLIAM F. CAHILL, B.A., LL.B., J.C.D.* ERICA, IN THE FIRST HALF of the twentieth century, heard little debate on the question, "Need the law be moral?" Many who might have taken the negative in such a debate said nothing because they thought the question meaningless or at least unprofitable.' Not imagin- ing that the law could need conscience, they discounted the power of conscience to make demands upon the law, and so put aside the problem of relating morals and the law. It was enough to know that in the distant past Blackstone had maintained that an immoral law had no validity,2 while Austin asserted that a law which actually exists is a law though it contravene morals. 3 The debate could be revived only by the occurrence of some event in which might appear the unimagined horrors that could be produced by laws which neither relied upon conscience nor answered to con- science. -

Five Minutes of Legal Philosophy (1945)*
Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 13–15 doi:10.1093/ojls/gqi042 Five Minutes of Legal Philosophy (1945)* GUSTAV RADBRUCH TRANSLATED BY BONNIE LITSCHEWSKI PAULSON AND STANLEY L. PAULSON First Minute ‘An order is an order’, the soldier is told. ‘A law is a law’, says the jurist. The soldier, however, is required neither by duty nor by law to obey an order whose object he knows to be a felony or a misdemeanor, while the jurist—since the last of the natural lawyers died out a hundred years ago—recognizes no such excep- tions to the validity of a law or to the requirement of obedience by those subject to it. A law is valid because it is a law, and it is a law if, in the general run of cases, it has the power to prevail. This view of a law and of its validity (we call it the positivistic theory) has ren- dered jurists and the people alike defenceless against arbitrary, cruel, or criminal laws, however extreme they might be. In the end, the positivistic theory equates law with power; there is law only where there is power. Second Minute Attempts have been made to supplement or replace this tenet with another: Law is what benefits the people. That is to say, arbitrariness, breach of contract, and illegality—provided only that they benefit the people—are law. Practically speaking, this means that what- ever state authorities deem to be of benefit to the people is law, including every despotic whim and caprice, punishment unsanctioned by statute or judicial * ‘Fünf Minuten Rechtsphilosophie’, first published in the Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg), 12 September 1945, repr. -

The Legality of Evil Or the Evil of Legality
Tulsa Law Review Volume 47 Issue 1 Book Review Issue Summer 2011 The Legality of Evil or the Evil of Legality Frederick Schauer Follow this and additional works at: https://digitalcommons.law.utulsa.edu/tlr Part of the Law Commons Recommended Citation Frederick Schauer, The Legality of Evil or the Evil of Legality, 47 Tulsa L. Rev. 121 (2013). Available at: https://digitalcommons.law.utulsa.edu/tlr/vol47/iss1/12 This Book Review is brought to you for free and open access by TU Law Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Tulsa Law Review by an authorized editor of TU Law Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Schauer: The Legality of Evil or the Evil of Legality THE LEGALITY OF EVIL OR THE EVIL OF LEGALITY? Frederick Schauer* DAVID DYZENHAUS. HARD CASES IN WICKED LEGAL SYSTEMS: PATHOLOGIES OF LEGALITY (Oxford Univ. Press, 2d ed. 2010). Pp. 350. Hardback. $110.00. Lawyers and legal scholars have long been intrigued, puzzled, and sometimes embarrassed by the conduct of lawyers and judges in oppressive or otherwise evil governments. For anyone holding the romantic ideal of the lawyer as someone who stands up to injustice rather than serving as part of it, the widespread participation of lawyers and judges in demonstrably unjust legal systems and political regimes is an uncomfortable fact, sorely in need of explanation. The phenomenon of the lawyer (and judge) as collaborator and enabler has generated a rich and enduring literature. Lon Fuller, building on the accounts of Gustav Radbruch,l examined the role of lawyers and judges in Nazi Germany,2 and Robert Cover sought to explain why even seemingly anti-slavery northern judges routinely enforced the Fugitive Slave and other slavery-supportive laws, especially in the 1830s, 1840s, and 1850s. -

Revolution Or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy Erik Wolf
Notre Dame Law School NDLScholarship Natural Law Forum 1-1-1958 Revolution or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy Erik Wolf Follow this and additional works at: http://scholarship.law.nd.edu/nd_naturallaw_forum Part of the Law Commons Recommended Citation Wolf, Erik, "Revolution or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy" (1958). Natural Law Forum. Paper 25. http://scholarship.law.nd.edu/nd_naturallaw_forum/25 This Article is brought to you for free and open access by NDLScholarship. It has been accepted for inclusion in Natural Law Forum by an authorized administrator of NDLScholarship. For more information, please contact [email protected]. REVOLUTION OR EVOLUTION IN GUSTAV RADBRUCH'S LEGAL PHILOSOPHY Erik Wolf SINcE GUSTAV RADBRUCH'S DEATH in 1949 there has been some discussion of whether his philosophical thinking remained in principle the same from the Grundziige der Rechtsphilosophie (1914) to the Vorschule der Rechts- philosophie (1948), or whether it underwent a drastic revolution or reform after 1945 which could properly be designated as "a substantial change in his point of view."' Some legal philosophers deny any and all development;2 others maintain that there was a decisive change. 3 The latter opinion is particularly important in that it is the thesis of a significant and compre- hensive study.4 The former view, however, which contests the suggestion that any such change ever took place, can appeal to a no less profound interpretation of Radbruch's legal philosophy. 5 As for the cause of this alleged revolution or reform we are referred not to any inner transformation in Radbruch himself, but to two external ex- periences: one in the realm of German political history, and the other in the realm of the history of ideas. -

La Estética Del Derecho
LA ESTÉTICA DEL DERECHO Dr. Paulino Rueda Romero1 "Situad la belleza en la percepción de las relaciones, y tendréis la historia de sus progresos desde el nacimiento del mundo hasta nuestros días". Diderot. RESUMEN. El presente artículo explica en forma alegórica la expresión del Derecho en uno de los capítulos poco difundidos en el marco de la Filosofía del Derecho. Los clásicos escritos acerca del tema por filósofos fundamentalmente, Platón, Aristóteles, Hegel, Schopenhauer, C.J.Friedrich, Gustav Radbruch, Kant entre otros, explicaron en su momento, grandes capítulos de la belleza del Derecho en las diferentes facetas donde el Derecho tiene su razón de ser. Toca a nosotros, aplicar dichos conceptos, a la realidad de los hechos actuales. Las sentencias de los jueces cuando se ajustan al derecho solicitado y a las reglas del Derecho, constituyen una estética hecha realidad en la voluntad del juez. 1 Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y titular del Curso Filosofía del Derecho. Los juicios que se ventilan en los Tribunales, cuyas resoluciones finales dan claro ejemplo de justicia a favor de los solicitantes, tienen una bella expresión en la sociedad, que ven con buenos ojos, las sentencias emitidas de acuerdo al Derecho. La estética del Derecho, también va a tener respuesta en la literatura, en el drama, en el lenguaje que hace propicio un mejor entendimiento de esa realidad que el mundo espera de los operadores jurídicos. El mundo globalizado y las nuevas formas de administración de justicia en las Cortes Internacionales así como la admisión y aceptación generalizada de los Derechos Humanos como denominador común de la humanidad, hace del Derecho una belleza cuando los jueces administran justicia en su nombre. -

Gustav Radbruch's Concept Of
Gustav Radbruch’s Concept of Law Robert Alexy Two legal philosophers in the German-speaking countries excelled over all the others in the 20th century, and their philosophies remain topics of lively debate in the global discussion today. I have in mind Hans Kelsen and Gustav Radbruch. I will be concerned here with Radbruch.1 The elaboration of Radbruch’s legal philosophy culminates in two devel- opments. The first is the systematic presentation of his position in the new edi- tion of his treatise Legal Philosophy (1932). In the preface to the new edition Radbruch remarks, with an eye to the first edition (1914), called Outlines of Le- gal Philosophy,2 that the text from 1932 is in fact ‘a new book rather than a new edition’.3 The second culminating development is represented by the article ‘Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)’, where Radbruch intoduces the formula, well known as ‘the Radbruch Formula’, which says, in a word, that extremely unjust law is no law.4 With this, Radbruch clearly takes a stand as a non-positivist. The Radbruch Formula is not only one of the most I should like to thank Stanley L. Paulson for suggestions and advice on matters of English style. 1 On Radbruch’s biography, see Robert Alexy, ‘Gustav Radbruch (1878-1949)’, in: Christiana Albertina 58 (2004), 47-51. 2 On the relation of the Outlines of Legal Philosophy from 1914 to the Legal Philosophy from 1932, see Ralf Dreier, ‘Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Rechtsphilosophie Radbruchs’, in: Martin Borowski and Stan- ley L. -

The Rise of Legal Positivism in Germany: a Prelude to Nazi Arbitrariness?
The Western Australian Jurist, vol 3, 2012 245 THE RISE OF LEGAL POSITIVISM IN GERMANY: A PRELUDE TO NAZI ARBITRARINESS? * KENNY YANG I INTRODUCTION The paper will first look at the rise of legal positivism that left the door ajar for Nazi arbitrariness to enter the system, and how in adopting a separation of ‘is’ and ‘ought’ approach to the law, it left the German legal profession little theoretical resources to resist such arbitrariness. The paper will then juxtapose a hypothetical: whether natural law might have offered better theoretical resources to resist such arbitrariness and conclude with a brief reflection of the dangers of such a strict separation of ‘is’ and ‘ought’ to legal analysis if we are to learn from history and wish to avoid a repeat of the atrocities of the Nazi system. II LEGAL POSITIVISM: THE SEPARATION THESIS A The ius and lex divide Legal positivists believe that the question of what is the law is separate from, and must be kept separate from, the question of what the law ought to be.1 Legal positivism is thus distinguished by two claims: that the law is * Final year LLB (Hons) student at Murdoch University. This essay was selected for publication as one of the top essays in the Legal Theory Unit in 2012. 1 Brian Bix, Jurisprudence Theory and Concept (Sweet & Maxwell, 2nd ed, 1999) 31. 246 Yang, The Rise of Legal Positivism in Germany separable from its substantive morality and that there is no necessary link between law and morality.2 Evinced in Hart’s recognition rule, the ‘master test for legal validity’,3 it ‘points to the separation of the identification of the law from its moral evaluation, and the separation of statements of what the law is from statements about what it should be’.4 In the words of John Austin: The existence of law is one thing; its merit or demerit is another. -
Gustav Radbruch
Vanderbilt Law Review Volume 14 Issue 1 Issue 1 - December 1960 Article 9 12-1960 Gustav Radbruch Wolfgang Friedmann Follow this and additional works at: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr Part of the Jurisprudence Commons, and the Legal History Commons Recommended Citation Wolfgang Friedmann, Gustav Radbruch, 14 Vanderbilt Law Review 191 (1960) Available at: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol14/iss1/9 This Article is brought to you for free and open access by Scholarship@Vanderbilt Law. It has been accepted for inclusion in Vanderbilt Law Review by an authorized editor of Scholarship@Vanderbilt Law. For more information, please contact [email protected]. GUSTAV RADBRUCH WOLFGANG FRIEDMANN* As recently as the end of the last World War the name and work of Gustav Radbruch were virtually unknown in the Anglo-American legal world. In 1938 Roscoe Pound, in his encyclopedic survey, Fifty Years of Jurisprudence,' had given a concise account of Radbruch's legal philosophy in the context of his section on "neo-idealism." In 1944 Anton Hermann Chroust 2 wrote a penetrating analysis of Rad- bruch's philosophy of law, and about the same time the first edition of the present writer's Legal Theory, published on the other side of the Atlantic, included Gustav Radbruch in the survey of major legal philosophers. It also acknowledged the author's deep indebtedness to Radbruch's principal work.3 Since Radbruch died in 1949 at the age of seventy-one, there has been a dramatic and welcome change. Not only has he remained the dominating figure in post-war Continental and especially German legal philosophy; in both Britain and the United States his work and views have been discussed by leading jurists such as Professors Campbell and Hart in Britain, and Professors Fuller and Patterson in this country. -

Ementas E Bibliografia Do Doutorado
Ementas e bibliografia do Doutorado DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS Ementa O objetivo desta disciplina é abordar questões relacionadas à Teoria da Democracia, compreendida como procedimento e substância, as relações da democracia com constitucionalismo, discutindo as relações do direito com a política, e a separação de poderes no Estado contemporâneo. Pretende ainda, apresentar as teorias deliberativas e teorias agregativas, bem como as críticas que lhe são dirigidas, finalizando com questões do constitucionalismo popular e teoria dos direitos fundamentais, bem como com o problema da concretização dos direitos humanos e fundamentais. Referências Bibliográficas ALMEIDA FILHO, Agassiz. Glória política de um império tropical: a formação do constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, ano 38, n. 149, jan-março 2001. ALVES, Fernando de Brito. Margens do Direito: a nova fundamentação dos direitos de minorias. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2010. ______. Constituição e participação popular. Curitiba: Juruá, 2013. ARAGON, Manuel. Constituición y democracia: temas clave de la consituición española. Madrid: Tecnos, 1989. ARANHA, Márcio Iorio. Interpretação constitucional e as garantias institucionais dos direitos fundamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. ARDANT, Philippe. Institutions politiques e droit constitutionnel. 11 ed. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), 1999. BIELSA, Rafael. Democracia y republica. Buenos Aires: Depalma, 1985. BIRCH, Anthony H.Concepts and theories of modern democracy. Routledge, 2007. CANOTILHO, J. J. Gomes. Das Constituições dos Direitos à Crítica dos Direitos. Direto Público. 07, jan.-fev., 2005. ______. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003. CARBONELL, Miguel, Derecho constitucional aspiracional. Problemas de nominalismo constitucional (Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM, México, 2002).