Mendelssohn Studien
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
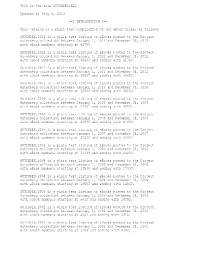
This Is the File GUTINDEX.ALL Updated to July 5, 2013
This is the file GUTINDEX.ALL Updated to July 5, 2013 -=] INTRODUCTION [=- This catalog is a plain text compilation of our eBook files, as follows: GUTINDEX.2013 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2013 and December 31, 2013 with eBook numbers starting at 41750. GUTINDEX.2012 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2012 and December 31, 2012 with eBook numbers starting at 38460 and ending with 41749. GUTINDEX.2011 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2011 and December 31, 2011 with eBook numbers starting at 34807 and ending with 38459. GUTINDEX.2010 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2010 and December 31, 2010 with eBook numbers starting at 30822 and ending with 34806. GUTINDEX.2009 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2009 and December 31, 2009 with eBook numbers starting at 27681 and ending with 30821. GUTINDEX.2008 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2008 and December 31, 2008 with eBook numbers starting at 24098 and ending with 27680. GUTINDEX.2007 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2007 and December 31, 2007 with eBook numbers starting at 20240 and ending with 24097. GUTINDEX.2006 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2006 and December 31, 2006 with eBook numbers starting at 17438 and ending with 20239. -

Helmut Hasse Und Die Familie Mendelssohn
Helmut Hasse und die Familie Mendelssohn Peter Roquette, 29.10.2012 Vor einigen Jahren erhielt ich von Martin Kneser, dem Schwiegersohn von Helmut Hasse, eine Mappe mit einer Reihe von Papieren aus dem Hasse- Nachlass, die mehr oder minder privaten Charakter tragen und wohl des- halb von Hasse nicht zur Ubergabe¨ an das Archiv der G¨ottinger Universit¨at vorgesehen waren. Unter diesen fand sich ein Blatt mit einem sogenannten Familienstammbaum der Familie Mendelssohn. Darin sind eine Reihe von Namen bekannter Mathematiker zu finden. Das ist nicht neu, aber es ist wohl nicht ganz uninteressant, dass hier auch der Name von Helmut Hasse erscheint. Aufgrund dieses Stammbaums ist Hasse zwar nicht direkter Nachfahre eines Mendelssohn, aber einer der Vorfahren von Hasse, mit Namen Daniel Itzig (1722-1799), war mit den Mendelssohns verschw¨agert. Das Blatt enth¨alt zus¨atzlich die Angabe einiger literarischer Quellen als Beleg fur¨ die in Rede stehenden Verwandtschaftsbeziehungen. Diese Quellen- angaben waren, wie es scheint, von Martin Kneser hinzugefugt¨ worden. Ich habe das Blatt ausgedruckt und lege es im Anhang bei. Dabei habe ich den Namen des britischen Mathematikers Walter Hayman, eines Enkels von Kurt Hensel, hinzugefugt,¨ der sich auf dem Original nicht befindet. Hasse pflegte in kleinem Kreise gerne uber¨ seine Verwandtschaft mit den Mendelssohns zu erz¨ahlen, offenbar nicht nur weil er als Klavierspieler mit der Musik von Felix Mendelssohn vertraut war. (Sein Lieblings-Komponist war allerdings Beethoven.) Sondern es war fur¨ ihn auch wichtig, dass dadurch seine wenn auch nur entfernte Verwandtschaft mit seinem von ihm verehrten akademischen Lehrer Kurt Hensel bezeugt wurde. -

A Sprig of the Mendelssohn Family Tree
A Sprig of the Mendelssohn Family Tree Edward Gelles The progeny of Moses Mendelssohn, the 18th century German philosopher and pillar of Jewish Enlightenment, possess an illustrious ancestry. Moses Mendelssohn’s mother .was a direct descendant of the 16th century Jewish community leader and Polish statesman Saul Wahl, a scion of the Katzenellenbogen Chief Rabbis of Padua and Venice. More widely known than his famous grandfather Moses Mendelssohn is the composer Felix Mendelssohn-Bartholdy. The latter’s sister Fanny was also a highly gifted musician, who was overshadowd by her renowned brother. The early generations of the Mendelssohns were connected by marriage to distinguished families of their time, such as the Guggenheim, Oppenheimer, Wertheimer, Salomon, and Jaffe (Itzig), from whose ranks prominent Court Jews and other notables had emerged in Germany and Austria.. In a study of some descendants of my ancestor Saul Wahl I used DNA tests to show that my own lineage exhibited some significant matches with latter day members of the above mentioned old Ashkenazi families. While the genealogy of the Mendelssohn main line is well documented there has hitherto been a lack of relevant genetic data. Sheila Hayman, who is a descendant of Fanny Mendelssohn, agreed to take a “Family Finder” autosomal DNA test, the results of which are outlined below in so far they shed light on our family connections © EDWARD GELLES 2015 Ancestry of Sheila Hayman As may be seen from the appended family tree of Sheila Hayman, she is the daughter of a Jewish Professor of German extraction and an English Quaker mother. -

Karel Rychlík (1885–1968)
Karel Rychlík (1885–1968) Life and work of Karel Rychlík In: Magdalena Hykšová (author): Karel Rychlík (1885–1968). (English). Praha: Prometheus, 2003. pp. 265–276. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/401163 Terms of use: © Hykšová, Magdalena Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use. This document has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://dml.cz ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo*******************************************ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 8 LIFE AND WORK OF KAREL RYCHLÍK oo 8.1 INTRODUCTION The monograph is devoted to the life and work of the Czech mathematician Karel Rychlík. The first chapter contains the brief overview of Rychlík’s life, the survey of his scientific and pedagogical activities and the detailed description of his life story. The subsequent five chapters discuss particular groups of Rych- lík’s publications: 2. Algebra and Number theory, 3. Works on Mathematical Analysis, 4. Textbooks, Popularizing Papers, Translations, 5. Karel Rychlík and Bernard Bolzano, 6. Other Works on History of Mathematics. These chapters are conceived separately, each of them is provided with the conclusion and the list of references. The seventh chapter presents the list of Rychlík’s publications, reviews and lectures at Charles University, at the Czech Technical University and in the Union of Czech Mathematicians and Physicists. The book ends with the pic- torial appendix, the survey of abbreviations and the name index. The aim of this summary is to provide the basic information on Rychlík’s life and on his most important mathematical results. -

DIE P-ADISCHEN ZAHLEN 1. Hensels Grundsteinlegung Die
DIE P-ADISCHEN ZAHLEN JORN¨ STEUDING ”Die vielseitige Anwendbarkeit der Potenzreihendarstllungen in der komplexen Funktionentheo- rie war es, die Hensel den Gedanken gab, ein entsprechendes wirksames Handwerkszeug auch fur¨ die Zahlentheorie zu schaffen, und ihn so auf die p-adischen Zahlen fuhrte.”¨ (Helmut Hasse, [52], S. 143) 1. Hensels Grundsteinlegung Die Motivation fur¨ die p-adischen Zahlen liegt in den Analogien zwischen ganzen Zah- len und Polynomen mit ganzzahligen Koeffizienten. Ahnlich¨ der Primfaktorzerlegung ganzer Zahlen lassen sich solche Polynome multiplikativ in nicht weiter zerlegbare (ir- reduzible) Polynome zerlegen. Beobachtungen dieser Art lieferten im 19. Jahrhundert weitreichende Konzepte zur Behandlung zahlentheoretischer Problemstellungen; hierbei ist in erster Linie die Berliner Schule um Ernst Eduard Kummer (1810-1893), Karl Wei- erstraß (1815-1897) und Leopold Kronecker (1823-1891) zu nennen. Bereits 1857, also in dem Jahr bevor Weierstraß nach Berlin kam, forderte er Kronecker angesichts des- sen Ausfuhrungen¨ zur algebraischen Zahlentheorie auf, ”dieselben Principien auf alge- braische Functionen einer Variablen anzuwenden” (Kronecker [74], S. 303; siehe ebenso Ullrich [137], S. 165). Kronecker folgte diesem weitblickenden Ratschlag Weierstraß’ und entwickelte eine solche Theorie der algebraischen Funktionen. Tats¨achlich hatte diese wiederum einen Effekt auf rein zahlentheoretische Fragestellungen; das Verbindungsglied hierbei sind, wie wir im Folgenden illustrieren wollen, die p-adischen Zahlen. Einem Polynom n n−1 anX + an−1X + ... + a1X + a0 sieht man sein Werteverhalten an seinen Koeffizienten an; beispielsweise haben reelle kubische Polynome bei X + bzw. ein unterschiedliches Vorzeichen und neh- → ∞ −∞ men daher jeden reellen Wert an. In der komplexen Analysis werden Funktionen einer komplexen Ver¨anderlichen untersucht und entsprechend betrachtet man dort Potenzrei- henentwicklungen ∞ m m am(X x ) = a + a (X x )+ .. -

Vida Y Obra De Gustav Lejeune Dirichlet 1805-1859
Edición digital para la Biblioteca Digital del ILCE Título original: The Life and Work of Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) © De la traducción: Emilio Méndez Pinto Publicado originalmente en Clay Mathematics Proceedings, Vol. 7, 2007. Tanto la American Mathematical Society como el profesor Elstrodt han concedido sus respectivos permisos para la traducción y publicación digital de esta obra en esta colección. Prohibida su reproducción por cualquier medio mecánico o eléctrico o de cualquier otro tipo sin la autorización por escrito de los coeditores. 2 Dedicado a Jens Mennicke, mi amigo durante muchos años CONTENIDOS Introducción 4 1. Antecedentes familiares y educación escolar 4 2. Estudio en París 7 3. Entrada al Servicio Civil Prusiano 11 4. Habilitación y profesorado en Breslau 14 5. Transferencia a Berlín y matrimonio 18 6. Enseñanza en la Escuela Militar 22 7. Dirichlet como profesor en la Universidad de Berlín 23 8. Trabajos matemáticos 28 9. Amistad con Jacobi 46 10. Amistad con Liouville 48 11. Vicisitudes de vida 49 12. Dirichlet en Göttingen 50 Conclusión 53 Referencias 54 3 Introducción Los grandes avances de las matemáticas en Alemania durante la primera mitad del siglo diecinueve están asociados, en una medida predominantemente grande, con el trabajo pionero de C. F. Gauss (1777-1855), C. G. J. Jacobi (1804-1851), y G. Lejeune Dirichlet (1805-1859). De hecho, virtualmente todos los principales matemáticos alemanes de la segunda mitad del siglo diecinueve fueron sus discípulos, o discípulos de sus discípulos. Esto es verdad hasta un grado especial para Jacobi y Dirichlet, quienes introdujeron con mucho éxito un nuevo nivel de enseñanza fuertemente orientado a sus investigaciones, mientras que Gauss tuvo “un disgusto real” por la enseñanza – al menos al pobre nivel predominante cuando Gauss comenzó su carrera. -

Journal Für Die Reine Und Angewandte Mathematik
BAND 746 · JANUAR 2019 Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal) GEGRÜNDET 1826 VON August Leopold Crelle FORTGEFÜHRT VON Carl Wilhelm Borchardt ∙ Karl Weierstrass ∙ Leopold Kronecker Lazarus Fuchs ∙ Kurt Hensel ∙ Ludwig Schlesinger ∙ Helmut Hasse Hans Rohrbach ∙ Martin Kneser ∙ Peter Roquette GEGENWÄRTIG HERAUSGEGEBEN VON Tobias H. Colding, Cambridge MA ∙ Jun-Muk Hwang, Seoul Daniel Huybrechts, Bonn ∙ Rainer Weissauer, Heidelberg Geordie Williamson, Sydney JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK (CRELLES JOURNAL) GEGRÜNDET 1826 VON August Leopold Crelle FORTGEFÜHRT VON August Leopold Crelle (1826–1855) Peter Roquette (1977–1998) Carl Wilhelm Borchardt (1857–1881) Samuel J. Patterson (1982–1994) Karl Weierstrass (1881–1888) Michael Schneider (1984–1995) Leopold Kronecker (1881–1892) Simon Donaldson (1986–2004) Lazarus Fuchs (1892–1902) Karl Rubin (1994–2001) Kurt Hensel (1903–1936) Joachim Cuntz (1994–2017) Ludwig Schlesinger (1929–1933) David Masser (1995–2004) Helmut Hasse (1929–1980) Gerhard Huisken (1995–2008) Hans Rohrbach (1952–1977) Eckart Viehweg (1996–2009) Otto Forster (1977–1984) Wulf-Dieter Geyer (1998–2001) Martin Kneser (1977–1991) Yuri I. Manin (2002–2008) Willi Jäger (1977–1994) Paul Vojta (2004–2011) Horst Leptin (1977–1995) Marc Levine (2009–2012) GEGENWÄRTIG HERAUSGEGEBEN VON Tobias H. Colding Jun-Muk Hwang Daniel Huybrechts Rainer Weissauer Geordie Williamson AUSGABEDATUM DES BANDES 746 Januar 2019 CONTENTS A. Ichino, S. Yamana, Periods of automorphic forms: The case of ( Un − 1 × Un , Un ) . 1 L. Ambrosio, A. Pinamonti, G. Speight, Weighted Sobolev spaces on metric measure spaces . 39 J. Kaad, R. Nest, Canonical holomorphic sections of determinant line bundles . 67 W. Ou, Lagrangian fibrations on symplectic fourfolds . -

On the Kronecker Nachlass 423
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Elsevier - Publisher Connector HISTORIA MATHEMATICA 5 (1978), 419-426 ON THE KRONECKERNACHLASS BY HAROLD M , EDWARDS t COURANT INST, OF MATH, SCI,, NYU SUMMARIES This article is an account of my unsuccessful efforts to find the Nachlass of Leopold Kronecker (1823-1891), and of my reasons for believing that these papers survived intact until 1945 but then were accidentally destroyed. In the same accident, I believe, the papers of Kurt Hensel (1861-1941) and many other valuable documents were lost. Cet article est le r&it de mes efforts infructueux pour trouver les Nachlass, de Leopold Kronecker (1823-1891). Nous y elaborons aussi les raisons qui nous font croire que ces papiers furent conserves intacts jusqu'en 1945, alors qu'ils furent accidentellement detruits. Le m&me accident serait, a notre avis, la cause de la perte des papiers de Kurt Hensel (1861-1941) et de beaucoup d'autres documents de valeur. Initially my interest in Kronecker's scientific manuscripts or Nachlass was stimulated by my quest for Kummer's papers [Edwards 1975, X9-2361. In particular, I hoped that it might be possible to find the originals of the letters from Kummer to Kronecker which Hensel excerpted in his Kummer memorial volume [Hensel 19101. This led me naturally to Hensel and to Hensells Lieblingsschiiler Helmut Hasse (1898- ). In the meantime, I had taken note of Pierre Dugac's remark in this journal [Historia Mathematics 1976, S-191 about the lack of any Kronecker Nachlass, and this stimulated my interest in finding any of Kronecker's papers, not merely Kummer's letters to him. -

Rigg Bm.Pdf (651.5Kb)
notes note on sources Although oral testimonies are subject to fallible human memories, they have none- theless proven invaluable in explaining several documents collected for this study. Documents never before seen by historians, found in people’s closets, basements, and desk drawers, created a much fuller and complex history, especially when their owners supplied the background and history of the documents as well. These sources helped re-create the unique and tragic history of the Mischlinge, which is still so little understood over half a century later. The thousands of pages of documents and oral testimonies (on 8 mm video and VHS video) in this study are now part of the permanent collection at the Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg, Germany, as the Bryan Mark Rigg Collection. Although interviews need to be treated with some skepticism, they have repeatedly shown that oral history often enriches rather than contradicts historical documents. All too often, history is written without the human element, that is, without knowing what these people thought, felt, and believed. Oral history helps reconstruct many of these people’s thoughts, feelings, and beliefs through their diaries, letters, interviews, and photographs. In this way, a healthy combination of hard documents or primary sources and secondary sources and testimonies expands our sense of this history. Often one reads about men and women but feels no human connection with them. The interviews were done to try to bridge this gap and to pro- vide readers with the means to enter these men’s and women’s thoughts and feelings to understand them better and to deepen readers’ knowledge of this history. -

Aspects of Zeta-Function Theory in the Mathematical Works of Adolf Hurwitz
ASPECTS OF ZETA-FUNCTION THEORY IN THE MATHEMATICAL WORKS OF ADOLF HURWITZ NICOLA OSWALD, JORN¨ STEUDING Dedicated to the Memory of Prof. Dr. Wolfgang Schwarz Abstract. Adolf Hurwitz is rather famous for his celebrated contributions to Riemann surfaces, modular forms, diophantine equations and approximation as well as to certain aspects of algebra. His early work on an important gener- alization of Dirichlet’s L-series, nowadays called Hurwitz zeta-function, is the only published work settled in the very active field of research around the Rie- mann zeta-function and its relatives. His mathematical diaries, however, provide another picture, namely a lifelong interest in the development of zeta-function theory. In this note we shall investigate his early work, its origin and its recep- tion, as well as Hurwitz’s further studies of the Riemann zeta-function and allied Dirichlet series from his diaries. It turns out that Hurwitz already in 1889 knew about the essential analytic properties of the Epstein zeta-function (including its functional equation) 13 years before Paul Epstein. Keywords: Adolf Hurwitz, Zeta- and L-functions, Riemann hypothesis, entire functions Mathematical Subject Classification: 01A55, 01A70, 11M06, 11M35 Contents 1. Hildesheim — the Hurwitz Zeta-Function 1 1.1. Prehistory: From Euler to Riemann 3 1.2. The Hurwitz Identity 8 1.3. Aftermath and Further Generalizations by Lipschitz, Lerch, and Epstein 13 2. K¨onigsberg & Zurich — Entire Functions 19 2.1. Prehistory:TheProofofthePrimeNumberTheorem 19 2.2. Hadamard’s Theory of Entire Functions of Finite Order 20 2.3. P´olya and Hurwitz’s Estate 21 arXiv:1506.00856v1 [math.HO] 2 Jun 2015 3. -

Jarník's Notes of the Lecture Course Allgemeine Idealtheorie by B. L
Jarník’s Notes of the Lecture Course Allgemeine Idealtheorie by B. L. van der Waerden (Göttingen 1927/1928) Monographs and Textbooks in Algebra at the Turn of the 20th Century In: Jindřich Bečvář (author); Martina Bečvářová (author): Jarník’s Notes of the Lecture Course Allgemeine Idealtheorie by B. L. van der Waerden (Göttingen 1927/1928). (English). Praha: Matfyzpress, 2020. pp. 61–110. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/404381 Terms of use: Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use. This document has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://dml.cz 61 MONOGRAPHS AND TEXTBOOKS IN ALGEBRA at the turn of the 20th century 1 Introduction Algebra as a mathematical discipline was initially concerned with equation solving. It originated in ancient Egypt and Mesopotamia four thousand years ago, and somewhat later also in ancient China and India. At that time, equations in the present sense, i.e., formal expressions based on a certain, perhaps very primitive notation, did not exist yet. The ancient arithmeticians were able to solve word problems leading to equations or their systems by means of meticulously memorized procedures, which can be nowadays aptly designated as algorithms. They have successfully tackled a number of problems, which often correspond to present-day problems of school mathematics, sometimes being much more difficult. Their methods of calculation largely correspond to our procedures used for solving equations or their systems. -

History of Valuation Theory Part I
History of Valuation Theory Part I Peter Roquette (Heidelberg)∗ 23.7.2003 Abstract The theory of valuations was started in 1912 by the Hungarian mathe- matician Josef K¨ursch´akwho formulated the valuation axioms as we are used today. The main motivation was to provide a solid foundation for the theory of p-adic fields as defined by Kurt Hensel. In the following decades we can observe a quick development of valuation theory, triggered mainly by the discovery that much of algebraic number theory could be better understood by using valuation theoretic notions and methods. An out- standing figure in this development was Helmut Hasse. Independent of the application to number theory, there were essential contributions to valuation theory given by Alexander Ostrowski, published 1934. About the same time Wolfgang Krull gave a more general, universal definition of valuation which turned out to be applicable also in many other mathe- matical disciplines such as algebraic geometry or functional analysis, thus opening a new era of valuation theory. In the present article which is planned as the first part of more to come, we report on the development of valuation theory until the ideas of Krull about general valuations of arbitrary rank took roots. That is, we cover the pre-Krull era. As our sources we use not only the published articles but also the information contained in letters and other material from that time, mostly but not exclusively from the legacy of Hasse at the University library at G¨ottingen. ∗This copy contains some minor corrections of the published version.