1 Der Goldene Reiter - Ein Wahrzeichen Dresdens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Japanese Palace in Dresden: a Highlight of European 18Th-Century
都市と伝統的文化 The ‘Japanese Palace’ in Dresden: A Highlight of European 18th-century Craze for East-Asia. Cordula BISCHOFF Dresden, seat of government and capital of present-day federal state Saxony, now benefits more than any other German city from its past as a royal residence. Despite war-related destructions is the cityscape today shaped by art and architecture with a history of 500 years. There is possibly no other place in Germany where to find so many exceptional artworks concentrated in such a small area. This accumulation is a result of the continuosly increasing significance of the Dresden court and a gain in power of the Saxon Wettin dynasty. The Holy Roman Empire of the German Nation was a conglomeration of more than 350 large and tiny territories. The 50 to 100 leading imperial princes struggled in a constant competition to maintain their positions. 1) In 1547 the Saxon Duke Moritz(1521-1553)was declared elector. Thus Saxony gained enormous political significance, as the seven, in 18th century nine electors, were the highest-ranking princes. They elected the Roman-German emperor and served as his innermost councils. The electors of Saxony and of the Palatinate were authorised to represent the emperor in times of vacancy. At the same time in 16th century Saxony rose due to its silver mining industry to one of the richest German territorial states. 2) In the second half of the 17th century the Saxon court even counted among the most important European courts. A peak of political power was reached under Frederick August(us)I. -

SCHLOESSERLAND SACHSEN. Fireplace Restaurant with Gourmet Kitchen 01326 Dresden OLD SPLENDOR in NEW GLORY
Savor with all your senses Our family-led four star hotel offers culinary richness and attractive arrangements for your discovery tour along Sa- xony’s Wine Route. Only a few minutes walking distance away from the hotel you can find the vineyard of Saxon master vintner Klaus Zimmerling – his expertise and our GLORY. NEW IN SPLENDOR OLD SACHSEN. SCHLOESSERLAND cuisine merge in one of Saxony’s most beautiful castle Dresden-Pillnitz Castle Hotel complexes into a unique experience. Schloss Hotel Dresden-Pillnitz August-Böckstiegel-Straße 10 SCHLOESSERLAND SACHSEN. Fireplace restaurant with gourmet kitchen 01326 Dresden OLD SPLENDOR IN NEW GLORY. Bistro with regional specialties Phone +49(0)351 2614-0 Hotel-owned confectioner’s shop [email protected] Bus service – Elbe River Steamboat jetty www.schlosshotel-pillnitz.de Old Splendor in New Glory. Herzberg Żary Saxony-Anhalt Finsterwalde Hartenfels Castle Spremberg Fascination Semperoper Delitzsch Torgau Brandenburg Senftenberg Baroque Castle Delitzsch 87 2 Halle 184 Elsterwerda A 9 115 CHRISTIAN THIELEMANN (Saale) 182 156 96 Poland 6 PRINCIPAL CONDUCTOR OF STAATSKAPELLE DRESDEN 107 Saxony 97 101 A13 6 Riesa 87 Leipzig 2 A38 A14 Moritzburg Castle, Moritzburg Little Buch A 4 Pheasant Castle Rammenau Görlitz A72 Monastery Meissen Baroque Castle Bautzen Ortenburg Colditz Albrechtsburg Castle Castle Castle Mildenstein Radebeul 6 6 Castle Meissen Radeberg 98 Naumburg 101 175 Döbeln Wackerbarth Dresden Castle (Saale) 95 178 Altzella Monastery Park A 4 Stolpen Gnandstein Nossen Castle -
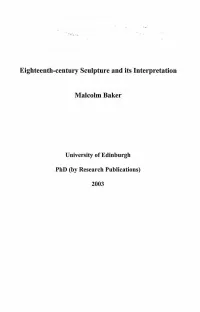
Eighteenth-Century Sculpture and Its Interpretation
Eighteenth-century Sculpture and its Interpretation Malcolm Baker University of Edinburgh PhD (by Research Publications) 2003 Eighteenth-century sculpture and its interpretation Publications by Malcolm Baker submitted for Degree of Ph.D by Research Publications The following publications are submitted for the above degree: 1. Figured in Marble. The Making and Viewing of Eighteenth-century Sculpture, London and Los Angeles, 2000. (65,431 words) 2. Roubiliac and The Eighteenth-century Monument. Sculpture as Theatre, New Haven and London, 1995, 207-273, 382-387. (23,337 words) (The text submitted by the candidate forms part of a collaborative work by David Bindman and Malcolm Baker; the volume is made up of several distinct authorial contributions and the responsibility of each author for different parts is clearly stated in the publication.) 3. They are accompanied by a Critical Review (10, 956 words) (Total word length: 99, 724 words.) Appendix I: Catalogue of Roubiliac's Funerary Monuments, forming Part III of Roubiliac and the Eighteenth-century Monument, 275-359 Appendix II: A list of ten related articles. 1 and 2, along with the Critical Review, were written solely by me. The text included under Appendix I was written almost entirely by me but incorporates some material provided by David Bindman and Tessa Murdoch. The articles listed in Appendix II were written solely by me, except for one article of which I was the principal author, the co-authors being Alastair Laing and Colin Harrison. I also declare that none of the above mentioned writings have been submitted for any other degree or professional qualification. -

804,5 Jahre Dresden
TU Dresden, Fakultät Architektur Prof. Dr. Hans-Georg Lippert Vorlesung Baugeschichte (Hauptstudium) Winter 2010/11 804,5 Jahre Dresden Vorlesungsprogramm Vorlesung Datum Vortragender Thema 1 12.10.2010 H.-G. Lippert Die Stadt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 2 19.10.2010 Walter May Das barocke Dresden I 3 26.10.2010 Walter May Das barocke Dresden II 4 02.11.2010 Henrik Karge Die Stadt des 19. Jhs. I (Gottfried Semper) 5 09.11.2010 H.-G. Lippert Die Stadt des 19. Jhs. II (Industrialisierung) 6 16.11.2010 H.-G. Lippert Die Stadt der Lebensreform 7 23.11.2010 Tanja Scheffler Expressionismus und Neue Sachlichkeit 8 30.11.2010 H.-G. Lippert Gauhauptstadt Dresden 9 07.12.2010 Thomas Will Nach 1945 I: Wiederaufbau der Monumente 10 14.12.2010 H.-G. Lippert Nach 1945 II: Nationale Traditionen 21.12.2010 Keine Vorlesung Weihnachtspause 11 11.01.2011 Kerstin Zaschke Hochschulstadt Dresden 12 18.01.2011 Susann Buttolo Die sozialistische Großstadt 13 25.01.2011 Die „europäische Stadt“ Filmreihe: (jeweils Mittwoch, 18:30 Uhr, HSZ 0004. Unkostenbeitrag: 2,00 €): 20.10.2010: Frühlingssinfonie (R.: Peter Schamoni, D 1983) 15.12.2010: Wenn du groß bist, lieber Adam (R.: Egon Günther, DDR 1965) 19.01.2011: Fünf Tage – fünf Nächte (R.: Lew Arnstam, DDR/UdSSR 1960) 02.02.2011: Der Rote Kakadu (R.: Dominik Graf, D 2004) TU Dresden, Fakultät Architektur Prof. Dr. Hans-Georg Lippert Vorlesung Baugeschichte (Hauptstudium) Winter 2010/11 804,5 Jahre Dresden 1. Vorlesung Die Stadt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit Daten: Geschichte (I) • um 1100 v. -

CHAPTER ONE Page 23
FREDERICK THE GREAT‟S PORCELAIN DIVERSION: THE CHINESE TEA HOUSE AT SANSSOUCI Tania Solweig Shamy Department of Art History and Communication Studies McGill University, Montreal October 2009 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of doctor of philosophy. ©Tania Solweig Shamy 2009 Abstract This thesis signals a new approach in the study of the Chinese Tea House at Sanssouci. It argues that Frederick the Great‟s exotic pavilion, although made of sandstone and stucco, is porcelain in essence. The garden building reflects the many meanings of this highly valued commodity and art form in the privileged society of the king and his contemporaries. The pavilion is unique in that it was inspired by the type of sculptural ornament designed to decorate the eighteenth- century table of the nobility. The Tea House is a thematically integrated structure that demonstrates the influence of porcelain on interior décor and architecture. The designation of the garden building as a Gesamtkunstwerk acknowledges the blending of architecture, painting, and sculpture; characteristics shared by porcelain centerpieces. They exemplify the intermediality associated with the development of eighteenth- century porcelain and the interpretation of Frederick‟s pavilion. ii Résumé Cette thèse annonce une approche nouvelle dans l‟étude de la Maison de Thé Chinoise à Sans-Souci. Elle soutient que le pavillon exotique de Frédéric Le Grand, fait de pierre et de stuc, représentait intrinsèquement la porcelaine. Ainsi, cette construction de jardin refléterait de fait les sens multiples accordés par la société privilégiée du Roi et de ses contemporains à cette commodité de luxe et à cette forme d‟art. -

Pöppelmann 3D. Bücher – Pläne – Raumwelten
Tiller, Elisabeth/Lieber, Maria (Hrsg.): Pöppelmann 3D. Bücher – Pläne – Raumwelten. Online-Katalog zur Ausstellung im Buchmuseum der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) vom 17. Mai bis 01. September 2013. Zweite, durchgesehene Version (August 2013). URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-118312 Die Ausstellung ist Ergebnis der Zusammenarbeit des TU Dresden-Teilprojekts „Baroque Fantasies - Creating Exotic Spaces. The Case of Dresden“ im europäischen Forschungsverbund European Network for Baroque Cultural Heritage (ENBaCH) mit der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH. Sie wurde maßgeblich finanziert aus Mitteln des Culture Programme der Europäischen Kommission. INHALT Matthäus Daniel Pöppelmann (1662 – 1736) ›› 4 Bibliotheksbestand ›› 104 Bücherwissen und Architektur ›› 11 Erbauung und Unterhaltung ›› 104 Residenzschloss und Zwinger ›› 13 Dresden – Sachsen – Polen ›› 114 Römische Entwurfsvorlagen ›› 17 Europäische Geschichte ›› 123 Perspektivzeichnen ›› 41 Gebrauchsliteratur ›› 131 Festungsbaukunde ›› 47 Ferne Länder ›› 137 Portaltürme des Dresdner Zwingers ›› 49 Privatbibliotheken in der Barockzeit ›› 143 Große Schlossplanung für Dresden ›› 53 Die kurfürstliche Bibliothek und das barocke Asienbild ›› 152 Säulenbücher ›› 57 Literaturverzeichnis ›› 161 Hofbauwesen ›› 67 Buchinventar Pöppelmanns laut Mechanik ›› 70 Nachlassakte ›› 185 Zwingerstichwerk ›› 74 Impressum ›› 200 MATTHÄUS -

German and Austrian Eighteenth-Century Sculpture and Decorative Arts: Recent Acquisitions at the Metropolitan Museum of Art
German and Austrian Eighteenth-Century Sculpture and Decorative Arts: Recent Acquisitions at The Metropolitan Museum of Art Ian Wardropper Director of The Frick Collection Former Iris and B. Gerald Cantor Chairman of the Department of European Sculpture and Decorative Arts, The Metropolitan Museum of Art 17 he Department of European Sculpture and Decorative Arts Figure 1: View of Gallery of Central Europe, 1700-1800, showing a suite of furniture for Seehof, circa 1763-64. at the Metropolitan Museum of Art is justly famed for its French, English, and Italian collections. A series of period Trooms—The Wrightsman Galleries—are filled with some Renaissance jewellery and metalwork, Rococo gold boxes, and of the most important decorative arts outside France, and superb carvings, such as Hans Daucher’s honestone relief eighteenth- and nineteenth-century French masters Jean-Antoine Allegory of Virtues and Vices at the Court of Charles V, dated Houdon, Clodion, Jean-Baptiste Carpeaux, and Auguste Rodin, 1522. The extensive Mühsam collection of fifteenth- to nineteenth- among many others, are represented by marble, bronze, and century glass, split evenly with the Art Institute of Chicago, entered terracotta sculpture at the highest level of quality and in great the Museum in 1927 with help from the Munsey Fund. The depth. Centered on period rooms by Robert Adam, the Annie Laurie Museum’s most significant class of German objects—works in Aitken Galleries display fine British furniture, silver, and ceramics. porcelain and pottery—was built up over half a century with gifts Italian Renaissance bronzes and maiolica, as well as important or bequests of a series of stellar collections. -

Art and Culture Entertainment, Dining and Shopping Nature and Activities Young and Trendy Science and Research Business and Convention
Welcome to Dresden Art and Culture Entertainment, Dining and Shopping Nature and Activities Young and Trendy Science and Research Business and Convention For centuries, it was the magnificent residence of the Wettin royal Dresden’s “noble position” may have been fashioned by nature, but it Dresden is a feast for the senses. When Augustus the Strong ruled The interplay of culture and landscape along the banks of the Elbe As the sun sets behind the Frauenkirche, a different Dresden begins The first porcelain in Europe was manufactured in Dresden. Other Often referred to as “Silicon Saxony”, this fastest-growing region in family. Today, Dresden is one of the most beautiful Baroque cities in was the love of art and the creative will of the Saxon Electors (and Saxony, he was famous for his lavish celebrations, combining art counts as one of Dresden’s greatest treasures. No other city has been to emerge. On the fringes of the Neustadt district and in the former pioneering developments – the bra or coffee filter papers – may merely the former East Germany is Europe’s leading location for the Europe – and a bustling metropolis at the same time. Because of its later the bourgeoisie) that created its unique cultural landscape. This and enjoyment in elaborate productions. Likewise today, you are quite as successful in keeping such an extensive floodplain free of industrial area of the city, a tightly-knit club and party scene has raise a wry smile. But Dresden’s reputation as a highly creative city development of memory chips and a major centre of hi-tech industry. -

100 Years Later
➜ ➜ Our starting point is the Rathaus (City hall) on Dr.- sculptor Ernst Rietschel. However, all else pales next former city fortifications. Below the balustrade you 14 Meissner Strasse. On the opposite side, you will see the former fortifications in the nine- Külz-Ring, which was built between 1904 and 1910. A to the unrivaled view of the Elbe with its period will see the Nymphenbad fountain, surrounded by the surviving gatehouse of the Weisses Tor (White teenth century, it has preserved its model of the city in the atrium shows the projects paddle-wheel steamers and the Neustadt on the far female sandstone figures. The fountain is modeled on Gate, 1827–29) at some distance to the left, and originality down through the ages, an intended to make Dresden once again one of the most shore. Roman and Tuscan originals. The splendid Baroque behind it a large Art Nouveau office building. attractive mixture of posh streets and beautiful cities in Germany. Now let us turn our attention once again to the architecture of the group, constructed by Matthäus Now cross the four-lane road at the tram stop and go narrow lanes, patrician houses and The Kreuzkirche (Church of the Holy Cross, 1), only immediate vicinity. The yellow, Neobaroque building Daniel Pöppelmann between 1710 and 1738 as a on across Palaisplatz with the fountain in the middle back courts full of nooks and crannies. a few steps away, now takes the place of the was once the palace of the second-born princes festival square, blends uniquely with the sculp- to Königstrasse (16). -

Export of Objects of Cultural Interest 2016-17
Export of Objects of Cultural Interest 2016 –17 Export of Objects of Cultural Interest 2016 –17 Presented to Parliament pursuant to Section 10 (1) (a) of the Export Control Act 2002 April 2018 © Crown copyright 2018 This publication is licensed under the terms of the Open Government Licence v3.0 except where otherwise stated. To view this licence, visit nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 Where we have identified any third party copyright information you will need to obtain permission from the copyright holders concerned. This publication is available at www.gov.uk/government/publications Any enquiries regarding this publication should be sent to us at [email protected] ISBN 978-1-5286-0167-2 CCS1217629440 04/18 Printed on paper containing 75% recycled fibre content minimum Printed in the UK by the APS Group on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office Cover image English tapestry in the Japan/Indian Manner Export of Objects of Cultural Interest 2016 –17 1 May 2016 to 30 April 2017 I Report of the Secretary of State II Report of the Reviewing Committee on the Export of Works of Art and Objects of Cultural Interest Export of Objects of Cultural Interest 2016–17 3 Export of Objects of Cultural Interest 2016–17 Annual report to Parliament By the Secretary of State for Digital, Culture, Media & Sport 4 Export of Objects of Cultural Interest 2016–17 The Reviewing Committee on the While on the subject of vases, Scotland also has cause to celebrate. National Museums Scotland, with support from Export of Works of Art and Objects the National Heritage Memorial Fund, was able to acquire of Cultural Interest one of four vases designed for Cardiff Castle by the noted architect and designer William Burges. -

PORCELAIN AS SCULPTURE by Clare Le Corbcillcr Associate Curator, European Sculpture & Decorative Arts, the Metropolitan Musucm of Art, New York
PORCELAIN AS SCULPTURE by Clare Le Corbcillcr Associate Curator, European Sculpture & Decorative Arts, The Metropolitan Musucm of Art, New York. Whether porcelain was suitable for sculpurc is a ques tion that might have been asked in the formative years of the European factories, but it was not. It was taken somewhat for granted: just as the China trade had pro vided both the impetus for the discovery and manufac ture of porcelain in the west, and an initial repertoire through its shiploads of blue and white useful wares, so it also provided us with blanc de chine figures that demonstrated the viability of porcelain as a sculptural medium. And by using the China trade as a kind of testing ground we in the west made tentative sculptural explorations, substituting, for example, Dutchmen for Asians on Buddhist lions and creating through such familiar models as the Dutch family group (Plate 1) what might best be termed souvenir sculpture. It had an im portant effect, however: surely it was familiarity with the white body of blanc dc chine and our attempts to manipulate the material (albeit at second hand) by ordering new models that prompted us to go one step further and produce our own porcelain sculpture. The visual and tactile parallel between Fukien and St. Cloud figures, for example, is too close to ignore. What Fukien sculpture did not offer, however, beyond a few models like the immensely popular one of Budai which was so widely copied in the European factories, was reper toire, and for that we had to turn elsewhere. -

Balthasar Permoser (Sazburg 1651 - Dresden 1732)
Balthasar Permoser (Sazburg 1651 - Dresden 1732) Autumn and Winter Circa: 1695 1695 Autumn signed 'BAT:P:INV' (to the back); Winter signed 'B.P.v' (to the front) 24 cm high (Auumn) and 22cm high (Winter) After having lived in Rome and worked for the Medici in Florence, Balthasar Permoser accepted an invitation to the court of the Elector of Saxony and moved to Dresden in 1690. Remaining in that city until his death (except for a period in Berlin), he produced a range of works, from monumental sculptures to devotional pieces full of pathos and exquisite ivory figures. Permoser’s series of the four seasons in ivory, signed and dated 1695, was executed in Dresden. The figures of Spring, Summer, Autumn and Winter were split into two pairs in the early 19th century while in Paris and only the female figures were returned to Braunschweig (now Herzog Anton Ulrich Museum). After almost two centuries of separation the four ivories were temporarily reunited on the occasion of the exhibition held in Florence in 2013 (see lit.). The elegant movement that animates the figures and the technical virtuosity in the carving make them masterpieces of the late Baroque period. Following the Renaissance tradition of representing Roman gods as personifications of the four seasons, Permoser carved a smiling figure of Flora (Spring), an energetic Ceres (Summer), a drunken Bacchus (Autumn) and an aged Vulcan (Winter). Permoser illustrated the theme more than once, not only in ivory but also on a monumental scale, as with the Ceres and Vulcan in stone at the Zwinger, Dresden (1714/1715)[1].