Die Literarische Karte Europas. Eine Studentenbefragung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hemingwaytg 2014.Indd
Examining an author’s life can inform and expand the reader’s understanding of a novel. Biographical criticism is the practice of analyzing a literary work through the lens of an author’s experience. In this lesson, explore the author’s life to understand the novel more fully. 1 Ernest Hemingway grew up in Oak Park, Illinois, one of six children. In Lesson One 1917, the year President Wilson declared war on Germany, Hemingway graduated from high school. Instead of going to college, he became a FOCUS: reporter for a small newspaper. As a journalist, Hemingway learned to write concisely, using active verbs and brief, clear paragraphs. Many young Biography men were entering the military, but Hemingway’s vision did not meet military standards. Instead, he applied to the Red Cross as an ambulance driver and, in 1918, found himself in France and then in Italy. A Farewell to Arms, published in 1929, draws on the details of his wartime injury, his friendships, and his love affairs. ?? Discussion Activities Listen to The Big Read Audio Guide. Students should take notes as they listen. Ask them to present the three most important points they learned from the Audio Guide. Distribute Reader’s Guide essays, “Introduction to the Novel,” “Ernest Hemingway, 1899- 1961,” and “Hemingway and World War I.” Divide the class into groups. Assign one essay to each group. After reading and discussing the essays, groups will present what they have learned to the class. Ask students to add creative twists to make their presentations memorable. ?? Writing Exercise Have students read Chapter I. -

2006-Os Esztendõre
NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre naptar.p65 1 2005.10.04., 15:38 NAPTÁR SZÁZTIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM Fõszerkesztõ: Bárd András Felelõs szerkesztõ: Csulák András Kiadja a Cental Kft. 1022 Budapest, Eszter u. 6/B Felelõs kiadó: Villás Károly ügyvezetõ igazgató Címlapterv: Dombrádi Norbert Címlapfotó: Jesztrebszki János Nyomdai elõkészítés: Hírözön Bt. Nyomdai elõállítás: Szikra Lapnyomda Rt., Budapest (xxxxxxxxx) Felelõs vezetõ: Máthé Sándor vezérigazgató Internet: www.szikralapnyomda.hu E.mail: [email protected] Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Elõfizethetõ közvetlen a postai kézbesítõknél, az ország bármely postáján. További információ: 06 80/444-444; [email protected] Árus terjesztés: Lapker Rt. Elõfizetõi ár: 560 Ft, utcai árusításban 590 Ft HU ISSN 0133-9613 Kincses Kalendárium 2 a 2006-os esztendõre naptar.p65 2 2005.10.04., 15:38 NAPTÁR Beköszöntõ Egymás után három egyes. 111. Ennyi esztendeje jelenik meg a Kincses Kalendári- um. Az évforduló nem kerek, de napilapkészítéshez szokott hírlapíró számára van vala- mi misztikus abban, hogy létezik olyan kiadvány, mely három évszázadon ível át, s éppen 111 éves. Kiadónk õriz néhányat az elsõ példányokból. Valamennyi izgalmas, érdekfeszítõ ol- vasmány. Korlenyomat, történelem. Pedig elõdeink se tettek mást, mint amivel magunk is próbálkozunk. Hû krónikáját adni a kornak, amelyben élünk, megfogalmazni remé- nyeinket, várakozásainkat. Beszámolni életünk apró-cseprõ és jelentõsebb eseményei- rõl. Segítséget nyújtani a hétköznapokhoz, szakemberek közremûködésével, praktikus tanácsokkal ellátni a gazdálkodókat, ötleteket adni a háziasszonyoknak. És persze szó- rakoztatni. A kalendárium lapjain felvonultatni a magyar irodalom legjelesebbjeit, mai és egykoron volt szerzõket. A Kincses Kalendáriumban idén is sokat mesélünk. -

TLG to Big Reading
The Little Guide to Big Reading Talking BBC Big Read books with family, friends and colleagues Contents Introduction page 3 Setting up your own BBC Big Read book group page 4 Book groups at work page 7 Some ideas on what to talk about in your group page 9 The Top 21 page 10 The Top 100 page 20 Other ways to share BBC Big Read books page 26 What next? page 27 The Little Guide to Big Reading was created in collaboration with Booktrust 2 Introduction “I’ve voted for my best-loved book – what do I do now?” The BBC Big Read started with an open invitation for everyone to nominate a favourite book resulting in a list of the nation’s Top 100 books.It will finish by focusing on just 21 novels which matter to millions and give you the chance to vote for your favourite and decide the title of the nation’s best-loved book. This guide provides some ideas on ways to approach The Big Read and advice on: • setting up a Big Read book group • what to talk about and how to structure your meetings • finding other ways to share Big Read books Whether you’re reading by yourself or planning to start a reading group, you can plan your reading around The BBC Big Read and join the nation’s biggest ever book club! 3 Setting up your own BBC Big Read book group “Ours is a social group, really. I sometimes think the book’s just an extra excuse for us to get together once a month.” “I’ve learnt such a lot about literature from the people there.And I’ve read books I’d never have chosen for myself – a real consciousness raiser.” “I’m reading all the time now – and I’m not a reader.” Book groups can be very enjoyable and stimulating.There are tens of thousands of them in existence in the UK and each one is different. -

Widening Horizons 2018.Pages
Widening Horizons 2018 ‘True education goes on throughout your life in many 2008-2009 SEASON different ways and places’ Beyond the Examination “Never just learn to pass exams. Learn for the sake of acquiring knowledge.” Much of what you do in class over the next few years will inevitably be focused on external examinations. But we all know there is much, much more to your education than just doing as well as you can in exams. True education goes on throughout your life in many different ways and places. Your teachers will often be able to take you way outside the exam syllabus but we want you to be able to find areas of academic interest that mean a lot to you personally and are not always restricted to the subjects you have chosen to study. This booklet is to help you think about areas that may spark off individual interests for you. They may cross subject boundaries and may help you develop areas of specialisms that you will be able to follow throughout your life, either as a professional interest or as an absorbing hobby. Take some time to read through subjects you may think you are not very interested in as well as those you are. Just because you have not chosen to follow a subject to GCSE or A Level does not mean that there will not be aspects of the subject that could absolutely fascinate you. We want you to find endless stimulation and challenge in intellectual areas. That has nothing to do with examination but everything to do with a full life. -

Könyvtári Figyelő 57. Évf. 2. Sz. 2011
21. (57.) ÉVFOLYAM, 2011. 2. SZÁM FŐSZERKESZTŐ: dr. Dippold Péter FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: Kovács Katalin SZERKESZTŐK: Kovács Katalin (Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle), Feimer Ágnes (Külföldi folyóirat-figyelő) Szerkesztőbizottság: dr. Bényei Miklós, dr. Hangodi Ágnes, Haraszti Pálné, Hegykö- zi Ilona, dr. Jacsó Péter, Káldos János, dr. Mader Béla, dr. Murányi Lajos, dr. Murányi 2011/2 Péter, Pallósiné dr. Toldi Márta, Rácz Ágnes. Borítóterv: Gerő Éva, grafikus Műszaki szerkesztő: Nagy László Szerkesztőség: Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Buda- vári Palota F épület, Telefon: 224-3795, 224-3796, Fax: 224-3875, 3759–984, E-mail: [email protected], [email protected] Megjelenik: negyedévenként. Egy szám ára: 1500.-Ft +5% áfa + postaköltség. Éves előfizetés:6000.-Ft + 5% áfa + postaköltség. Külföldi előfizetési ára: 100 euró. Terjeszti: Könyvtári Intézet, Könyvtártudományi Szakkönyvtár. Előfizethető: a szerkesztőség címén. Kiadja: az Országos Széchényi Könyvtár. Felelős kiadó: dr. Sajó Andrea Nyomda: Nalors Grafika Kft., Vác Felelős vezető: Szabó Gábor HU ISSN 0023-3773 Index 26408 (Nyomtatott) HU ISSN 1586-5193 (Online) KÖNYVTÁRI FIGYELõ KÖNYVTÁRI Lapunkat az alábbi referáló lapok és adatbázisok dokumentálják: HLISA (Hungarian Library and Information Science Abstracts) Library Literature and Information Science Abstracts (The Wilson Co.) LISA (Library and Information Science Abstracts) LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts, EBSCO) HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa) A folyóirat megjelenését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. www.nefmi.gov.hu www.nka.hu A KÖNYVTÁRI FIGYELõ online változata a http://ki.oszk.hu/kf címen érhető el. A folyóiratban olvasható írások a szerzők véleményét tükrözik, nem mindig azonosak a szerkesztőség álláspontjával. A szerkesztőség nem őrzi meg és nem küldi vissza a kéziratokat. -

Beach Books: 2014-2016
BEACH BOOKS: 2014-2016 What Do Colleges and Universities Want Students to Read Outside Class? February 2016 A report by the National Association of Scholars BEACH BOOKS: 2014-2016 What Do Colleges and Universities Want Students to Read Outside Class? February 2016 DAVID RANDALL © 2016 National Association of Scholars ABOUT THE NATIONAL ASSOCIATION OF SCHOLARS Mission The National Association of Scholars is an independent membership association of academics and others working to sustain the tradition of reasoned scholarship and civil debate in America’s colleges and universities. We uphold the standards of a liberal arts education that fosters intellectual freedom, searches for the truth, and promotes virtuous citizenship. What We Do We publish a quarterly journal, Academic Questions, which examines the intellectual controversies and the institutional challenges of contemporary higher education. We publish studies of current higher education policy and practice with the aim of drawing attention to weaknesses and stimulating improvements. Our website presents a daily stream of educated opinion and commentary on higher education and archives our research reports for public access. NAS engages in public advocacy to pass legislation to advance the cause of higher education reform. We file friend-of-the-court briefs in legal cases, defending freedom of speech and conscience, and the civil rights of educators and students. We give testimony before congressional and legislative committees and engage public support for worthy reforms. NAS holds national and regional meetings that focus on important issues and public policy debates in higher education today. Membership NAS membership is open to all who share a commitment to its core principles of fostering intellectual freedom and academic excellence in American higher education. -

190 Copyright © 2018 by Academic Publishing House Researcher S.R.O. All Rights Reserved. Published in the Slovak Republic Europ
European Journal of Contemporary Education, 2018, 7(1) Copyright © 2018 by Academic Publishing House Researcher s.r.o. All rights reserved. Published in the Slovak Republic European Journal of Contemporary Education E-ISSN 2305-6746 2018, 7(1): 190-213 DOI: 10.13187/ejced.2018.1.190 www.ejournal1.com WARNING! Article copyright. Copying, reproduction, distribution, republication (in whole or in part), or otherwise commercial use of the violation of the author(s) rights will be pursued on the basis of international legislation. Using the hyperlinks to the article is not considered a violation of copyright. Lies of the Reader: Disadvantages of the Sociological Research Methods for the Study of the Reading Milena I. Tsvetkova a , * a Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria Abstract The research problems of this study are the difficulties in the explanation of the phenomenon of reading in its accelerated transformations by quantitative sociological methods, because of failure to comply with a number of factors: first, the social aspects of the purchase, consumption and possession of reading materials have not yet been reading; second, reading is both asocial and social activity; third, the reader is not social status, social class, social group or social role. Author's hypothesis: the most accessible and authoritative audience methods for study of the reading – sociological research methods, are unable to disclose the specifics of the reader and reading, they provide limited data only on the outer side of the reading activity, for its quantitative indicators but do not reach to the knowledge about the nature and the reasons both for the reading and not reading. -
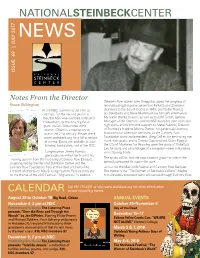
July 2017 Issue 69 | July
NATIONALSTEINBECKCENTER NEWS ISSUE 69 | JULY 2017 ISSUE 69 | JULY Notes From the Director Western Flyer owner John Gregg discussed the progress of Susan Shillinglaw reconstructing the purse seiner that Ricketts and Steinbeck At the NSC, summer is the time to chartered to the Sea of Cortez in 1940, and Taelen Thomas catch up. For the second year in a (as Steinbeck) and Steve Mortensen (as himself) entertained. row, the NSC was awarded a National My warm thanks to each, as well as to John Turner, General Endowment for the Arts Big Read Manager of The Clement, and the NSC board for their collective grant. As Eric Mora notes in his high spirits and full-throttle support; to Steve Palumbi, Director column, Citizen is a meditation on of Stanford’s Hopkins Marine Station, for generously opening race in the 21st century. Please check Boatworks for afternoon seminars; to the Cannery Row www.steinbeck.org for a full schedule Foundation board and president, Greg Cailliet, for embracing the of events. Books are available at local event with gusto; and to Dennis Copeland and Claire Rygg of libraries, bookstores, and at the NSC. the City of Monterey for throwing open the doors of Ricketts’s Lab for tours and a humdinger of a reception—beer milkshakes Congressman Jimmy Panetta were flowing freely. graciously permitted me to print his moving speech from the first annual Cannery Row Banquet, The spirits of Doc and the boys raised a glass—or one of the co-sponsored by the National Steinbeck Center and the specially designed tin cups—I’m sure. -
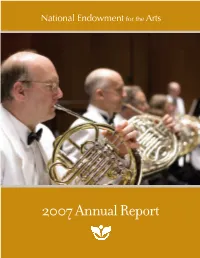
NEA 2007 Annual Report.4Web.Indd
National Endowment for the Arts 2007 Annual Report GRANT HIGHLIGHTS The National Endowment for the Arts is a public agency dedicated to supporting excellence in the arts, both new and established; bringing the arts to all Americans; and providing leadership in arts education. Established by Congress in 1965 as an independent agency of the federal government, the Arts Endowment is the nation’s largest annual funder of the arts, bringing great art to all 50 states, including rural areas, inner cities, and military bases. II National Endowment for the Arts Dear Mr. President: It is my pleasure to submit the Annual Report of the National Endowment for the Arts for Fiscal Year 2007. Since its establishment in 1965, the Arts Endowment has awarded more than $4 billion in grants to organizations and artists residing in communities large and small in all 50 states and the six U.S. jurisdictions. Throughout its history, the NEA has played a transformative and sustaining role in the development of regional theater, opera, dance, orchestras, museums, and other arts—both contemporary and traditional—that Americans now enjoy. The activities highlighted in this report illustrate the Arts Endowment’s continuing commitment to a nation in which artistic excellence is celebrated, supported, and available to all Americans. Sincerely, Dana Gioia Chairman 2007 Annual Report i Sir Edward Burne-Jones’s The Council Chamber, 1872-92, part of the Delaware Art Museum’s pre-Raphaelite collection that was displayed in 2007 with assistance from an NEA grant. Photo courtesy of Delaware Art Museum contents to come Contents Chairman’s Statement ............................................................1 National Initiatives .................................................................7 State and Regional Partnerships ........................................... -

Elektronikus Könyv És Nevelés VII. Évf., 2005. 4
MOHOS SÁNDOR A Nagy Könyv egymilliárdért Egy irodalomtanár tûnõdései Igazi magyar licensként hozzánk is megérkezett 2005 márciusában A Nagy Könyv játék a 2003-as angol The Big Read és a német Das Lieblingsbuch der Deutschen nyo- mán. A szigetországban állítólag óriási sikert aratott a ráépülõ BBC-mûsor, valamint a nyomában járó olvasómozgalom. Nálunk is az alapítók: a Nemzeti Kulturális Alap- program, az MTV Rt., a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma; a támogatók: a Szerencsejáték Rt., a Magyar Telecom; a partnerek: a Népszabadság, a Magyar Rádió; a médiatámogatók: a HVG, a Népszava, a Reggel, a Sláger Rádió stb. megjelölték a já- ték célját, az olvasás népszerûsítését. Nem ismerjük a nyugati példákon túl a fönt említett cél mélyebb motivációit. De elgondolkodtató, hogy az alapítók és a támogatók között nem találjuk az Oktatási Mi- nisztériumot, és elsõsorban az auditív és az audiovizuális médiumoknak oly fontos az olvasásra nevelés. Ezért új mûsorszámokat iktattak be, amelyekben nem irodalomta- nárok, -tudósok, hanem kiadói vezetõk és showmanek próbálják értelmezni az általuk fontosnak tartott Nagy Könyvet – lehetõleg a késõ esti (11 óra) programban. Az isko- lákban pedig mély csönd honol/honolt. Legfeljebb a könyvtári polcokon néhány pél- dányban lévõ kötelezõ olvasmányért igyekvõ tanulók találkozhattak a pulpituson he- verõ sárga szórólappal, amelyen a magyar száz Nagy Könyv listája található. A tanárok tájékozottsága és aktivitása hasonló „mélységû” volt. Vajon miért? Élek a gyanúperrel: ez nem igazán kultúrprogram, hanem kereskedelmi vállalko- zás, amely a médiumoknak és nem igazán az irodalomnak hasznos. De nézzük a játék menetét és tartalmát! Ha idõrend szerint vizsgálódunk, akkor a százas magyar lista – hasonlóképpen az angolhoz és a némethez – tükrözi a regény térhódításának az idõszakát: nagyjából húsz százalékban jelölték az olvasók a 19. -
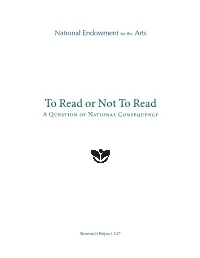
To Read Or Not to Read a Question of National Consequence
National Endowment for the Arts To Read or Not To Read A Question of National Consequence Research Report #47 Research Report #47 November 2007 National Endowment for the Arts 1100 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20506-0001 Telephone: 202-682-5400 Produced by the Office of Research & Analysis Sunil Iyengar, Director Staff contributors: Sarah Sullivan, Bonnie Nichols, Tom Bradshaw, and Kelli Rogowski Special contributor: Mark Bauerlein Editorial and publication assistance by Don Ball Designed by Beth Schlenoff Design Front Cover Photo: Getty Images Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data To read or not to read : a question of national consequence. p. cm. — (Research report ; #47) “Produced by the Office of Research & Analysis, National Endowment for the Arts, Sunil Iyengar, director; editorial and publication assistance by Don Ball.” 1. Books and reading —United States. 2. Literature —Appreciation —United States. I. Iyengar, Sunil, 1973 – II. Ball, Don, 1964 – III. National Endowment for the Arts. Z1003.2.T6 2007 028’.9 —dc22 2007042469 202-682-5496 Voice/TTY (a device for individuals who are deaf or hearing-impaired) Individuals who do not use conventional print materials may contact the Arts Endowment’s Office for AccessAbility at 202-682-5532 to obtain this publication in an alternate format. Lis publication is available free of charge at www.arts.gov , the Web site of the National Endowment for the Arts. C 5 Chairman’s Preface 7 Executive Summary 23 Introduction SECTION ONE Youth Voluntary Reading Patterns 27 Chapter One 33 Chapter Two 37 Chapter sree 46 Chapter Four SECTION TWO What the Declines Mean for Literacy 55 Chapter Five 63 Chapter Six 68 Chapter Seven SECTION THREE Why More than Reading is at Risk 77 Chapter Eight 86 Chapter Nine 94 Conclusion 96 List of Charts and Tables P o Read or Not To Read gathers and collates the best national data available to provide a reliable and comprehensive overview of American reading today. -

Democratic Theories and Political Discussion
Virtual Deliberation An Ethnography of Online Political Discussion in Hungary By Ildikó Kaposi A Doctoral Dissertation Submitted to the Central European University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Political Science 8 September, 2006 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION...........................................................................................................................2 CHAPTER I: POLITICAL DISCUSSION IN THEORY, PRACTICE, AND HISTORY Democratic Theories and Political Discussion: The economic approach to political discussion – Participatory theories and political discussion – Discussion and decision making: the deliberative position.......................................................................................................................................6 Arenas of deliberation: Deliberative experiments across the world – Deliberation unbound – Media, participation, and deliberation – Everyday talk as participation – Models of talk – Everyday talk in the deliberative system – Empirical findings on everyday talk – Fluidity and boundaries.................................................................................................................................13 Everyday political talk in history: Habermas and his critics – Arenas and standards of 18th-century political discussion – Discussion in fact and theory....................................................................................................31 CHAPTER II: ICTS AND DEMOCRACY Visions