Herbert Haupt, Der Heldenplatz (2000)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Notes of Michael J. Zeps, SJ
Marquette University e-Publications@Marquette History Faculty Research and Publications History Department 1-1-2011 Documents of Baudirektion Wien 1919-1941: Notes of Michael J. Zeps, S.J. Michael J. Zeps S.J. Marquette University, [email protected] Preface While doing research in Vienna for my dissertation on relations between Church and State in Austria between the wars I became intrigued by the outward appearance of the public housing projects put up by Red Vienna at the same time. They seemed to have a martial cast to them not at all restricted to the famous Karl-Marx-Hof so, against advice that I would find nothing, I decided to see what could be found in the archives of the Stadtbauamt to tie the architecture of the program to the civil war of 1934 when the structures became the principal focus of conflict. I found no direct tie anywhere in the documents but uncovered some circumstantial evidence that might be explored in the future. One reason for publishing these notes is to save researchers from the same dead end I ran into. This is not to say no evidence was ever present because there are many missing documents in the sequence which might turn up in the future—there is more than one complaint to be found about staff members taking documents and not returning them—and the socialists who controlled the records had an interest in denying any connection both before and after the civil war. Certain kinds of records are simply not there including assessments of personnel which are in the files of the Magistratsdirektion not accessible to the public and minutes of most meetings within the various Magistrats Abteilungen connected with the program. -

Price List Hofburg New Year's Eve Ball on 31 December 2019
PRICE LIST HOFBURG NEW YEAR’S EVE BALL ON 31 DECEMBER 2019 GRAND TICKET WITH GALA DINNER Admission entrance Heldenplatz at 6.30 pm The ticket price includes the entrance and a seat reservation at a table as well as a glass of sparkling wine for the welcome (at the Hofburg Foyer until 7.00 pm), a four-course dinner with white / red wine, mineral water and a glass of champagne at midnight at your table. Musical entertainment by live-orchestras and dance floor. Festsaal EUR 780.- per person Zeremoniensaal Center EUR 730.- per person Zeremoniensaal Wing EUR 700.- per person Geheime Ratstube EUR 520.- per person STAR TICKET WITH SEAT RESERVATION Admission entrance Heldenplatz at 9.15 pm The ticket price includes the entrance ticket and the seat reservation at a table, a glass of sparkling wine for the welcome (at the Hofburg Foyer until 10.00 pm). Festsaal Seat reservation in a centrally located state hall musical entertainment by live-orchestras, dance floor EUR 440.- per person Wintergarten or Marmorsaal Seat reservation in a centrally located state hall or in a room with a view over the Heldenplatz EUR 350.- per person Seitengalerie or Vorsaal seat reservation in a centrally located state hall EUR 300.- per person Künstlerzimmer or Radetzky Appartment seat reservation in a smaller, historical state hall EUR 250.- per person CIRCLE TICKET Admission entrance Heldenplatz at 9.15 pm The ticket price comprises access to all ballrooms and a glass of sparkling wine for the welcome (at the Hofburg Foyer until 10.00 pm). A seat reservation is not included. -
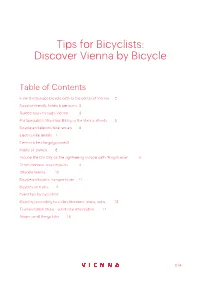
Tips for Bicyclists: Discover Vienna by Bicycle
Tips for Bicyclists: Discover Vienna by Bicycle Table of Contents From the Danube bicycle path to the center of Vienna 2 Bicyclist-friendly hotels & pensions 3 Guided tours through Vienna 3 For Specialists: Mountain Biking in the Vienna Woods 5 Bicycle and electric bike rentals 6 Electric bike rentals 7 Electric bike charging points 8 Public air pumps 8 Around the Old City on the sightseeing bicycle path “Ringstrasse” 9 Other thematic bicycle paths 9 Citybike Vienna 10 Bicycle and public transportation 11 Bicycles on trains 11 Event tips for cyclists 12 Bicycling according to a plan, literature, maps, apps 13 Transportation Clubs - additional information 14 Shops for all things bike 14 1/14 Publisher: Vienna Tourist Board, 1030 Vienna, Invalidenstraße 6, tel. +43-1-24 555, [email protected], www.wien.info. Last revision: March 2018, subject to change without notice. Note: Ride along these routes at your own risk Tips for Bicyclists: Discover Vienna by Bicycle You can travel fast with a bicycle, but still slowly enough to enjoy Vienna's sights on the way. Vienna offers more than 1,300 kilometers of bicycle paths, some of them in areas with hardly any traffic. Explore Vienna by bicycle: whether you bring your own or rent one, the city has a lot to offer to bicyclists. We have collected a few tips for your bicycling tour through the metropolis on the Danube, such as where you can rent a bicycle or get one repaired, at what times you are allowed to take it on Vienna's public transportation system, and when guided city tours are offered for bicyclists. -
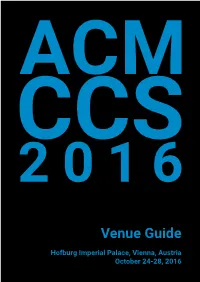
CCS 2016 Venue Guide
ACM CCS 2016 - Venue Guide Contents Venue Overview ............................................................................................................................................ 2 Directions (to CCS 2016 Conference Venue) ................................................................................................ 3 Conference Venue................................................................................................................................................ 3 How to get to the Conference Venue ................................................................................................................... 4 Directions (airport – city center) ................................................................................................................. 8 Vienna Sightseeing Map .................................................................................................................................... 13 Welcome to Vienna! .......................................................................................................................................... 14 About Vienna ..................................................................................................................................................... 16 The Culinary Side of Vienna .............................................................................................................................. 18 Tips from a Local .............................................................................................................................................. -

Visitor Attractions
Visitor Attractions As a former imperial city, Vienna has a vast cultural imperial apartments and over two dozen collections heritage spanning medieval times to the present day. – the legacy of the collecting passion of the Habsburg Top attractions include the Gothic St. Stephen’s Cathe- dynasty. Viennese art nouveau (Jugendstil) has also dral, baroque imperial palaces and mansions and brought forth unique places of interest such as the Se- the magnificent Ring Boulevard with the State Opera, cession with its gilded leaf cupola. Contemporary archi- Burgtheater (National Theater), Votive Church, City Hall, tecture is to be found in the shape of the Haas-Haus, Parliament and the Museums of Fine Arts and Natural whose glass front reflects St. Stephen’s Cathedral, and History. The former imperial residences Hofburg and the Gasometers, former gas storage facilities which Schönbrunn also offer the opportunity to follow in have been converted into a residential and commercial imperial footsteps. Schönbrunn zoo and park shine complex. This mix of old and new, tradition and moder- in baroque splendor, while Hofburg Palace boasts nity, is what gives Vienna its extra special flair. © WienTourismus/Karl Thomas Thomas WienTourismus/Karl © Osmark WienTourismus/Robert © Osmark WienTourismus/Robert © Anker Clock TIP This gilded masterpiece of art nouveau was created in 1911 by the Danube Tower painter and sculptor Franz von Matsch. Every day at noon, twelve An unforgettable panorama of Vienna’s Danube scenery, the old historical Viennese figures parade across the clock to musical ac- city and the Vienna Woods is afforded at 170m in the Danube Tow- companiment. Christmas carols can be heard at 17:00 and 18:00 er. -

Broschüre Denk Mal Wien
Thematische Rundgänge in der Wiener Innenstadt Inhaltsverzeichnis Seiten Was ist „denk mal wien“? 2—3 Rundgänge „denk mal wien“ 4—5 Äußeres Burgtor und Krypta 6 Bundeskanzleramt 7 Demel 8 Demonstrationsverbot für den 1. Mai 1933 9 Denkmal der Exekutive 10 Denkmal der Republik 11 Deserteursdenkmal 12 Feuerwehr am Hof 13 Heldenplatz 14 Justizpalast 15 Landesgericht 16 Mahnmal am Morzinplatz 17 Mahnmal gegen Krieg und Faschismus 18 Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Schoah 19 Kartenübersicht über die 4 Rundgänge 20—21 Meissl & Schadn 22 Michaelerplatz und Michaelerkirche 23 Minoritenplatz 24 Parlament 25 Pestsäule 26 Polizeigefangenenhaus „Liesl“ 27 Reiterdenkmäler auf dem Heldenplatz 28 Stadttempel — Israelitische Kultusgemeinde Wien 29 Stephansdom 30 Votivkirche und Vorplatz 31 Wehrmann in Eisen 32 Wiener Hauptgesundheitsamt 33 Wiener Staatsoper 34 Dank 35 Quellen 36 Was ist „denk mal wien“? Auf Einladung der Österreichischen Bundesregierung und der Stadt Wien konzipierte das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) das Vermittlungsprojekt „denk mal wien“. Denkmäler und Gedenkstätten spiegeln den Umgang mit der Geschichte Österreichs der letzten hundert Jahre und länger wider: Die Zeit vor 1914 und der Erste Weltkrieg (1914—1918), das damit einhergehende Ende der Monarchie, die Zeit der Ersten Republik und des Austrofaschismus (1918—1938), der Fall der Ersten Republik, der Anschluss an Nazi- Deutschland, die Zeit des Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg (1939–1945) bis hin zur Befreiung durch die alliierten Mächte und der bis heute bestehenden Zweiten Republik. Anhand vier thematischer Fragestellungen entwickelte das Mauthausen Komitee Rundgänge, die die österreichische Zeitgeschichte und Gegenwart mit inhaltlichen Anknüpfungspunkten zu den Orten und Denkmälern/Gedenkstätten in und um die Innere Stadt in Wien vermitteln. -

O Du Mein Österreich: Patriotic Music and Multinational Identity in The
O du mein Österreich: Patriotic Music and Multinational Identity in the Austro-Hungarian Empire by Jason Stephen Heilman Department of Music Duke University Date: _______________________ Approved: ______________________________ Bryan R. Gilliam, Supervisor ______________________________ Scott Lindroth ______________________________ James Rolleston ______________________________ Malachi Hacohen Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music in the Graduate School of Duke University 2009 ABSTRACT O du mein Österreich: Patriotic Music and Multinational Identity in the Austro-Hungarian Empire by Jason Stephen Heilman Department of Music Duke University Date: _______________________ Approved: ______________________________ Bryan R. Gilliam, Supervisor ______________________________ Scott Lindroth ______________________________ James Rolleston ______________________________ Malachi Hacohen An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music in the Graduate School of Duke University 2009 Copyright by Jason Stephen Heilman 2009 Abstract As a multinational state with a population that spoke eleven different languages, the Austro-Hungarian Empire was considered an anachronism during the age of heightened nationalism leading up to the First World War. This situation has made the search for a single Austro-Hungarian identity so difficult that many historians have declared it impossible. Yet the Dual Monarchy possessed one potentially unifying cultural aspect that has long been critically neglected: the extensive repertoire of marches and patriotic music performed by the military bands of the Imperial and Royal Austro- Hungarian Army. This Militärmusik actively blended idioms representing the various nationalist musics from around the empire in an attempt to reflect and even celebrate its multinational makeup. -
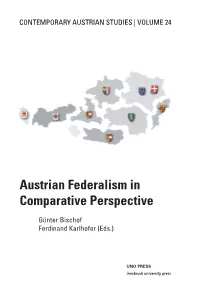
Austrian Federalism in Comparative Perspective
CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 Bischof, Karlhofer (Eds.), Williamson (Guest Ed.) • 1914: Aus tria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I War of World the Origins, and First Year tria-Hungary, Austrian Federalism in Comparative Perspective Günter Bischof AustrianFerdinand Federalism Karlhofer (Eds.) in Comparative Perspective Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS innsbruck university press Austrian Federalism in ŽŵƉĂƌĂƟǀĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2015 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70148, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Book design by Allison Reu and Alex Dimeff Cover photo © Parlamentsdirektion Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press by Innsbruck University Press ISBN: 9781608011124 ISBN: 9783902936691 UNO PRESS Publication of this volume has been made possible through generous grants from the the Federal Ministry for Europe, Integration, and Foreign Affairs in Vienna through the Austrian Cultural Forum in New York, as well as the Federal Ministry of Economics, Science, and Research through the Austrian Academic Exchange Service (ÖAAD). The Austrian Marshall Plan Anniversary Foundation in Vienna has been very generous in supporting Center Austria: The Austrian Marshall Plan Center for European Studies at the University of New Orleans and its publications series. -

Highlights of the Wiener Ringstrasse–Questions
THE VIENNA PROJECT: HIGHLIGHTS OF THE WIENER RINGSTRAβE Site 1: Resselpark 1040 Wien Resselpark represents the memory of the many homosexual men were arrested here. Public baths, parks and public toilets were the main meeting places for these men, who lived under conditions where their sexual relations were illegal and required secrecy. Many victims were arrested in police raids on such locations. Questions to Consider How were homosexual men and women treated before the Nazis came to power in Austria? What were the laws about homosexuality? How were homosexual men and women treated under National Socialism in Austria? What were the punishments for being gay or lesbian? Were they different for men and women? What happened to homosexual men and women in Austria after WWII ended? Have they received restitution (die Entschädigung) and been acknowledged by the Austrian government as victims? If so, how and when? Are there any memorials to homosexual victims of National Socialism in Austria? 2014 © Kate Melchior THE VIENNA PROJECT: HIGHLIGHTS OF THE WIENER RINGSTRAβE Site 2: Wiener Staatsoper/The Vienna State Opera House Opernring 2, 1010 Wien The Vienna State Opera House represents the memory of musicians from the State Opera Company and the Vienna Philharmonic Orchestra, whose members were chosen from among musicians in the State Opera. It was the one of the first places where Jewish artists were fired from their jobs, later to be persecuted and some murdered. Beginning in 1938, Jews, Roma and Sinti, and other groups were banned from attending operas in the theater as part of new laws restricting their access to Viennese society. -
Programmfolder Hofburg Innsbruck
The Imperial Palace Vienna at a Glance Imperial Palace Vienna Since its creation in the 13th century, the Imperial Palace Vienna has been subject to constant modification. As a consequence, it has be- come a reflection of the many cultural, political, social, and economic developments throughout Austria’s history. Today, the Swiss Yard (Schweizerhof) represents the oldest part of the building complex. It dates back to the time of Emperor Frederick II of the House of Hohenstaufen. Over the centuries, the rectangular palace of the Late Medieval Period was reconstructed, adapted, expanded, and connected to its adjacent buildings until it eventually became the building complex that, today, constitutes the Imperial Palace Vienna. Dreaming of an Imperial Forum, Emperor Franz Joseph I initiated the last large extension in the second half of the 19th century. Ho- wever, his dream never fully came true. Only Maria-Theresien-Squa- re (Maria- Theresien-Platz) with its two world-famous museums, the youngest wing of the Imperial Palace Vienna – New Castle (Neue Burg) – and St. Michael‘s Gate (Michaelertor) with its sumptuous cupola were to be completed. In its present form the Imperial Palace Vienna, which is situated in the heart of the city, covers an area of more than 300,000 m2 and fulfils a wide array of roles. Hofburg Info Center The recently created Hofburg Info Center nestles between the youngest wing of the Imperial Palace Vienna – New Castle (Neue Burg) – Weltmuseum Wien and the Austrian National Library. Its aim is to provide visitors with all the information they need about the institutions located in the area as well as its history. -

The Political Bernhard Revisited Dr. Jeanette R. Malkin
Nazis in the Bernhard Soup: The Political succumbing to a serious heart condition that Bernhard Revisited could not withstand the scandal he himself had initiated). In fact, one of the most notorious Dr. Jeanette R. Malkin Bernhard scandals occurred after his death, Theatre Studies Department though in conjunction with the Heldenplatz uproar. Hebrew University Jerusalem As many of you probably know, Bernhard demanded in his last will and testament (written, Revisiting the political Bernhard is an easy thing or re-written, two days before his death!) that to do – at least on the evidence of the two plays nothing he had ever written, neither book nor recently translated into Hebrew and published by poem nor essay nor play, was to be published or Schocken (1999). Vor dem Ruhestand (Eve of performed “within the borders of the Austrian Retirement) and Heldenplatz are enormously state, however that state describes itself... for all political plays not only because they deal with time to come”.[ii] He also forbade his own political subjects such as Nazis and their commemoration by Austria in any form continuation into the present of Germany and whatsoever, or by any country supported by Austria, but because both plays were an Austrian money or institutions. In Bernhard’s intervention into real political events occurring at own words, he was thereby performing his own the time the plays were written, and both resulted “posthumous literary exile” from a country with in real political consequences: Eve of Retirement in whom he had been in ideological and political Germany; Heldenplatz in Austria. conflict for most of his life. -

The Historic Centre of Vienna
Legal notice Contents Media owner and publisher The Historic Centre of Vienna Vienna City Administration 01 UNESCO World Heritage Municipal Department 19 – Protection and responsibility Architecture and Urban Design World Cultural Heritage at the national and international levels Idea and concept development Rudolf Zunke and Vibrant Hub 02 Statements (Chief Executive Office of the City of Vienna, by political representatives Executive Group for Construction and Technology, Planning Group) 04 Nomination criteria Michael Diem, Peter Scheuchel Criteria for the inscription (Municipal Department 19 – of Vienna on the Architecture and Urban Design) World Heritage List of UNESCO Manfred Wehdorn, Jessica Wehdorn (Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH) 14 Concrete examples Project management World Heritage and Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH contemporary architecture Editing and texts 37 Protection of the World Heritage Jessica Wehdorn, Manfred Wehdorn, Strategies, instruments Rudolf Zunke and monitoring Scientific research and map graphics Ludwig Varga, Jessica Wehdorn 49 Actors (Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH) between World Heritage Rudolf Zunke interests and urban planning tasks 3D visualisations, visibility analyses, photomontages 52 Challenges and vision Peter Ilias, Hubert Lehner, Gerhard Sonnberg er (Municipal Department 41 – Surveyors) Technical co-ordination Willibald Böck (Municipal Department 18 – Urban Development and Planning) Margit Gerstl (Chief Executive Office of the City of Vienna, Executive Group for Construction