Gebietsfremde Arten in Der Schweiz BAFU 2006 6
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

An Annotated Checklist of Wisconsin Handsome Fungus Beetles (Coleoptera: Endomychidae)
The Great Lakes Entomologist Volume 40 Numbers 3 & 4 - Fall/Winter 2007 Numbers 3 & Article 9 4 - Fall/Winter 2007 October 2007 An Annotated Checklist of Wisconsin Handsome Fungus Beetles (Coleoptera: Endomychidae) Michele B. Price University of Wisconsin Daniel K. Young University of Wisconsin Follow this and additional works at: https://scholar.valpo.edu/tgle Part of the Entomology Commons Recommended Citation Price, Michele B. and Young, Daniel K. 2007. "An Annotated Checklist of Wisconsin Handsome Fungus Beetles (Coleoptera: Endomychidae)," The Great Lakes Entomologist, vol 40 (2) Available at: https://scholar.valpo.edu/tgle/vol40/iss2/9 This Peer-Review Article is brought to you for free and open access by the Department of Biology at ValpoScholar. It has been accepted for inclusion in The Great Lakes Entomologist by an authorized administrator of ValpoScholar. For more information, please contact a ValpoScholar staff member at [email protected]. Price and Young: An Annotated Checklist of Wisconsin Handsome Fungus Beetles (Cole 2007 THE GREAT LAKES ENTOMOLOGIST 177 AN Annotated Checklist of Wisconsin Handsome Fungus Beetles (Coleoptera: Endomychidae) Michele B. Price1 and Daniel K. Young1 ABSTRACT The first comprehensive survey of Wisconsin Endomychidae was initiated in 1998. Throughout Wisconsin sampling sites were selected based on habitat type and sampling history. Wisconsin endomychids were hand collected from fungi and under tree bark; successful trapping methods included cantharidin- baited pitfall traps, flight intercept traps, and Lindgren funnel traps. Examina- tion of literature records, museum and private collections, and field research yielded 10 species, three of which are new state records. Two dubious records, Epipocus unicolor Horn and Stenotarsus hispidus (Herbst), could not be con- firmed. -

Insectes Invasifs Et Envahissants En Alsace. Bull
Callot H., Brua C. (2013) - Insectes invasifs et envahissants en Alsace. Bull. Ass. Philomatique d'Alsace et de Lorraine, 44 (2010-2011), 21-44 et 132-140 Insectes invasifs et envahissants en Alsace. Henry Callota et Christophe Bruab Société Alsacienne d'Entomologie a) 3 rue Wimpheling, 67000 Strasbourg b) 7 rue d'Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Résumé Cet article présente une sélection d'espèces d'insectes invasives et envahissantes observées en Alsace. Pour chaque espèce sont indiquées des données concernant sa date d'apparition, son statut actuel et son éventuel impact économique. Summary In this article a selection of invasive and invading insect species observed in Alsace is presented. For each species data are given concerning the date of arrival, the present status in the region and the possible economic impact. Mots-clés Espèces invasives, insectes, Alsace, France. Introduction Parler d'espèces invasives, envahissantes, exotiques ou autres adjectifs, présentes dans une région donnée, pose immédiatement un problème de définition. Le cas d'une espèce extrême-orientale apparue en nombre dans notre paysage entomologique comme celui de la "coccinelle asiatique", Harmonia axyridis, est clair. Celui d'une espèce plus discrète qui a étendu de proche en proche son aire de répartition en raison du réchauffement du climat ou de toute autre cause, pas toujours facile à définir, est bien différent, même si son impact économique peut être réel. La consultation de listes commentées nationales illustre d'ailleurs très bien ces difficultés à trouver de bonnes définitions et les incohérences qui en découlent. Avant de discuter des espèces envahissantes ou invasives, il faut d'abord évoquer la notion d'espèces introduites. -

Univerza V Ljubljani Biotehniška Fakulteta Biologija
UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA BIOLOGIJA Matej IVENČNIK ČLENONOŽCI ČEBELJEGA PANJA PRI KRANJSKI SIVKI (Apis mellifera carnica Poll.) DIPLOMSKO DELO Univerzitetni študij ARTHROPODS OF THE CARNIOLAN HONEYBEE BEEHIVE (Apis mellifera carnica Poll.) GRADUATION THESIS University studies Ljubljana, 2013 Ivenčnik M. Členonožci čebeljega panja pri kranjski sivki (Apis mellifera carnica Poll.). II Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2013 Diplomsko delo je zaključek univerzitetnega študija biologije. Opravljeno je bilo v skupini za Ekologijo živali, Katedre za ekologijo in varstvo okolja Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Vzorci za preiskave pa so bili vzeti iz panjev, ki so se nahajali v kraju Bovše pri Vojniku. Analizirana sta bila tudi dva vzorca iz območja Ribnice. Komisija za študijske zadeve Oddelka za biologijo BF je dne 16. 5. 2013 sprejela temo diplomskega dela. Za mentorja diplomskega dela je imenovala prof. dr. Ivana Kosa. Komisija za oceno in zagovor: Predsednik: doc. dr. Rudi VEROVNIK Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Recenzent: izr. prof. dr. Janko BOŽIČ Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Mentor: izr. prof. dr. Ivan KOS Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Datum zagovora: Podpisani se strinjam z objavo svoje naloge v polnem tekstu na spletni strani Digitalne knjižnice Biotehniške fakultete. Izjavljam, da je naloga, ki sem jo oddal v elektronski obliki, -
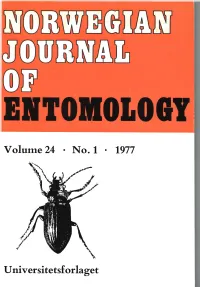
NJE 24 01 1977.Pdf
Norwegian Journal of Entomology Norsk Entomologisk Tidsskrift EDITOR Dr. philos. Lauritz Semme, Zoologisk institutt, Universitetet i Oslo, Blindern, Oslo 3, Norway. EDITORIAL COMMITTEE Fsrstelektor Eivind 0stbye, Konsulent Per F. Waaler, Ferstekonservator dr. philos. Albert Lillehammer. PUBLISHER Universitetsforlaget: P. O. Box 7508, Skillebekk, Oslo 2, Norway. P. O. Box 142, Boston, Massachusetts 02113, U.S.A. CONTRIBUTIONS These should be sent to the Editor. Authors are requested to follow the instructions on page 3 of the cover. Artikler som snskes trykt i tidsskriftet sendes redaktsren. Bidragsytere ml fslge anvisningen pi omslagets tredje side. SUBSCRIPTIONS Non-members of the Norwegian Entomological Society should send their orders to Universitetsforlaget. The subscription price per volume (two issues annually) is for 1977 US. $ 15.00 (N. kr. 75.-). U.S. $ price is subject to change without notice in case of devaluation/revaluation. Notice of change of adress should be accompanied by the old address. Back volumes should also be ordered from Universitetsforlaget. NORSK ENTOMOLOGISK FORENING ser sin hovedoppgave i I fremme det entomologiske studium i Norge, og danne et bindeledd mellom de interesserte. Medlemskontingenten er for tiden kr. 40,- pr. ar. Medlemmer fAr tidsskriftet fritt tilsendt. Henvendelser om medlemskap sendes sekreta:ren: Cand. real. Trond Hofsvang, Zoologisk institutt, NLH, 1432 As-NLH. lC Univenitetsforlaget 1977 E. SEM A/S. HALDEN Cold storage tolerance and supercooling points of mummies of Ephedrus cerasicola Stary and Aphidius colemani Viereck (Hym. Aphidiidae) TROND HOFSVANG & ELINE BENESTAD HAGVAR Hofsvang, T. & Hagvar, E. B. 1977. Cold storage tolerance and supercooling points of mummies of Ephedrus cerasicola Start and Aphidius colemani Viereck (Hym., Aphidiidae). -

Appl. Entomol. Zool. 45(1): 89-100 (2010)
Appl. Entomol. Zool. 45 (1): 89–100 (2010) http://odokon.org/ Mini Review Psocid: A new risk for global food security and safety Muhammad Shoaib AHMEDANI,1,* Naz SHAGUFTA,2 Muhammad ASLAM1 and Sayyed Ali HUSSNAIN3 1 Department of Entomology, University of Arid Agriculture, Rawalpindi, Pakistan 2 Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Punjab, Pakistan 3 School of Life Sciences, University of Sussex, Falmer, Brighton, BN1 9QG UK (Received 13 January 2009; Accepted 2 September 2009) Abstract Post-harvest losses caused by stored product pests are posing serious threats to global food security and safety. Among the storage pests, psocids were ignored in the past due to unavailability of the significant evidence regarding quantitative and qualitative losses caused by them. Their economic importance has been recognized by many re- searchers around the globe since the last few years. The published reports suggest that the pest be recognized as a new risk for global food security and safety. Psocids have been found infesting stored grains in the USA, Australia, UK, Brazil, Indonesia, China, India and Pakistan. About sixteen species of psocids have been identified and listed as pests of stored grains. Psocids generally prefer infested kernels having some fungal growth, but are capable of excavating the soft endosperm of damaged or cracked uninfected grains. Economic losses due to their feeding are directly pro- portional to the intensity of infestation and their population. The pest has also been reported to cause health problems in humans. Keeping the economic importance of psocids in view, their phylogeny, distribution, bio-ecology, manage- ment and pest status have been reviewed in this paper. -

From the Mascarene Islands
58 New species of Cryptophagidae and Erotylidae (Coleoptera) from the Mascarene Islands New species of Cryptophagidae and Erotylidae (Coleoptera) from the Mascarene Islands GEORGY YU. LYUBARSKY Zoological Museum of Moscow State University, Bolshaya Nikitskaya ulica 6, 125009, Moscow, Russia; e-mail: [email protected] LYUBARSKI G.Yu. 2013. NEW SPECIES OF CRYPTOPHAGIDAE AND EROTYLIDAE (COLEOPTERA) FROM THE MASCARENE ISLANDS. – Latvijas Entomologs 52: 58-67. Abstract: А new species Micrambe reunionensis sp. nov. (Cryptophagidae) is described from the island of La Réunion. Cryptophilus integer (HEER, 1841) and Leucohimatium arundinaceum (FORSKAL, 1775) (Erotylidae) proved new for the Mascarene faunal district. Key words: Cryptophagidae, Erotylidae, Cryptophilus, Leucohimatium, Micrambe, La Réunion, Mascarene Archipelago. Mascarene Islands: natural conditions many recent extinctions. Volcanic islands with higher elevations The Mascarenes is an island group are relatively young. The most /ancient lavas in the south-western Indian Ocean, 700 from La Réunion are dated at 2.1 million km east of Madagascar. Commonly, it is years ago. La Réunion has been suitable subdivided into continental and oceanic for life since about 2–3 million years ago islands, and oceanic islands are further (Thébaud et al. 2009). La Réunion possesses divided into volcanic islands and coral one active and three extinct volcanoes. The islands. The archipelago includes three high island is dissected by huge caldera-like volcanic islands (La Réunion, Mauritius and valleys (cirques) created by heavy rainfall Rodrigues). Mauritius was the former home of erosion, with very deep gorges culminating dodo, the universal symbol of human-caused in narrow outlets to the sea. species extinction on the islands. -

COSEWIC Assessment and Status Report on the Tiny Cryptantha Cryptantha Minima in Canada
COSEWIC Assessment and Status Report on the Tiny Cryptantha Cryptantha minima in Canada THREATENED 2012 COSEWIC status reports are working documents used in assigning the status of wildlife species suspected of being at risk. This report may be cited as follows: COSEWIC. 2012. COSEWIC assessment and status report on the Tiny Cryptantha Cryptantha minima in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. x + 37 pp. (www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default_e.cfm). Previous report(s): COSEWIC. 2000. COSEWIC assessment and status report on the tiny cryptanthe Cryptantha minima in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. vi + 18 pp. Smith, B. 1998. COSEWIC status report on the tiny cryptanthe Cryptantha minima in Canada, in COSEWIC assessment and status report on the tiny cryptanthe Cryptantha minima in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. 1-18 pp. Production note: COSEWIC would like to acknowledge Sue Michalsky for writing the status report on the Tiny Cryptantha Cryptantha minima in Canada, prepared under contract with Environment Canada. This report was overseen and edited by Bruce Bennett and Erich Haber, Co-chairs of the COSEWIC Vascular Plants Specialist Subcommittee. For additional copies contact: COSEWIC Secretariat c/o Canadian Wildlife Service Environment Canada Ottawa, ON K1A 0H3 Tel.: 819-953-3215 Fax: 819-994-3684 E-mail: COSEWIC/[email protected] http://www.cosewic.gc.ca Également disponible en français sous le titre Ếvaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la Cryptanthe minuscule (Cryptantha minima) au Canada. Cover illustration/photo: Tiny Cryptantha — Source: Environment Canada 2010. -

E-Acta Natzralia Pannonica
e ● Acta Naturalia Pannonica e–Acta Nat. Pannon. 5: 39–46. (2013) 39 Hungarian Eupitheciini studies (No. 2) Records from Nattán’s collection (Lepidoptera: Geometridae) Imre Fazekas Abstract: Data on 37 species collected in Hungary are given. Additional data on faunistics, taxonomy and zoogeography of cer- tain species are provided by the author, with comments. Figures of the genitalia of some species are included. With 18 figures. Key words: Lepidoptera, Geometridae, Euptheciini, distribution, biology, Hungary. Author’s address: Imre Fazekas, Regiograf Institute, Majális tér 17/A, H-7300 Komló, Hungary. Introduction A detailed account of the Eupitheciini species in 20% KOH solution. Genitalia were cleaned and Hungary has been given in five previous works dehydrated in ethanol and mounted in Euparal (Fazekas 1977ab, 1979ab, 1980, 2012). To date 64 between microscope slides and cover slips. Illus- Hungarian Geometridae, tribus Eupitheciini are trations of adults were produced by a multi-layer known. technique using a Sony DSC HX100V with a 4x Present paper contains faunistical data of the Macro Conversion Lens. The photographs were Eupitheciini specimens in the Nattán collection (in processed by the software Photoshop CS3 version. coll. Janus Pannonius Museum, H-Pécs) that col- The genitalia illustrations were produced in a sim- lected outside of the South Transdanubia. ilar manner with multi-layer technique, using an- Miklós Nattán (1910–1970) was an amateur lep- other digital camera (BMS tCam 3,0 MP) and a idopterist who, over nearly six decades, made one XSP-151-T-LED Microscope with a plan lens 4/0.1 of the most significant private collections of Lepi- and 10/0.25. -
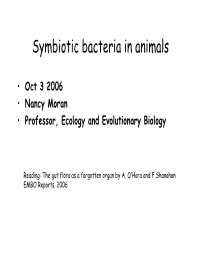
The Genomics and Evolution of Mutualistic and Pathogenic Bacteria
Symbiotic bacteria in animals • Oct 3 2006 • Nancy Moran • Professor, Ecology and Evolutionary Biology Reading: The gut flora as a forgotten organ by A. O’Hara and F Shanahan EMBO Reports. 2006 What is symbiosis? • Term typically used for a chronic association of members of more than one genetic lineage, without overt pathogenesis • Often for mutual benefit, which may be easy or difficult to observe – Exchange of nutrients or other metabolic products, protection, transport, structural integrity Microbes in animal evolution • Bacteria present by 3.9 bya, Archaea and Eukaryota by >2 bya – The Earth is populated by ecologically diverse microbes • Animals appear about 1 bya • Animals evolved in microbial soup – “Innate” immune system probably universal among animal phyla: pathogenic infection was a constant selection pressure – But animals also evolved codependence on microbes, some of which are required for normal development and reproduction evolutionary innovations through symbiosis: examples • Eukaryotic cell (mitochondria) • Photosynthesis in eukaryotes (plastids) • Colonization of land by plants (mycorrhizae) • Nitrogen fixation by plants (rhizobia) • Animal life at deep sea vents (chemoautotrophic life systems) • Use of many nutrient-limited niches by animal lineages Why do hosts and symbionts cooperate so often? • Persistent association allows both to increase their persistence and replication. –Coinheritance – Long-term infection • Intimate metabolic exchange generating immediate beneficial feedback Symbiosis- main variables • Route -

Oregon Invasive Species Action Plan
Oregon Invasive Species Action Plan June 2005 Martin Nugent, Chair Wildlife Diversity Coordinator Oregon Department of Fish & Wildlife PO Box 59 Portland, OR 97207 (503) 872-5260 x5346 FAX: (503) 872-5269 [email protected] Kev Alexanian Dan Hilburn Sam Chan Bill Reynolds Suzanne Cudd Eric Schwamberger Risa Demasi Mark Systma Chris Guntermann Mandy Tu Randy Henry 7/15/05 Table of Contents Chapter 1........................................................................................................................3 Introduction ..................................................................................................................................... 3 What’s Going On?........................................................................................................................................ 3 Oregon Examples......................................................................................................................................... 5 Goal............................................................................................................................................................... 6 Invasive Species Council................................................................................................................. 6 Statute ........................................................................................................................................................... 6 Functions ..................................................................................................................................................... -
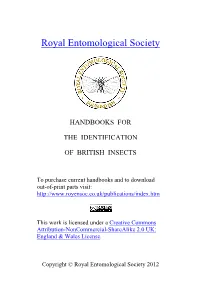
Coleoptera: Introduction and Key to Families
Royal Entomological Society HANDBOOKS FOR THE IDENTIFICATION OF BRITISH INSECTS To purchase current handbooks and to download out-of-print parts visit: http://www.royensoc.co.uk/publications/index.htm This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales License. Copyright © Royal Entomological Society 2012 ROYAL ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON Vol. IV. Part 1. HANDBOOKS FOR THE IDENTIFICATION OF BRITISH INSECTS COLEOPTERA INTRODUCTION AND KEYS TO FAMILIES By R. A. CROWSON LONDON Published by the Society and Sold at its Rooms 41, Queen's Gate, S.W. 7 31st December, 1956 Price-res. c~ . HANDBOOKS FOR THE IDENTIFICATION OF BRITISH INSECTS The aim of this series of publications is to provide illustrated keys to the whole of the British Insects (in so far as this is possible), in ten volumes, as follows : I. Part 1. General Introduction. Part 9. Ephemeroptera. , 2. Thysanura. 10. Odonata. , 3. Protura. , 11. Thysanoptera. 4. Collembola. , 12. Neuroptera. , 5. Dermaptera and , 13. Mecoptera. Orthoptera. , 14. Trichoptera. , 6. Plecoptera. , 15. Strepsiptera. , 7. Psocoptera. , 16. Siphonaptera. , 8. Anoplura. 11. Hemiptera. Ill. Lepidoptera. IV. and V. Coleoptera. VI. Hymenoptera : Symphyta and Aculeata. VII. Hymenoptera: Ichneumonoidea. VIII. Hymenoptera : Cynipoidea, Chalcidoidea, and Serphoidea. IX. Diptera: Nematocera and Brachycera. X. Diptera: Cyclorrhapha. Volumes 11 to X will be divided into parts of convenient size, but it is not possible to specify in advance the taxonomic content of each part. Conciseness and cheapness are main objectives in this new series, and each part will be the work of a specialist, or of a group of specialists. -

Two New Species of the Aphid Genus Uroleucon (Hemiptera: Aphididae) Living on Grindelia in the USA
European Journal of Taxonomy 729: 42–53 ISSN 2118-9773 https://doi.org/10.5852/ejt.2020.729.1189 www.europeanjournaloftaxonomy.eu 2020 · Barjadze S. & Kanturski M. This work is licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Research article urn:lsid:zoobank.org:pub:5D9A5938-4858-4F8D-A50D-6E2CF5623E69 Two new species of the aphid genus Uroleucon (Hemiptera: Aphididae) living on Grindelia in the USA Shalva BARJADZE 1 & Mariusz KANTURSKI 2, * 1 Institute of Zoology, Ilia State University, Giorgi Tsereteli 3, 0162, Tbilisi 0159, Georgia. 2 Zoology Research Team, Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Faculty of Natural Sciences, University of Silesia in Katowice, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Poland. * Corresponding author: [email protected] 1 Email: [email protected] 1 urn:lsid:zoobank.org:author:63ABE1B2-8A56-42C8-BC34-1119D3A2ECBC 2 urn:lsid:zoobank.org:author:78C290A3-D07B-4AF9-9358-ED8C05A702BF Abstract. Here, we present descriptions of two new aphid species of the genus Uroleucon Mordvilko, 1914 (Hemiptera: Aphididae: Macrosiphini), which are associated with the plant genus Grindelia Willd. (Asteraceae). An apterous viviparous female of Uroleucon (Lambersius) robinsoni sp. nov. from Oregon and apterous and alate viviparous females of Uroleucon (Lambersius) grindeliae sp. nov. from Colorado are described and illustrated. Taxonomical notes of the new and other Grindelia-feeding taxa of Uroleucon are given and an updated key to the apterae of the Grindelia-feeding species of Uroleucon in the world is provided. Keywords. Macrosiphini, Uroleucon, Lambersius, new taxa, North America. Barjadze S. & Kanturski M. 2020. Two new species of the aphid genus Uroleucon (Hemiptera: Aphididae) living on Grindelia in the USA.