Natur Und Heimat, 75
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diversity and Resource Choice of Flower-Visiting Insects in Relation to Pollen Nutritional Quality and Land Use
Diversity and resource choice of flower-visiting insects in relation to pollen nutritional quality and land use Diversität und Ressourcennutzung Blüten besuchender Insekten in Abhängigkeit von Pollenqualität und Landnutzung Vom Fachbereich Biologie der Technischen Universität Darmstadt zur Erlangung des akademischen Grades eines Doctor rerum naturalium genehmigte Dissertation von Dipl. Biologin Christiane Natalie Weiner aus Köln Berichterstatter (1. Referent): Prof. Dr. Nico Blüthgen Mitberichterstatter (2. Referent): Prof. Dr. Andreas Jürgens Tag der Einreichung: 26.02.2016 Tag der mündlichen Prüfung: 29.04.2016 Darmstadt 2016 D17 2 Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit entsprechend den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis selbständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter angefertigt habe. Sämtliche aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommene Gedanken sowie sämtliche von Anderen direkt oder indirekt übernommene Daten, Techniken und Materialien sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Hochschule zu Prüfungszwecken eingereicht. Osterholz-Scharmbeck, den 24.02.2016 3 4 My doctoral thesis is based on the following manuscripts: Weiner, C.N., Werner, M., Linsenmair, K.-E., Blüthgen, N. (2011): Land-use intensity in grasslands: changes in biodiversity, species composition and specialization in flower-visitor networks. Basic and Applied Ecology 12 (4), 292-299. Weiner, C.N., Werner, M., Linsenmair, K.-E., Blüthgen, N. (2014): Land-use impacts on plant-pollinator networks: interaction strength and specialization predict pollinator declines. Ecology 95, 466–474. Weiner, C.N., Werner, M , Blüthgen, N. (in prep.): Land-use intensification triggers diversity loss in pollination networks: Regional distinctions between three different German bioregions Weiner, C.N., Hilpert, A., Werner, M., Linsenmair, K.-E., Blüthgen, N. -

Biological Control and Pollination in Cider Apple Orchards: a Socio-Ecological
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas Programa de Doctorado: “Biogeociencias” Línea de investigación: Ecología y Biodiversidad Biological Control and Pollination in Cider Apple Orchards: a Socio-ecological Approach A thesis submitted by Rodrigo Martínez Sastre Under the supervision of Dr. Marcos Miñarro and Dr. Daniel García Oviedo 2020 RECOMMENDED CITATION: Martínez-Sastre, R. (2020). Biological control and pollination in cider apple orchards: a socio-ecological approach. PhD Thesis. University of Oviedo (Oviedo, Asturias). Spain RESUMEN DEL CONTENIDO DE TESIS DOCTORAL 1.- Título de la Tesis Español/Otro Idioma: Control biológico y Inglés: Biological control and pollination in polinización en plantaciones de manzana de cider-apple orchards: a socio-ecological sidra: una aproximación socio-ecológica approach. 2.- Autor Nombre: RODRIGO MARTÍNEZ SASTRE DNI/Pasaporte/NIE: 53474767C Programa de Doctorado: BIOGEOCIENCIAS Órgano responsable: DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS RESUMEN (en español) La expansión agrícola y su intensificación son unas de las principales causas del deterioro medio ambiental y de la pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Aunque suene contradictorio, esta tendencia actual pone en peligro el suministro futuro de alimentos a escala global. Sin embargo, una agricultura rentable que haga compatible la seguridad alimentaria con la conservación de la naturaleza es posible. En 010 (Reg.2018) 010 - los últimos años, muchos esfuerzos se han destinado a detener los daños generados por la agricultura y hacerla más sostenible. Lamentablemente, queda mucho camino por recorrer. La biodiversidad, asociada VOA - al suministro de servicios ecosistémicos, puede aportar diversos beneficios al rendimiento de los cultivos. MAT - Sin embargo, para asentar dicha biodiversidad es necesario cumplir ciertas condiciones favorables dentro FOR y cerca del cultivo. -

Of the Vitosha Mountain
Historia naturalis bulgarica 26: 1–66 ISSN 0205-3640 (print) | ISSN 2603-3186 (online) • http://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/ publication date [online]: 17 May 2018 The Dipterans (Insecta: Diptera) of the Vitosha Mountain Zdravko Hubenov Abstract. A total of 1272 two-winged species that belong to 58 families has been reported from theVitosha Mt. The Tachinidae (208 species or 16.3%) and Cecidomyiidae (138 species or 10.8%) are the most numerous. The greatest number of species has been found in the mesophylic and xeromesophylic mixed forests belt (707 species or 55.6%) and in the northern part of the mountain (645 species or 50.7%). The established species belong to 83 areographical categories. The dipterous fauna can be divided into two main groups: 1) species with Mediterranean type of distribution (53 species or 4.2%) – more thermophilic and distributed mainly in the southern parts of the Palaearctic; seven species of southern type, distributed in the Palaearctic and beyond it, can be formally related to this group as well; 2) species with Palaearctic and Eurosiberian type of distribution (1219 species or 95.8%) – more cold-resistant and widely distributed in the Palaearctic; 247 species of northern type, distributed in the Palaearctic and beyond it, can be formally related to this group as well. The endemic species are 15 (1.2%). The distribution of the species according to the zoogeographical categories in the vegetation belts and the distribution of the zoogeographical categories in each belt are considered. The dipteran fauna of the Vitosha Mt. is compared to this of the Rila and Pirin Mountains. -

Klicken, Um Den Anhang Zu Öffnen
Gredleria- VOL. 1 / 2001 Titelbild 2001 Posthornschnecke (Planorbarius corneus L.) / Zeichnung: Alma Horne Volume 1 Impressum Volume Direktion und Redaktion / Direzione e redazione 1 © Copyright 2001 by Naturmuseum Südtirol Museo Scienze Naturali Alto Adige Museum Natöra Südtirol Bindergasse/Via Bottai 1 – I-39100 Bozen/Bolzano (Italien/Italia) Tel. +39/0471/412960 – Fax 0471/412979 homepage: www.naturmuseum.it e-mail: [email protected] Redaktionskomitee / Comitato di Redazione Dr. Klaus Hellrigl (Brixen/Bressanone), Dr. Peter Ortner (Bozen/Bolzano), Dr. Gerhard Tarmann (Innsbruck), Dr. Leo Unterholzner (Lana, BZ), Dr. Vito Zingerle (Bozen/Bolzano) Schriftleiter und Koordinator / Redattore e coordinatore Dr. Klaus Hellrigl (Brixen/Bressanone) Verantwortlicher Leiter / Direttore responsabile Dr. Vito Zingerle (Bozen/Bolzano) Graphik / grafica Dr. Peter Schreiner (München) Zitiertitel Gredleriana, Veröff. Nat. Mus. Südtirol (Acta biol. ), 1 (2001): ISSN 1593 -5205 Issued 15.12.2001 Druck / stampa Gredleriana Fotolito Varesco – Auer / Ora (BZ) Gredleriana 2001 l 2001 tirol Die Veröffentlichungsreihe »Gredleriana« des Naturmuseum Südtirol (Bozen) ist ein Forum für naturwissenschaftliche Forschung in und über Südtirol. Geplant ist die Volume Herausgabe von zwei Wissenschaftsreihen: A) Biologische Reihe (Acta Biologica) mit den Bereichen Zoologie, Botanik und Ökologie und B) Erdwissenschaftliche Reihe (Acta Geo lo gica) mit Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Diese Reihen können jährlich ge mein sam oder in alternierender Folge erscheinen, je nach Ver- fügbarkeit entsprechender Beiträge. Als Publikationssprache der einzelnen Beiträge ist Deutsch oder Italienisch vorge- 1 Naturmuseum Südtiro sehen und allenfalls auch Englisch. Die einzelnen Originalartikel erscheinen jeweils Museum Natöra Süd Museum Natöra in der eingereichten Sprache der Autoren und sollen mit kurzen Zusammenfassun- gen in Englisch, Italienisch und Deutsch ausgestattet sein. -

Invertebrate Report 2018
An Inventory of Invertebrates recorded from Three Hagges Wood-meadow During 2018 Cercopis vulnerata Black-and-red Froghopper [a bug] adult Lithophane ornitopus Grey-shoulder Knot [a moth] adult Ochlodes sylvanus Large Skipper [a butterfly] male Leucozona lucorum [a hoverfly] female A Report to Hagge Woods Trust by Andrew Grayson The Author is a lifelong amateur naturalist who has been a professional invertebrate specialist since 2009. He has been involved with invertebrate studies at Three Hagges Wood-meadow since 2014, when the site was then known as Three Hagges Jubilee Wood, and has been very pleased to be associated with The Wood Meadow Project and the wonderful group of people involved in management of the Three Hagges Wood-meadow site. This association was responsible for his nomination for the Gilbert White Adult Award at the 2018 UK Awards for Biological Recording and Information Sharing held in Nottingham, where he was honoured to make the final shortlist, and for his appearance in the BBC Wildlife Magazine. These were both unexpected achievements. Andrew very much looks forward to being involved with studies at Three Hagges Wood-meadow during 2019. These will not be on the scale of the studies of the past five years, but hopefully will continue to provide useful invertebrate records, including some interesting and unexpected species, as has been the case since 2014. Andrew Grayson at Three Hagges Wood-meadow Invertebrates on the Front Cover Cercopis vulnerata Black-and-red Froghopper [a bug] Single examples of this small but conspicuous and distinctive bug have been seen roughly half-way along the A19 Strip (Area 12) every year since 2014. -

Notable Invertebrates Associated with Coastal Sand Dunes
Notable invertebrates associated with coastal sand dunes Slugs and snails (Mollusca) Catinella arenaria BAP Priority, RDB 1 Spiders and allies (Arachnida: Araneae and Pseudoscorpiones) Agroeca lusatica RDB1 Clubiona frisia RDB3 Enoplognatha oelandica RDB3 Phlegra fasciata RDB3 Trichopterna cito RDB2 Agraecina striata Nb Agroeca cuprea Na Argiope bruennichi Na Baryphyma maritimum Nb Ceratinopsis romana Nb Crustulina sticta Nb Drassyllus lutetianus Na Haplodrassus dalmatensis Nb Hypomma fulvum Na Marpissa nivoyi Nb Mecopisthes peusi Nb Mioxena blanda Nb Myrmarachne formicaria Nb Ozyptila nigrita Nb Ozyptila scabricula Nb Philodromus fallax Nb Silometopus incurvatus Na Sitticus saltator Nb Synageles venator Na Xysticus acerbus Na Myriapoda (terrestrial native species only) Centipedes (Chilopoda) Lithobius lapidicola RDBK Woodlice (Isopoda) Armadillidium album Nb Grasshoppers, Crickets and cockroaches (Orthoptera/Dermaptera/Dictyoptera) Platycleis albopunctata Nb Metrioptera brachyptera Nb Tetrix ceperoi Na Gomphocerippus rufus Nb Ectobius pallidus Nb Ectobius panzeri Nb True bugs (Hemiptera) Heteroptera Geotomus punctulatus RDB1 Odontoscelis fuliginos RDB3 Rhopalus rufus RDB3 Emblethis verbasci RDB3 Ortholomus punctipennis RDB3 Pionomus varius RDB3 Peritrechus gracilicornis RDBK Halictus macrocephalus RDBK Hallodapus montandoni RDB3 Monosynamma maritime RDB3 Polymerus vulneratus RDB1 Legnotus picipes Nb Eurygaster maura Nb = (pRDB2) Odontoscelis lineola Nb Sciocoris cursitans Nb Spathocera dahlmanni Na Dicranocephalus agilis Nb Graptopeltus -

Heracleum Sphondylium (Berce Commune - Gewone Berenklauw) V.7VIII9 Ascomycetes Cantharidae Dermestidae
Heracleum sphondylium (Berce commune - Gewone berenklauw) v.7VIII9 Ascomycetes Cantharidae Dermestidae Phaenolobus terebrator Erysiphe heraclei (Schermbloemmeeldauw) Anthrenocerus australis (Australische Malachiidae Rhagonycha fulva (Kleine rode weekschild) tapijtkever) Agromyzidae Cerambycidae Epermeniidae Anthocomus rufus (Malachie rousse) Phytomyza spondylii Miridae Stictoleptura rubra (Lepture rouge - Rode Epermenia chaerophyllella Andrenidae Smalbok) Gasteruptiidae Chrysomelidae Lygus pratensis (Weidewants) Gasteruption sp Mordellidae Chrysolina oricalcia (Chrysomèle couleur de Halictidae Andrena florea (Heggerankbij) laiton) Lasioglossum morio Braconidae Coccinellidae (Langkopsmaragdgroefbij) Ichneumonidae Variimorda villosa (Mordelle - Viltbandkevertje) Muscidae Cremnops desertor Calliphoridae Psyllobora vigintiduopunctata (Coccinelle à 22 Amblyteles armatorius points - 22-stippelig lieveheersbeestje) Colletidae Hylaeus brevicornis (Kortsprietmaskerbij) Hylaeus communis (Gewone Maskerbij) Crambidae Graphomya maculata (Graphomyie tachetée) Scarabaeidae Groene Vleesvlieg spec. - Lucilia spec. Ctenichneumon sp (Ichneumon) Sitochroa palealis Trichius zonatus (Trichie à bandes, Cétoine - Penseelkever) Heracleum sphondylium (Berce commune - Gewone berenklauw) v.7VIII9 Sphecidae Syrphidae Parhelophilus frutetorum (Bos-fluweelzwever) Volucella zonaria (Volucelle zonée - Cerceris rybyensis (Groefbijdoder - Gewone Cheilosia illustrata (Wollig gitje) Hoornaarzweefvlieg, Stadsreus) graafbijendoder) Tachinidae Pipiza festiva Cheilosia sp (Gitje) -

Some of the Most Important Invertebrates in the Lye Valley SSSI
Some of the most important invertebrates in the Lye Valley SSSI & LWS areas including mostly fens (old Hogley Bog) J A Webb 2015 This species list includes a large number of common invertebrates. These are just the ones that are scarce-to-rare locally or nationally and thus of conservation concern. Many remain as yet unidentified. Note that proper surveys for moths and beetles have not yet been carried out, so there will be more important species to add to these groups. KEY to Conservation Statuses: RDB = Red Data Book listed (1 = Endangered, 2 = Vulnerable, 3 = Rare) NT = Near threatened Shading = BAP = Biodiversity Action Plan Species (now known as Section 41 species) of most conservation concern Scientific name Common name Group Wetland/Dryland species Local/national status Comment Thecla betulae Brown hairstreak Butterfly Scrub RDB/BAP Section 41 In scrub with blackthorn Lasius fuliginosus Jet ant Ant Scrub/trees Local Nests in hollow tree, rare other insect species associated Andrena labiata Girdled mining bee Bee Wetland/scrub/grassland Notable / Nat scarce Coelioxys elongata Dull-vented Sharp- Bee Wetland/scrub/grassland Local tail Hylaeus pictipes Solitary bee Bee Wetland/scrub/grassland Notable / Nat Scarce Colletes hederae Ivy bee Bee Scrub Local in S England Increasing species, feeds only on ivy flowers Eubria palustris Water penny Beetle Wetland RDB 3 Rare Needs very short vegetation, beetle warm wet fen Phytoecia cylindrica Umbellifer longhorn Beetle Wetland/scrub/grassland Notable/ Nat Scarce Breeds in umbellifers beetle -

Molecular Phylogeny and Evolution of World Tachinidae (Diptera) ⁎ John O
Molecular Phylogenetics and Evolution xxx (xxxx) xxx–xxx Contents lists available at ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/ympev Editor’s Choice Article Molecular phylogeny and evolution of world Tachinidae (Diptera) ⁎ John O. Stireman IIIa, , Pierfilippo Cerrettib, James E. O'Harac, Jeremy D. Blaschked, John K. Moultone a Department of Biological Sciences, Wright State University, Dayton, OH 45435, USA b Dipartimento di Biologia e Biotecnologie ‘Charles Darwin’, ‘Sapienza’ Università di Roma, Piazzale A. Moro 5, Rome 00185, Italy c Canadian National Collection of Insects, Agriculture and Agri-Food Canada, 960 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1A 0C6, Canada d Department of Biology, Union University, 1050 Union University Drive, Jackson, TN 38305, USA e Department of Entomology and Plant Pathology, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996, USA ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: We reconstructed phylogenetic relationships within the diverse parasitoid fly family Tachinidae using four Tachinid fly nuclear loci (7800 bp) and including an exceptionally large sample of more than 500 taxa from around the Parasitoid world. The position of the earthworm-parasitizing Polleniinae (Calliphoridae s.l.) as sister to Tachinidae is Host use strongly supported. Our analyses recovered each of the four tachinid subfamilies and most recognized tribes, Oestroidea with some important exceptions in the Dexiinae and Tachininae. Most notably, the tachinine tribes Macquartiini Diversification and Myiophasiini form a clade sister to all other Tachinidae, and a clade of Palpostomatini is reconstructed as Ancestral state reconstruction sister to Dexiinae + Phasiinae. Although most nodes are well-supported, relationships within several lineages that appear to have undergone rapid episodes of diversification (basal Dexiinae and Tachininae, Blondeliini) were poorly resolved. -

Tachinid Flies (Diptera, Tachinidae) of Warsaw and Mazovia
POLISH ACADEMY OF SCIENCES • INSTITUTE OF ZOOLOGY MEMORABILIA ZOOLOGICA MEMORABILIA ZOOL. 35 141— 162 14SI AGNIESZKA DRABER-MOŃKO TACHINID FLIES (.DIPTERA, TACHINIDAE) OF WARSAW AND MAZO VIA ABSTRACT The Tachinidae of the Mazovian Lowland (285 species) account for 65% of the total number of species occurring in Poland. In Warsaw 164 species occur, including 123 in the suburbs, and 107 in urban green areas, the latter being subdivided into parks (90 species), green areas of housing estates (30 species) and the centre of the town (47 species). Such groups are represented by the highest number of species as parasitoids of lepidopterans and beetles, with high ecological amplitudes, and also polyphages with large geographical ranges (Palaearctic and Euro-Siberian). INTRODUCTION Flies of,the family Tachinidae are poorly known both in Poland and in the whole Palaearctic. Tachinid flies of Mazovia and Warsaw have not been extensively studied so far. From Warsaw 42 species were known [2, 8, 11]. At present 164 species have been recorded in Warsaw. From the Mazovian Lowland, 85 species have been recorded so far, including 23 species listed by Sznabl [11], nine species listed by Wiąckow- ski [13. 15]. three species quoted by Miczulski and Koślińska [7], and single species quoted by Kuntze [5], Pawłowicz [10], Koehler [4]. Szujecki [12], and the other species by Draber-Mońko [2,8]. At present 285 ta,chinid flies are known from the Mazovian Lowland. The objective of the work was to establish the species composition of tachinid flies living in the Mazovian Lowland and Warsaw, and to analyse their geographical distribution and ecology. -
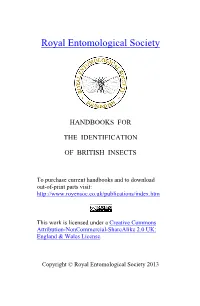
An Introduction to the Immature Stages of British Flies
Royal Entomological Society HANDBOOKS FOR THE IDENTIFICATION OF BRITISH INSECTS To purchase current handbooks and to download out-of-print parts visit: http://www.royensoc.co.uk/publications/index.htm This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales License. Copyright © Royal Entomological Society 2013 Handbooks for the Identification of British Insects Vol. 10, Part 14 AN INTRODUCTION TO THE IMMATURE STAGES OF BRITISH FLIES DIPTERA LARVAE, WITH NOTES ON EGGS, PUP ARIA AND PUPAE K. G. V. Smith ROYAL ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON Handbooks for the Vol. 10, Part 14 Identification of British Insects Editors: W. R. Dolling & R. R. Askew AN INTRODUCTION TO THE IMMATURE STAGES OF BRITISH FLIES DIPTERA LARVAE, WITH NOTES ON EGGS, PUPARIA AND PUPAE By K. G. V. SMITH Department of Entomology British Museum (Natural History) London SW7 5BD 1989 ROYAL ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON The aim of the Handbooks is to provide illustrated identification keys to the insects of Britain, together with concise morphological, biological and distributional information. Each handbook should serve both as an introduction to a particular group of insects and as an identification manual. Details of handbooks currently available can be obtained from Publications Sales, British Museum (Natural History), Cromwell Road, London SW7 5BD. Cover illustration: egg of Muscidae; larva (lateral) of Lonchaea (Lonchaeidae); floating puparium of Elgiva rufa (Panzer) (Sciomyzidae). To Vera, my wife, with thanks for sharing my interest in insects World List abbreviation: Handbk /dent. Br./nsects. © Royal Entomological Society of London, 1989 First published 1989 by the British Museum (Natural History), Cromwell Road, London SW7 5BD. -

A Review of the Invertebrates Associated with Lowland Calcareous Grassland�� English Nature Research Reports
Report Number 512 A review of the invertebrates associated with lowland calcareous grassland English Nature Research Reports working today for nature tomorrow English Nature Research Reports Number 512 A review of the invertebrates associated with lowland calcareous grassland Dr K N A Alexander April 2003 You may reproduce as many additional copies of this report as you like, provided such copies stipulate that copyright remains with English Nature, Northminster House, Peterborough PE1 1UA ISSN 0967-876X © Copyright English Nature 2003 Acknowledgements Thanks are due to Jon Webb for initiating this project and Dave Sheppard for help in its progression. Each draft species table was circulated amongst a number of invertebrate specialists for their reactions and additional data. Comments on the Coleoptera table were received from Jonty Denton, Tony Drane, Andrew Duff, Andy Foster, Peter Hodge, Pete Kirby, Derek Lott, Mike Morris; Hemiptera from Jonty Denton, Pete Kirby and Alan Stewart; Hymenoptera from Michael Archer, Graham Collins, Mike Edwards, and Andy Foster; spiders from Peter Harvey, David Nellist and Rowley Snazell; moths from Andy Foster and Mark Parsons. Summary This report brings together a considerable amount of information on the species composition of the invertebrate fauna of lowland calcareous grasslands, and is aimed at helping field workers and site managers to obtain a broader understanding of the extent and importance of the fauna. It concentrates on the species most closely associated with the habitat type and provides preliminary assessments of their habitat fidelity, the importance of habitat continuity, and their microhabitat preferences. Many factors influence the composition of the fauna of calcareous grasslands.