N8 Laenderinfo Somalia.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Assessment Report 2011
ASSESSMENT REPORT 2011 PHASE 1 - PEACE AND RECONCILIATION JOIN- TOGETHER ACTION For Galmudug, Himan and Heb, Galgaduud and Hiiraan Regions, Somalia Yme/NorSom/GSA By OMAR SALAD BSc (HONS.) DIPSOCPOL, DIPGOV&POL Consultant, in collaboration with HØLJE HAUGSJÅ (program Manager Yme) and MOHAMED ELMI SABRIE JAMALLE (Director NorSom). 1 Table of Contents Pages Summary of Findings, Analysis and Assessment 5-11 1. Introduction 5 2. Common Geography and History Background of the Central Regions 5 3. Political, Administrative Governing Structures and Roles of Central Regions 6 4. Urban Society and Clan Dynamics 6 5. Impact of Piracy on the Economic, Social and Security Issues 6 6. Identification of Possibility of Peace Seeking Stakeholders in Central Regions 7 7. Identification of Stakeholders and Best Practices of Peace-building 9 8. How Conflicts resolved and peace Built between People Living Together According 9 to Stakeholders 9. What Causes Conflicts Both locally and regional/Central? 9 10. Best Practices of Ensuring Women participation in the process 9 11. Best Practices of organising a Peace Conference 10 12. Relations Between Central Regions and Between them TFG 10 13. Table 1: Organisation, Ownership and Legal Structure of the 10 14. Peace Conference 10 15. Conclusion 11 16. Recap 11 16.1 Main Background Points 16.2 Recommendations 16.3 Expected Outcomes of a Peace Conference Main and Detailed Report Page 1. Common geography and History Background of Central Regions 13 1.1 Overview geographical and Environmental Situation 13 1.2 Common History and interdependence 14 1.3 Chronic Neglect of Central Regions 15 1.4 Correlation Between neglect and conflict 15 2. -

Clan – Based Federalism in Somalia and Relationship Between The
T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES CLAN – BASED FEDERALISM IN SOMALIA AND RELATIONSHIP BETWEEN THE FEDERAL GOVERNMENT AND FEDERAL MEMBER STATES MASTER THESIS HAMDİ ALİ MUSSE DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION ANKARA 2020 T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES CLAN – BASED FEDERALISM IN SOMALIA AND RELATIONSHIP BETWEEN THE FEDERAL GOVERNMENT AND FEDERAL MEMBER STATES MASTER THESIS HAMDİ ALİ MUSSE DEPARMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION Supervisor Assistant Professor Selcen ÖZKAN ANKARA 2020 ACCEPTATION AND CONFIRMATION PAGE The thesis, prepared by HAMDI ALI MUSSE and titled “CLAN–BASED FEDERALISM IN SOMALIA AND RELATIONSHIP BETWEEN THE FEDERAL GOVERNMENT AND FEDERAL MEMBER STATES”, is accepted as a master thesis at Ankara Yildirim Beyazit University, Institute of Social Sciences, Department of Political Science and Public Administration by unanimous vote/majority vote. Tittle Name Surname Institution Signature Ankara Yıldırım Assist. Prof. Dr. Selcen ÖZKAN Beyazıt University Ankara Yıldırım Assoc. Prof. Dr. Ayşe Çolpan YALDIZ Beyazıt University Assist. Prof. Dr. Feriha YILDIRIM Gazi University Thesis Defense Date: 11.11.2020 I approve that the thesis fulfills the necessities to be deemed a master thesis at Ankara Yildirim Beyazit University, Institute of Social Sciences, Department of Political Science and Public Administration. Director of the Graduate School of Social Sciences Title Name Surname DECLARATION I hereby declare that this Master thesis titled Clan–based federalism in Somalia and relationship between the Federal government and Federal member states has been prepared in accordance with the thesis writing of manual of the graduate school of Social science. -

Report on Minority Groups in Somalia
The Danish Immigration Service Ryesgade 53 DK-2100 Copenhagen Ø Phone: + 45 35 36 66 00 Website: www.udlst.dk E-mail: [email protected] Report on minority groups in Somalia Joint British, Danish and Dutch fact-finding mission to Nairobi, Kenya 17 – 24 September 2000 Report on minority groups in Somalia Table of contents 1. Background ..................................................................................................................................5 2. Introduction to sources and methodology....................................................................................6 3. Overall political developments and the security situation in Somalia.......................................10 3.1 Arta peace process in Djibouti...............................................................................................10 3.2 Transitional National Assembly (TNA) and new President ..................................................10 3.2.1 Position of North West Somalia (Somaliland)...............................................................12 3.2.2 Position of North East Somalia (Puntland)....................................................................13 3.2.3 Prospects for a central authority in Somalia ..................................................................13 3.3 Security Situation...................................................................................................................14 3.3.1 General...........................................................................................................................14 -

SOMALIA - May 2011
Minority Rights Group International (MRG) - individual UPR submission - SOMALIA - May 2011 1. Introductory executive summary 1.1 The situation and struggle for minority rights in Somalia must be considered in the context of Somalia in the last 20 years of state collapse, civil war and resulting humanitarian disaster. Immense violations of basic human rights have affected all Somalis, majorities (Darod, Hawiye, Dir and Rahanweyn) and minorities alike (Bantu, Gaboye, Madhiban, Musse Deriyo, Tumal, Yibro, Benadiri, Barawani, Bajuni, Boni, Ashraf and Shekhal). However, majority groups benefit from a traditional clan structure that has afforded them protection and privilege not available to minorities, who, regardless of the conflict, continue to suffer marginalization and exclusion from mainstream economic, social and political life, thanks to a legacy of slavery, customary segregation, dispossession and displacement. Somalia’s minorities are diverse and not framed simply by elements of ethnic, religious or linguistic differentiation. Their diversity also rests on social and historical distinctions between minorities and the pastoralist majorities. 1.2 Civil war, and later an Islamist insurgency against a weak transitional government in south-central Somalia, have forced thousands of minorities from their homes and lands, both to other parts of Somalia and abroad. Minorities have been targeted due to lack of protection as well as, in some cases, for their religious or other traditional beliefs and practices. Through field research results, MRG has found that minority women, in particular, suffer egregious abuse in the context of displacement. In 2009, MRG’s researchers, visiting internally displaced person (IDP) camps in semi-autonomous Puntland in northeastern Somalia, were told of a disturbing and persistent pattern of rape of minority women, perpetrated by majority men and sometimes by members of the Puntland police, army or security service. -

Somalia OGN V11.0 Issued 27 October 2006
Somalia OGN v11.0 Issued 27 October 2006 OPERATIONAL GUIDANCE NOTE SOMALIA Immigration and Nationality Directorate CONTENTS 1. Introduction 1.1 – 1.4 2. Country assessment 2.1 – 2.15 3. Main categories of claims 3.1 Members of major clan families or related sub-clans 3.6 Bajunis 3.7 Benadiri (Rer Hamar) or Bravanese 3.8 Midgan, Tumal, Yibir or Galgala 3.9 Prison conditions 3.10 4. Discretionary Leave 4.1 Minors claiming in their own right 4.3 Medical treatment 4.4 5. Returns 5.1 – 5.5 6. List of source documents 1. Introduction 1.1 This document summarises the general, political and human rights situation in Somalia and provides information on the nature and handling of claims frequently received from nationals/residents of that country. It must be read in conjunction with any COI Service Somalia Country of Origin Information at: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/country_reports.html 1.2 This guidance is intended to provide clear guidance on whether the main types of claim are or are not likely to justify the grant of asylum, Humanitarian Protection or Discretionary Leave. Caseworkers should refer to the following Asylum Policy Instructions for further details of the policy on these areas: API on Assessing the Claim API on Humanitarian Protection API on Discretionary Leave API on the European Convention on Human Rights API on Article 8 ECHR 1.3 Claims should be considered on an individual basis, but taking full account of the information set out below, in particular Part 3 on main categories of claims. -

State of Theworld's Minorities and Indigenous Peoples 2009
Education special minority rights group international State of theWorld’s Minorities and Indigenous Peoples 2009 Events of 2008 State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2009 Acknowledgements Minority Rights Group International Minority Rights Group International (MRG) 54 Commercial Street, London, E1 6LT, United gratefully acknowledges the support of all organizations Kingdom. Tel +44 (0)20 7422 4200, Fax +44 (0)20 and individuals who gave financial and other assistance 7422 4201, Email [email protected] to this publication, including UNICEF and the Website www.minorityrights.org European Commission. Getting involved Minority Rights Group International MRG relies on the generous support of institutions Minority Rights Group International (MRG) is a and individuals to further our work. All donations non-governmental organization (NGO) working to received contribute directly to our projects with secure the rights of ethnic, religious and linguistic minorities and indigenous peoples. minorities and indigenous peoples worldwide, One valuable way to support us is to subscribe and to promote cooperation and understanding to our report series. Subscribers receive regular between communities. Our activities are focused MRG reports and our annual review. We also on international advocacy, training, publishing and have over 100 titles which can be purchased outreach. We are guided by the needs expressed by from our publications catalogue. In addition, our worldwide partner network of organizations MRG publications are available to minority and which represent minority and indigenous peoples. indigenous peoples’ organizations through our MRG works with over 150 organizations in library scheme. nearly 50 countries. Our governing Council, which MRG’s unique publications provide well- meets twice a year, has members from 10 different researched, accurate and impartial information on State of countries. -

SOMALIA Building Human Rights in the Disintegrated State
SOMALIA Building human rights in the disintegrated state 1. INTRODUCTION Human rights have been violently abused in Somalia throughout the past 25 years. Massive human rights violations during President Mohamed Siad Barre's rule from 1969 to 1991 were followed by the disintegration of the state and brutal civil wars marked by widespread atrocities against civilians as well as a horrific famine. A key question now is how respect for basic human rights can be attained after years of massive human rights abuses, civil war, outside intervention and seemingly intractable local political and factional conflicts. After nearly five years of no government, building respect for human rights cannot be solely dependent on the complex and lengthy process of peace-making, although peace between the armed factions is clearly essential for reconstruction. Since the state of Somalia collapsed in 1991 after the overthrow of President Mohamed Siad Barre's government, there has been no recognized government or effective legal structure. The constant danger of further massive human rights abuses by warring groups remains, despite the United Nations (UN) intervention in 1992. After the UN withdrawal in March 1995, there are still frequent flare-ups of fighting between the armed factions in Mogadishu and in other regions in the south, as well as in the breakaway self-declared "Somaliland Republic" in the northwest, and associated reports of human rights abuses. On the more positive side, there are several regions -- including in the northeast and parts of Somaliland -- which have been relatively little affected by political violence, armed conflict and human rights abuses since 1991. -

Somalie : Le Groupe Minoritaire Des Gabooye/Midgan
Somalie : le groupe minoritaire des Gabooye/Midgan Recherche rapide de l’analyse-pays Berne, le 5 juillet 2018 Impressum Editeur Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) Case postale, 3001 Berne Tél. 031 370 75 75 Fax 031 370 75 00 E-mail : [email protected] Internet : www.osar.ch CP dons : 10-10000-5 Version disponible en français et en allemand COPYRIGHT © 2018 Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne Copies et impressions autorisées sous réserve de la mention de la source 1 Introduction Les questions suivantes ont été tirées d’une demande adressée à l’analyse-pays de l’OSAR : 1. De quelles informations dispose-t-on sur la situation des droits humains pour les membres de la caste des Gabooye en Somalie ? 2. Dans quelle mesure l’État somalien peut-il protéger les membres de la caste des Gabooye ? Les informations reposent sur une recherche limitée dans le temps (recherche rapide) dans des documents accessibles au public actuellement à disposition de l’OSAR. 2 Les Gabooye en Somalie 2.1 Clans et minorités en Somalie Les Gabooye (connus aussi sous le nom de Midgan, Madhiban et Musse Deriyo) ne constituent pas un clan, mais un groupe minoritaire. Selon un rapport de l’Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) de décembre 2012, les Gabooye (autre orthographe possible : Gaboye, aussi connu sous le nom de Midgan) forment un groupe minoritaire en Somalie et une « caste professionnelle » qui exerce des métiers traditionnels. Lors d’une présentation organisée en mai 2009 par l’Austrian Center for Country of Origin and Asylum Research (ACCORD), le Professeur Joakim Gundel, l’un des politologues spécialisés de la région Somali, a déclaré que la majorité de la population somalienne était composée de Somali, une ethnie d’éleveurs nomades appartenant aux clans dits « nobles » des Darood, des Hawiye, des Dir et, selon le point de vue, des Isaaq. -

Somalia Assessment
Somalia, Country Information Page 1 of 47 SOMALIA ASSESSMENT October 2002 Country Information and Policy Unit I SCOPE OF DOCUMENT II GEOGRAPHY III HISTORY IV STATE STRUCTURES VA HUMAN RIGHTS ISSUES VB HUMAN RIGHTS - SPECIFIC GROUPS ANNEX A: CHRONOLOGY ANNEX B: SOMALI CLAN STRUCTURE ANNEX C: POLITICAL ORGANISATIONS ANNEX D: PROMINENT PEOPLE REFERENCES TO SOURCE MATERIAL 1. SCOPE OF DOCUMENT 1.1 This assessment has been produced by the Country Information and Policy Unit, Immigration and Nationality Directorate, Home Office, from information obtained from a wide variety of recognised sources. The document does not contain any Home Office opinion or policy. 1.2 The assessment has been prepared for background purposes for those involved in the asylum/human rights determination process. The information it contains is not exhaustive. It concentrates on the issues most commonly raised in asylum/human rights claims made in the United Kingdom. 1.3 The assessment is sourced throughout. It is intended to be used by caseworkers as a signpost to the source material, which has been made available to them. The vast majority of the source material is readily available in the public domain. 1.4 It is intended to revise the assessment on a six-monthly basis while the country remains within the top 35 asylum-seeker producing countries in the United Kingdom. http://194.203.40.90/ppage.asp?section=193&title=Somalia%2C%20Country%20Informati...o 11/25/2002 Somalia, Country Information Page 2 of 47 2. GEOGRAPHY 2.1 Somalia (known officially from 1969 until the collapse of central government in 1991 as the Somali Democratic Republic) has an area of 637,657 sq km and borders Kenya, Ethiopia and Djibouti. -

U.S. DEPARTMENT of JUSTICE EXECUTIVE OFFICE for IMMIGRATION REVIEW OFFICE of the IMMIGRATION JUDGE CHICAGO, ILLINOIS ______In the Matter Of: ) ) Honorable Judge G
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE EXECUTIVE OFFICE FOR IMMIGRATION REVIEW OFFICE OF THE IMMIGRATION JUDGE CHICAGO, ILLINOIS ______________________________________________________________________________ In the Matter of: ) ) Honorable Judge G. Katsivalis Respondent ) A 00-000-000 ) ) In Removal Proceedings ) AFFIDAVIT OF ASHA A. SAMAD, PH.D I, Dr. Asha A. Samad, citizen of the United States of America, declare, under penalty of perjury under the laws of the United States of America, that the following is true and correct: I. PREPARER’S BACKGROUND 1. I hold a Ph.D. in Social Anthropology an East African Societies from the University of Dar es Salaam and am Professor of Anthropology, African and Women’s Studies at the City University of New York. I also serve as Director of the Human Rights Center at the City University of New York and conduct seminars on that subject. 2. I have twice been elected as Executive Administrator of Programs of the Somali Association for Relief and Development (SAFRAD), a not-for-profit organization, which resettles displaced Somalis in the United States and Canada. On behalf of SAFRAD, I travel to Somalia or surrounding areas twice a year to spend about sixteen weeks participating in human rights work. My last vis it to the Horn of Africa region was in July and August of 2004. Due to security concerns, I was unable to travel inside Somalia. 3. While in the United States, I am continually updated on the situation in Somalia and the plight of Somali refugees through reading newswire reports (Agence France-Presse, BBC, Reuters) and interviewing international relief workers, humanitarian workers, and Somali professional and grassroots leaders. -

Horn Von Afrika Horn Von Afrika ([email protected]) Dr
Autorinnen und Autoren Marion Aberle, Welthungerhilfe, Bonn ([email protected]) In den deutschen Medien wird das »Horn von Afrika« überwie- Hauptmann A.B., ehem. 25. DEU EinsKtg EU NAVFOR Somalia gend mit Dürren und Hungerkatastrophen, radikalem Islamis- Wegweiser zur Geschichte Prof. Dr. Malte Brosig, University of the Witwatersrand, Johannesburg mus, Krieg, Migration, Piraterie und Staatsversagen in Ver- ([email protected]) bindung gebracht. Seit dem Sturz seiner Regierung 1991 gilt Prof. Dr. Belachew Gebrewold, Management Center Innsbruck Somalia als der Inbegriff eines gescheiterten Staates. Der seit- ([email protected]) dem herrschende Konflikt wurde nach mehreren erfolglosen in- Dr. Nicole Hirt (NH), GIGA Institut für Afrika-Studien, Hamburg ternationalen Militärinterventionen Anfang der 1990er-Jahre, an ([email protected]) denen teilweise auch die Bundeswehr beteiligt war, kaum mehr Dr. Markus V. Höhne (MVH), Universität Leipzig beachtet. Erst durch das Aufkommen radikalislamistischer Grup- ([email protected]) pen Mitte der 2000er-Jahre und der drastischen Zunahme von Fregattenkapitän Dr. Christian Jentzsch (CJ), ZMSBw, Potsdam Piratenangriffen rückte Somalia erneut in den Fokus der Auf- ([email protected]) merksamkeit. Seit Juni 2008 schützen vor allem europäische Oberstleutnant Dr. Dieter H. Kollmer (DHK), ZMSBw, Potsdam Kriegsschiffe die Seewege rund um das Horn von Afrika und da- ([email protected]) mit eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. In den letz- Hans-Peter Konopka, Gesellschaft für Geographie und Geologie ten Jahren erlangte die Region im Nordosten Afrikas auch we- Bochum e.V. ([email protected]) gen gestiegener Flüchtlingszahlen Aufmerksamkeit in Europa. Hauptmann Torsten Konopka (TK), M.A., ZMSBw, Potsdam Der vorliegende Band führt die vom Zentrum für Militärge- ([email protected]) schichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr herausge- Prof. -
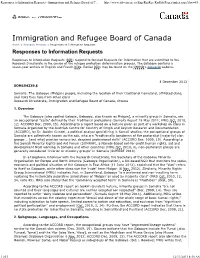
Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of C
Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of C... http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=45... Immigration and Refugee Board of Canada Home > Research Program > Responses to Information Requests Responses to Information Requests Responses to Information Requests (RIR) respond to focused Requests for Information that are submitted to the Research Directorate in the course of the refugee protection determination process. The database contains a seven-year archive of English and French RIRs. Earlier RIRs may be found on the UNHCR's Refworld website. 4 December 2012 SOM104239.E Somalia: The Gabooye (Midgan) people, including the location of their traditional homeland, affiliated clans, and risks they face from other clans Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa 1. Overview The Gabooye [also spelled Gaboye, Gabooyo; also known as Midgan], a minority group in Somalia, are an occupational "caste" defined by their traditional professions (Somalia Report 18 May 2011; MRG Oct. 2010, 12; ACCORD Dec. 2009, 15). According to a report based on a lecture given as part of a workshop on clans in Somalia organized by the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), by Dr. Joakim Gundel, a political analyst specializing in Somali studies, the occupational groups of Somalia are collectively known as the sab, who are "traditionally bondsmen of the pastoralist [majority] clan groups … [and who] practice various but despised professional skills" (ACCORD Dec. 2009, 15). According to the Somali Minority Rights and Aid Forum (SOMRAF), a Nairobi-based not-for-profit human rights, aid and development NGO working in Somalia and other countries (MRG Oct.