Ilhiv.Tlf ONÜJ
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nietzsche and Aestheticism
University of Chicago Law School Chicago Unbound Journal Articles Faculty Scholarship 1992 Nietzsche and Aestheticism Brian Leiter Follow this and additional works at: https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles Part of the Law Commons Recommended Citation Brian Leiter, "Nietzsche and Aestheticism," 30 Journal of the History of Philosophy 275 (1992). This Article is brought to you for free and open access by the Faculty Scholarship at Chicago Unbound. It has been accepted for inclusion in Journal Articles by an authorized administrator of Chicago Unbound. For more information, please contact [email protected]. Notes and Discussions Nietzsche and Aestheticism 1o Alexander Nehamas's Nietzsche: L~fe as Literature' has enjoyed an enthusiastic reception since its publication in 1985 . Reviewed in a wide array of scholarly journals and even in the popular press, the book has won praise nearly everywhere and has already earned for Nehamas--at least in the intellectual community at large--the reputation as the preeminent American Nietzsche scholar. At least two features of the book may help explain this phenomenon. First, Nehamas's Nietzsche is an imaginative synthesis of several important currents in recent Nietzsche commentary, reflecting the influence of writers like Jacques Der- rida, Sarah Kofman, Paul De Man, and Richard Rorty. These authors figure, often by name, throughout Nehamas's book; and it is perhaps Nehamas's most important achievement to have offered a reading of Nietzsche that incorporates the insights of these writers while surpassing them all in the philosophical ingenuity with which this style of interpreting Nietzsche is developed. The high profile that many of these thinkers now enjoy on the intellectual landscape accounts in part for the reception accorded the "Nietzsche" they so deeply influenced. -

Philosophy and Critical Theory
STANFORD UNIVERSITY PRESS PHILOSOPHY AND CRITICAL THEORY 20% DISCOUNT ON ALL TITLES 2021 TABLE OF CONTENTS The Complete Works of Friedrich Nietzsche .......... 2-3 Political Philosophy ................ 3-5 Ethics and Moral Philosophy ..................................5-6 Phenomenology and Critical Theory ..........................6-8 Meridian: Crossing Aesthetics ...................................8-9 Cultural Memory in the Present .................................9-11 Now in Paperback ....................... 11 Examination Copy Policy ........ 11 The Case of Wagner / Unpublished Fragments ORDERING Twilight of the Idols / from the Period of Human, Use code S21PHIL to receive a 20% discount on all ISBNs The Antichrist / Ecce Homo All Too Human I (Winter listed in this catalog. / Dionysus Dithyrambs / 1874/75–Winter 1877/78) Visit sup.org to order online. Visit Nietzsche Contra Wagner Volume 12 sup.org/help/orderingbyphone/ Volume 9 Friedrich Nietzsche for information on phone Translated, with an Afterword, orders. Books not yet published Friedrich Nietzsche Edited by Alan D. Schrift, by Gary Handwerk or temporarily out of stock will be Translated by Adrian Del Caro, Carol charged to your credit card when This volume presents the first English Diethe, Duncan Large, George H. they become available and are in Leiner, Paul S. Loeb, Alan D. Schrift, translations of Nietzsche’s unpublished the process of being shipped. David F. Tinsley, and Mirko Wittwar notebooks from the years in which he developed the mixed aphoristic- The year 1888 marked the last year EXAMINATION COPY POLICY essayistic mode that continued across of Friedrich Nietzsche’s intellectual the rest of his career. These notebooks Examination copies of select titles career and the culmination of his comprise a range of materials, includ- are available on sup.org. -
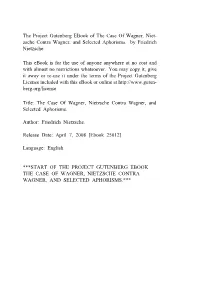
The Case of Wagner, Nietzsche Contra Wagner, and Selected Aphorisms
The Project Gutenberg EBook of The Case Of Wagner, Niet- zsche Contra Wagner, and Selected Aphorisms. by Friedrich Nietzsche. This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.guten- berg.org/license Title: The Case Of Wagner, Nietzsche Contra Wagner, and Selected Aphorisms. Author: Friedrich Nietzsche. Release Date: April 7, 2008 [Ebook 25012] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK THE CASE OF WAGNER, NIETZSCHE CONTRA WAGNER, AND SELECTED APHORISMS.*** Friedrich Nietzsche I: The Case Of Wagner II: Nietzsche Contra Wagner III: Selected Aphorisms Translated By Anthony M. Ludovici Third Edition T. N. Foulis 13 & 15 Frederick Street Edinburgh and London 1911 Contents Translator's Preface. 2 Preface To The Third Edition . 7 The Case Of Wagner: A Musician's Problem . 16 Nietzsche contra Wagner . 57 Selected Aphorisms from Nietzsche's Retrospect of his Years of Friendship with Wagner. 79 Footnotes . 99 [ix] Translator's Preface. Nietzsche wrote the rough draft of “The Case of Wagner” in Turin, during the month of May 1888; he completed it in Sils Maria towards the end of June of the same year, and it was published in the following autumn. “Nietzsche contra Wagner” was written about the middle of December 1888; but, although it was printed and corrected before the New Year, it was not published until long afterwards owing to Nietzsche's complete breakdown in the first days of 1889. -

Revolt Against Schopenhauer and Wagner? 177
Revolt against Schopenhauer and Wagner? 177 Revolt against Schopenhauer and Wagner? An Insight into Nietzsche’s Perspectivist Aesthetics MARGUS VIHALEM The article focuses on the basic assumptions of Nietzschean aesthetics, arguing that Nietzsche’s aesthetics in his later period cannot be thoroughly understood outside of the context of the long-term conflict with romanticist ideals and without considering Arthur Schopenhauer’s and Richard Wagner’s aesthetic and metaphysical positions. Nietzsche’s thinking on art and aesthetics is in fact inseparable from his philosophical standpoint, which complements and renders explicit the hidden meaning of his considerations on art. The article pays particular attention to Nietzsche’s writings on Wagner and Wagnerism and attempts to show that the ideas expressed in these writings form the very basis of Nietzschean aesthetics and, to some extent, had a remarkable impact on his whole philosophy. The article also argues that Nietzsche’s aesthetics may even be regarded, to a certain extent, as the cornerstone of his philosophical project. Only aesthetically can the world be justified. – Friedrich Nietzsche1 I The background: Christianity, romanticism and Schopenhauer Nietzsche undoubtedly stands as one of the most prominent figures of the anti- romanticist philosophy of art in the late nineteenth century, opposing to the ro- manticist vision of the future founded on feebleness the classic vision of the fu- ture based on forcefulness and simple beauty.2 Nietzsche’s influence can be seen extensively in very different realms of twentieth-century philosophical thinking on art, from philosophical aesthetics to particular art procedures and techniques. The specific approach he endorsed concerning matters of art and aesthetics is by 1 F. -

Nietzsche on Suffering, Affirmation, and Modern Tragedy
NIETZSCHE ON SUFFERING, AFFIRMATION, AND MODERN TRAGEDY ________________________________________________________________________ A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board ________________________________________________________________________ In Partial Fulfillment of Requirements for the Degree Doctor of Philosophy ________________________________________________________________________ by Mary Kate Brennan May 2019 Examining Committee Members: Dr. Kristin Gjesdal, Advisory Chair, Philosophy Dr. Susan Feagin, Philosophy Dr. Lara Ostaric, Philosophy Dr. Andrew Huddleston, External Member, Birkbeck, University of London Dr. Paul Kottman, External Member, The New School for Social Research © Copyright 2019 Mary Kate Brennan All Rights Reserved ii ABSTRACT From the point of view of philosophy of art, tragedy is deeply perplexing: On the one hand, it depicts events that are painful, depressing, and difficult to watch. On the other, it is a genre that has been continually replicated, revered, and even enjoyed since the ancient Greeks. Writers like Aeschylus, Sophocles, Shakespeare, Ibsen, and Beckett hold a place of high regard—they are authors of important works and worthy of our attention. In contemporary aesthetics, this problem is referred to as the paradox of tragedy. This, though, is not a new problem. Instead, philosophers since Aristotle have asked why we, the human species, create, seek out, contemplate, and take pleasure in tragedy. In my dissertation, I examine Nietzsche’s response to this problem in The Birth of Tragedy. His answer is as simple as it is subtle: tragedy is valuable because it allows us to affirm life. In his 1872 work, Nietzsche argues that tragedy was born out of the ancient Greek’s need to affirm life in the face of suffering. However, he is not entirely clear how, exactly, this affirmation is supposed to work. -

Nietzsche on Art
Nietzsche on Art Selections from Later Writings In Nietzsche’s later writings we continue to see the theme of the importance of art. Though no longer presented in the terms of The Birth of Tragedy, Nietzsche continues to stress the healing capacity of art through the creation of beautiful illusions without which we could not live (what in The Birth of Tragedy was called the Apollinian art drive). Nietzsche will continue to refer to the Dionysian in many important passages in his very last writings, though what Nietzsche means by the Dionysian here is perhaps best understood not as what he characterized as Dionysian in The Birth of Tragedy but rather as the product of that miraculous coupling of Apollinian and Dionysian drives in the earlier text. In other words, the Dionysian in the later Nietzsche, Edvard Munch, 1906 writings seems to refer to what he regarded as the highest aim of art revealed in Greek tragedy—that transfiguration or metamorphosis in the artist which enables one to affirm life despite its tragic character. Thus Spoke Zarathustra, Nietzsche’s literary-philosophical masterpiece, is introduced (in the preceding work The Gay Science) as a tragedy. As the work does not have the classical form of a tragedy, it seems what Nietzsche must have meant in referring to it as a tragedy is that in it the author sought to achieve what he had identified as the highest aim of tragedy. The main theme of Thus Spoke Zarathustra is Zarathustra’s teaching concerning the overhuman (Übermensch), a teaching which concerns the further evolution or transfiguration of humanity. -

Nietzsche on Realism in Art and the Role of Illusions in Life-Affirmation." Thesis, Georgia State University, 2017
Georgia State University ScholarWorks @ Georgia State University Philosophy Theses Department of Philosophy 12-11-2017 Nietzsche on Realism in Art and the Role of Illusions in Life- Affirmation Marie K. Le Blevennec Georgia State University Follow this and additional works at: https://scholarworks.gsu.edu/philosophy_theses Recommended Citation Le Blevennec, Marie K., "Nietzsche on Realism in Art and the Role of Illusions in Life-Affirmation." Thesis, Georgia State University, 2017. https://scholarworks.gsu.edu/philosophy_theses/222 This Thesis is brought to you for free and open access by the Department of Philosophy at ScholarWorks @ Georgia State University. It has been accepted for inclusion in Philosophy Theses by an authorized administrator of ScholarWorks @ Georgia State University. For more information, please contact [email protected]. NIETZSCHE ON REALISM IN ART AND THE ROLE OF ILLUSIONS IN LIFE- AFFIRMATION by MARIE KERGUELEN LE BLEVENNEC Under the Direction of Jessica Berry, PhD ABSTRACT In this paper, I investigate Nietzsche’s views about realism in art, and use the resulting textual evidence to explain the connection between realism, health and life-affirmation. First, I show that Nietzsche’s contrasting claims about artists like Flaubert and Stendhal reflect a distinction between two types of realism: the unhealthy realism of Flaubert, and the healthy realism of Stendhal. I then use this understanding of healthy realism in art to argue that for Nietzsche, healthy realism is vital for life-affirmation. Finally, I apply this evidence to a debate between Daniel Came and Bernard Reginster concerning whether Nietzsche thinks life- affirmation requires falsifying reality using illusions, especially artistic illusions, for the purpose of masking life’s terrible truths. -

Nietzsche Und Wagner
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2008 Wagner und Nietzsche – oder: die Aussen- und die Innenseite grosser Politik Marti, Urs Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-7263 Book Section Published Version The following work is licensed under a Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. Originally published at: Marti, Urs (2008). Wagner und Nietzsche – oder: die Aussen- und die Innenseite grosser Politik. In: Enno, R; Wildermuth, A. Nietzsche und Wagner. Geschichte und Aktualität eines Kulturkonfliktes. Zürich: Orell Füssli Verlag, 51-74. Kultur – Philosophie – Geschichte Reihe des Kulturwissenschaftlichen Instituts Luzern Print-Version herausgegeben von Aram Mattioli und Enno Rudolph Open-Access-Version herausgegeben von Enno Rudolph unter Mitarbeit von Tobias Brücker Band 5 Nietzsche und Wagner herausgegeben von Armin Wildermuth Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Weitere Informationen unter http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de e-book 2016 Nietzsche und Wagner Herausgegeben von Armin Wildermuth Kultur – Philosophie – Geschichte Reihe des Kulturwissenschaftlichen Instituts Luzern Herausgegeben von Aram Mattioli und Enno Rudolph Band 5 Nietzsche und Wagner Geschichte und Aktualität eines Kulturkonfl ikts © 2008 Orell Füssli Verlag AG, Zürich www.ofv.ch Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Dadurch begründete Rechte, insbesondere der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf andern Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugs- weiser Verwertung, vorbehalten. -

Is It Here That Time Becomes Space? Hegel, Schopenhauer, History and Grace in Parsifal
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Royal Holloway - Pure The Wagner Journal, 3, 3, 29–59 Is it Here that Time becomes Space? Hegel, Schopenhauer, History and Grace in Parsifal Mark Berry Richard Wagner’s final drama, Parsifal, has generally been understood to represent the culmination of an ideological line very different from that of his earlier works, with the exception of Tristan und Isolde and possibly the later sections of Der Ring des Nibelungen. The revolutionary of the Dresden barricades in 1849 has finally sold out to the quietism of Schopenhauer and/or to Christianity – or, which amounts to the same thing, he has at last cast off the folly of his radical youthful flirtations. Thus Roger Scruton posits a ‘transformation of the Ring story, from Young Hegelian beginnings to a quasi-Christian or at any rate Schopenhauerian end’, in which ‘we witness a process of growing up in Wagner for which there is no equivalent in Marx’. Mention of Marx is far from inciden- tal, since Wagner is thereby achieving an emancipation from Hegel such as Marx never does. The Ring, Scruton startlingly claims, is therefore ‘not about power or money or even love; it is about original sin’.1 This nicely sets the scene for the less ambiguously Christian milieu and message of Parsifal.2 Nietzsche was more hostile: for what would a seriously intended Parsifal mean? Must one really see in it (as some- body has expressed it against me) ‘the abortion […] of a hatred of knowledge, spirit, and sensuality’? A curse upon senses and spirit in a single hatred and breath? An apos- tasy and reversion to sickly Christian and obscurantist ideals? And in the end even self-abnegation, self-striking-himself-out on the part of an artist who had previously striven with all of his will’s might to achieve the opposite, the highest spiritualisation and sensualisation in his art? […] One should remember how enthusiastically Wagner followed in the footsteps of the philosopher Feuerbach. -

The Complete Works of Friedrich Nietzsche
THE COMPLETE WORKS OF FRIEDRICH NIETZSCHE First Complete and Authorised English 'Iranslation in Eighteen Volumes EDITED BY DR OSCAR LEVY VOLUME EIGHT THE CASE OF WAGNER Downloaded from https://www.holybooks.com Of the First Edition of One 'Thousand Five Hundrea Copies this is No ...... .6.6.6 ... Downloaded from https://www.holybooks.com FRIEDRICH NIETZSCHE = I THE CASE OF WAGNER II NIETZSCHE CONTRA w AGNER III SELECTED APHORISMS TRANSLATED BY ANTHONY M. LUDOVICI THIRD EDITION IV WE PHILOLOGISTS TRANSLATED BY J. M. KENNEDY NEW YORK THE MACMILLAN COMPANY ,. Downloaded from https://www.holybooks.com ALL RIGHTS' RESERVED Printed at THE DARIEN PRESS, Edinburgh. Downloaded from https://www.holybooks.com CONTENTS l'AGE TRANSLATOR'S PREFACE IX TRANSLATOR'S PREFACE TO THIRD EDITION xvii AUTHOR'S PREFACE xxix THE CASE OF WAGNER NI.ETZSCHE CONTRA WAGNER 53 SELECTED APHORISMS 83 TRANSLATOR'S PREFACE TO "WE PHILOLOGISTS" IO 5 WE PHILOLOGISTS 109 Downloaded from https://www.holybooks.com Downloaded from https://www.holybooks.com TRANSLATOR'S PREFACE. NIETZSCHE wrote the rough draft of" The Case of Wagn~r '' in Turin, during the month of May 1888; he completed it in Sils Maria towards the end of June of the same year, and it was published in the following autumn. "Nietzsche contra Wagner" was written about the middle of December 1888; but, although it was printed and corrected before the New Year, it was not published until long afterwards owing to Nietzsche's complete breakdown in the first days of 1889. In reading these two essays we are apt to be deceived, by their virulent and forcible tone, into believing that the whole matter is a mere cover for hidden fire,-a mere blind of cesthetic discussion concealing a deep and implacable personal feud which demands and will have vengeance. -

Forget Not the Whip! Nietzsche, Perspectivism, and Feminism: a Non-Apologist Interpretation of Nietzsche's Polemical Axiology
University of Kentucky UKnowledge Theses and Dissertations--Philosophy Philosophy 2016 Forget Not the Whip! Nietzsche, Perspectivism, and Feminism: A Non-Apologist Interpretation of Nietzsche’s Polemical Axiology Jennifer L. Hudgens University of Kentucky, [email protected] Digital Object Identifier: https://doi.org/10.13023/ETD.2016.503 Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Hudgens, Jennifer L., "Forget Not the Whip! Nietzsche, Perspectivism, and Feminism: A Non-Apologist Interpretation of Nietzsche’s Polemical Axiology" (2016). Theses and Dissertations--Philosophy. 14. https://uknowledge.uky.edu/philosophy_etds/14 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by the Philosophy at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations--Philosophy by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. STUDENT AGREEMENT: I represent that my thesis or dissertation and abstract are my original work. Proper attribution has been given to all outside sources. I understand that I am solely responsible for obtaining any needed copyright permissions. I have obtained needed written permission statement(s) from the owner(s) of each third-party copyrighted matter to be included in my work, allowing electronic distribution (if such use is not permitted by the fair use doctrine) which will be submitted to UKnowledge as Additional File. I hereby grant to The University of Kentucky and its agents the irrevocable, non-exclusive, and royalty-free license to archive and make accessible my work in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known. -

Nietzsche and the Nazis Antipodes Or Ideological Kin?: Articulating Chasms and Connections
University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 1999 Nietzsche and the Nazis antipodes or ideological kin?: Articulating chasms and connections Mathew M. Stevenson The University of Montana Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Stevenson, Mathew M., "Nietzsche and the Nazis antipodes or ideological kin?: Articulating chasms and connections" (1999). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 5589. https://scholarworks.umt.edu/etd/5589 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. Maureen and Mike MANSFIELD LIBRARY The University ofMONTANA Permission is granted by the author to reproduce this material in its entirety, provided that this material is used for scholarly purposes and is properly cited in published works and reports. ** Please check "Yes" or "No" and provide signature ** Yes, I grant permission __ No, I do not grant permission ____ Author's Signature Date Y , *Z<30C)_______________ Any copying for commercial purposes or financial gain may be undertaken only with the author's explicit consent. Nietzsche and the Nazis, Antipodes or Ideological Kin?: Articulating Chasms and Connections by Mathew M. Stevenson B.A. The University of Montana, 1996 presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts The University of Montana 1999 Approved by: Chairperson Dean, Graduate School t-S'-oo Date UMI Number: EP41053 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted.