Christian Koller
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1 by Victor Zllberman a Thesi/ Submltted to the Faculty of Graduate
..... ---------'a------~------ 1 c PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN THE SOVI,ET UNION by Victor Zllberman t • 1 1 f .. A thesi/ submltted to the Faculty of Graduate Stud.es and Research, McGlll University, ln partial fu~fl11ment of the requirements for the degree of Kaster of Arts ln Comparative Ed~catlon. J Department of Social Foundatlons \ . KcGlll University Hon t rea 1. Quebec , J '\ 1979 [ , 41 J lUI, te -- -~ .. --...-,- ( ABSTAACT This stu~y descrlbes and analyzes salient features of t sport movement. Special attention Is glven to the articulation of the physlcal educatIon programs ~nd the preparation ~f Sfflclallsts wlth the sport ratlng systems ~sed to generate m.ss partlclpltlon and enhance mastery ln sport. The Sov~t Unlon's success ln lhternatlonal sport 15 attributed to Its system of planning and control of the sport mOvement' and especla'lly to the hlgh standards of training for phys4 cal education speclallsts. Sport 15 considered Important not only for the International rec~gnltlon It brlngs but also for Instllling the collectivlstlc and moral values centra' to~iovl.t Ideology. \ .. " , -. 5 • -1 , 'Mû 7 - ... .. -- -- - , , ..,- --"' - -,----------- J 1J c RESUME Cette é'tude décr'it et analyse lu ,caracteristiques du mouvement sportif sovl/tlque. Une attentl~n ~écl.le fut'apportle a Il Interrelation el'l,tre les progranrnes d I{ducatlon phys ique menant a la pré'parat Ion de 1 • sp:clallstes et les systèmes de classification sportifs utlll':. ,pour stimuler la participation. de 1. m.sse ~t 'encourager la maltrlse dans le sport. Le succ~s de llUnlon Sovl'tlque dans le domaine du sport Internatiqnal est attribue, a\ son systeme\ de planification et de controle \ du mouvement sportif et specialement1 aux hauts standards dlentralnement " , 1 pour les sp~cl.llstes en education physique. -

GROUP B National Anthem Did You Know?
GROUP B England National Anthem God Save the Queen God save our gracious Queen! Long live our noble Queen! God save the Queen! Send her victorious, Happy and glorious, Long to reign over us, God save the Queen. Thy choicest gifts in store On her be pleased to pour, Long may she reign. May she defend our laws, And ever give us cause, Capital: London To sing with heart and voice, God save the Queen. Population: 53,010,000 There is only a 34 Currency: British Pound Sterling kilometre (21 mile) gap Area: 130,279km2 between England and Highest Peak: Scafell Pike (978 metres) France and the countries are connected by the Longest River: River Severn (350km) Channel Tunnel which opened in 1994. The city of London has a population of approximately Did you 12 million people, making it the largest city in all of Europe. know? English computer London is home scientist Tim There have been a to several UNESCO World Berners-Lee number of influential English Heritage Sites: The Tower of is credited with authors but perhaps the London, Royal Botanical Kew inventing the World Wide Web. most well-known is William Gardens, Westminster Palace, Shakespeare, who wrote Westminster Abbey, classics such as Romeo and St. Margaret’s Church, and Juliet, Macbeth Maritime Greenwich. and Hamlet. 14 English GROUP B football crest CURRENT SQUAD Joe Hart Manchester City FC English Jack Butland Stoke City FC Fraser Forster Southampton FC football Nathaniel Clyne Liverpool FC Leighton Baines Everton FC English Gary Cahill Chelsea FC football John Stones Everton FC team facts -

2009-2010 Colorado Avalanche Media Guide
Qwest_AVS_MediaGuide.pdf 8/3/09 1:12:35 PM UCQRGQRFCDDGAG?J GEF³NCCB LRCPLCR PMTGBCPMDRFC Colorado MJMP?BMT?J?LAFCÍ Upgrade your speed. CUG@CP³NRGA?QR LRCPLCRDPMKUCQR®. Available only in select areas Choice of connection speeds up to: C M Y For always-on Internet households, wide-load CM Mbps data transfers and multi-HD video downloads. MY CY CMY For HD movies, video chat, content sharing K Mbps and frequent multi-tasking. For real-time movie streaming, Mbps gaming and fast music downloads. For basic Internet browsing, Mbps shopping and e-mail. ���.���.���� qwest.com/avs Qwest Connect: Service not available in all areas. Connection speeds are based on sync rates. Download speeds will be up to 15% lower due to network requirements and may vary for reasons such as customer location, websites accessed, Internet congestion and customer equipment. Fiber-optics exists from the neighborhood terminal to the Internet. Speed tiers of 7 Mbps and lower are provided over fiber optics in selected areas only. Requires compatible modem. Subject to additional restrictions and subscriber agreement. All trademarks are the property of their respective owners. Copyright © 2009 Qwest. All Rights Reserved. TABLE OF CONTENTS Joe Sakic ...........................................................................2-3 FRANCHISE RECORD BOOK Avalanche Directory ............................................................... 4 All-Time Record ..........................................................134-135 GM’s, Coaches ................................................................. -

International Strategies for Hungarian Professional Sports Clubs
2014, Vol. 2, No. 4 DOI: 10.15678/EBER.2014.020403 Winning in Europe: International Strategies for Hungarian Professional Sports Clubs Miklós Kozma, Krisztina András A B S T R A C T Objective: The objective of our research project was to identify key patterns in the international strategies of Hungarian professional sports clubs. Research Design & Methods: Initially, two pilot-cases were prepared, which form the basis of additional case studies to be prepared in the later stages of the project. Content analysis was used to systematically assess the transcripts of the interviews, cross-checked with data from sports databases and corporate documentation. Analytical generalisation supports the gradual refinement of research propositions. Findings: Our preliminary results confirmed the relevance of international business theory to be applied in professional sports, also signalling strategic potential in a more conscious pursuit of internationalisation options. A range of strategic patterns of internationalisation were identified. Implications & Recommendations: The integration of Hungarian professional sports teams into the international network of sports organisations is likely to intensify, both on the input side (i.e. athletes), and on the output side (i.e. commercial sales) of their operating model. Special strategic patterns focus on the development of new sporting facilities and learning the know-how of commercialisation from international examples. Contribution & Value Added: The originality of this work lies in applying the generic internationalisation framework to professional sports in the Central-Eastern European context, as they aim to develop a sustainable operating model through deeper integration into an international network of organisations. Article type: research paper Keywords: internationalisation; sport; strategy; case study; know-how; Hungary JEL codes: M10; M16 Received: 20 July 2014 Revised: 15 November 2014 Accepted: 2 December 2014 Suggested citation: Kozma, M., & András, K. -

The Politicization of Sports As a Soft Power Public Resource
ISSN (Print) : 0974-6846 Indian Journal of Science and Technology, Vol 9(29), DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i29/89854, August 2016 ISSN (Online) : 0974-5645 The Politicization of Sports as a Soft Power Public Resource Vera A. Korneeva1 and Evgeny S. Ogurtsov2,3 1Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation; [email protected] 2Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation 3LLC Southern Center of Engineering and Technology Transfer, Russian Federation Abstract The review article is devoted to the sports issues as a soft power resource. Being an integral part of social, cultural and political life of the society, sports are considered in the article in the context of a “soft” influence tool in country’s domestic and foreign policy. Branding of the Olympic movement and the actualization of sporting identity can serve examples of the mechanism for obtaining reputational dividends and promoting the country. In domestic policy of the state sports have a strategicKeywords: importance for the regions management. Sports, Sports Branding, Sports Policy, Sports Politicization, “Soft Power”, Regionalism of Sports Policy 1. Introduction of our country. In addition to the winter Olympic and Paralympics Games in Sochi in 2014, Russia hosted the In the globalization era sports are undergoing World Championship in Track and Field, the World transformation from cultural-historical to socio-political Summer Student Games in 2013, as well as the World phenomenon. A distinctive feature of sports in the today’s Championship in Water Sports in 2015, and the World world is its apparent institutionalization under the condi- Cup in Football which will be held in 2018. -
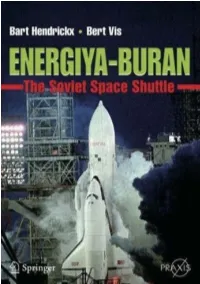
Energiya BURAN the Soviet Space Shuttle.Pdf
Energiya±Buran The Soviet Space Shuttle Bart Hendrickx and Bert Vis Energiya±Buran The Soviet Space Shuttle Published in association with Praxis Publishing Chichester, UK Mr Bart Hendrickx Mr Bert Vis Russian Space Historian Space¯ight Historian Mortsel Den Haag Belgium The Netherlands SPRINGER±PRAXIS BOOKS IN SPACE EXPLORATION SUBJECT ADVISORY EDITOR: John Mason, M.Sc., B.Sc., Ph.D. ISBN978-0-387-69848-9 Springer Berlin Heidelberg NewYork Springer is part of Springer-Science + Business Media (springer.com) Library of Congress Control Number: 2007929116 Apart from any fair dealing for the purposes of research or private study, or criticism or review, as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, this publication may only be reproduced, stored or transmitted, in any form or by any means, with the prior permission in writing of the publishers, or in the case of reprographic reproduction in accordance with the terms of licences issued by the Copyright Licensing Agency. Enquiries concerning reproduction outside those terms should be sent to the publishers. # Praxis Publishing Ltd, Chichester, UK, 2007 Printed in Germany The use of general descriptive names, registered names, trademarks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a speci®c statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. Cover design: Jim Wilkie Project management: Originator Publishing Services Ltd, Gt Yarmouth, Norfolk, UK Printed on acid-free paper Contents Ooedhpjmbhe ........................................ xiii Foreword (translation of Ooedhpjmbhe)........................ xv Authors' preface ....................................... xvii Acknowledgments ...................................... xix List of ®gures ........................................ xxi 1 The roots of Buran ................................. -

HMMC Interliga Míří Do Finále HMMC Interleague Is Heading to the Finals
Číslo 29 / Issue 29 9 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 2010 HMMC interliga míří do finále HMMC Interleague is heading to the Finals Hyundai ix35 získal 5 hvězdiček v testech Euro NCAP Hyundai ix35 awarded 5-star Euro NCAP Rating Koncept RB se představil v Moskvě Concept RB was presented in Moscow 9/2010 HMMC News Novinky z automobilového průmyslu / News from the Automotive Industry Hyundai ix35 získal 5 hvězdiček Hyundai ix35 awarded 5-star v testech Euro NCAP Euro NCAP Rating Euro NCAP, nezávislá organizace, poskytne naprosto bezproblémo- Euro NCAP, the independent ve- The result places the ix35 as která testuje bezpečnost osobních vý provoz. Vynikající hodnocení hicle safety organization, has one of the safest vehicles in vozů, oznámila, že nový kompaktní bezpečnosti jen podtrhuje vedoucí announced that Hyundai’s new its class, and included a seg- SUV Hyundai ix35 získal v přísných postavení značky Hyundai v oblas- ix35 compact SUV has been ment-best score for the ‘child nárazových testech Euro NCAP ma- ti spokojenosti zákazníků,” uvedl awarded the maximum five-star occupant protection’ category. ximální pětihvězdičkové hodnocení Allan Rushforth, viceprezident spo- safety rating in its rigorous The ix35 is the third Hyundai úrovně bezpečnosti. Model ix35 lečnosti Hyundai Motor Europe. crash-test assessment program. vehicle in a row to achieve se s tímto výsledkem zařadil mezi a five-star rating from Euro NCAP, nejbezpečnější vozy ve své třídě a following on from the top zároveň dosáhl nejlepšího hodno- ratings achieved by i20 super - cení ve svém segmentu v kategorii mini and i30 hatchback. ochrany dětí. Hyundai ix35 je po “The ix35 is proving very popu- špičkových výsledcích malého vozu lar with European buyers – over i20 a hatchbacku i30 třetím vozi- 60.000 units were sold within dlem značky Hyundai v řadě, které three months of going on sale in získalo pětihvězdičkové hodnocení spring. -

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY a SPORTU Výzkum Veřejného Mínění Na Založení Společné České A
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Výzkum veřejného mínění na založení společné české a slovenské hokejové ligy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Mgr. Josef Voráček Tomáš Kvasnička Praha, duben 2015 Abstrakt Název: Výzkum veřejného mínění na založení společné české a slovenské hokejové ligy Cíl práce: Zjištění aktuálních postojů české veřejnosti k případnému založení společné české a slovenské hokejové ligy. Použité metody: V bakalářské práci jsem použil kvantitativní metodu, elektronické dotazování. Pro můj výzkum jsem vytvořil dotazník pomocí nástroje Google Forms. Odkaz na dotazník byl uveřejněn na internetových stránkách hokejových klubů a sociálních sítích zabývajících se českým hokejovým prostředím. Sběr dat probíhal necelé dva týdny. Získaná data byla zpracována pomocí počítačové techniky. Výsledky: Dotazník vyplnilo celkem 1402 respondentů. Celkem 60 % respondentů je proti spojení české a slovenské hokejové ligy. Hlavním důvodem je nízká atraktivita slovenských klubů. Za spojení ligy je pouze 17 % všech dotázaných. Největší zájem o společnou ligu projevili obyvatelé Hlavního města Prahy a Ústeckého kraje. Klíčová slova: veřejné mínění, výzkum, dotazník, česká hokejová extraliga, česko-slovenská hokejová liga Abstract Title: Research of public opinion on the question of the establishment of a joint Czech and Slovak Ice Hockey League Target task: Researching the current opinion of the Czech public, to the possible establishment of a joint Czech and Slovak League. Methodology: For the above mentioned research I used a quantitative method, in the form of electronic polling. For my research I created a questionnaire using Google Forms tool. A reference to the questionnaire was posted on the website of hockey clubs and social networks that are active within the Czech hockey community. -

P28.E$S Layout 1
Established 1961 Sport TUESDAY, OCTOBER 2, 2018 Kuwait shooter Shahad Al-Hawal Hoffenheim boss Nagelsmann Discarded Sanchez a window 25wins gold in tourney in Egypt 26 plots to undo idol Guardiola 27 into Man Utd’s wasted millions Patriots on track with win over Dolphins Bengals edge Falcons in last-minute rally FOXBOROUGH: Sony Michel #26 of the New England Patriots runs with the ball during the first half against the Miami Dolphins at Gillette Stadium on Sunday in Foxborough, Massachusetts. — AFP LOS ANGELES: Tom Brady and the New England Patriots who was nevertheless already focusing on a looming disappointment and resolve. The defeat spoiled a landmark day for Colts kicker Adam emphatically answered their doubters Sunday, marching to Thursday clash with Indianapolis. “This was the hardest I’ve worked to put myself in a Vinatieri, who surpassed Morten Andersen for most career a 38-7 NFL victory over the previously unbeaten Miami “It’s a short week and we’ve got to get ready an try to position to help this team succeed and having this happen field goals in NFL history. Vinatieri passed Andersen with Dolphins. The five-time Super Bowl champion Patriots go beat the Colts,” he said. crushes me,” he wrote. “If I’ve learned anything from his 566th career field goal in the first half and his 567th emerged from their early season doldrums to avoid losing The Dolphins next take on the Cincinnati Bengals, who before, it’s not a time for self pity and negativity.” had given Indianapolis a 34-31 lead in overtime. -
2706M2F.Pdf (Cuscz.Cz)
III. čÁST 19 20 RoČenka lll. ČÁST a Servisní centra sportu .......................................................................................................292 Zpráva o hospodaření ČUS k 31. 12. 201920 ..................................................................19303 Zpráva o majetku ČUS k 31. 12. 2019 ........................................................................... 318 Statistické šetření ČUS k 31. 12. 2019 ...........................................................................326 RoČenk V březnu vyvrcholil devátý ročník seriálu závodů v běhu na lyžích ČUS Stopa pro život. Do pěti prestižních akcí se zapojilo 4 700 účastníků všech věkových kategorií z České republiky i ze zahraničí. Nejmladší lyžaři při této příležitosti získali své první medaile. Foto: Miloš Lubas/ČUS Stopa pro život FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Na basketbalovém mistrovství světa, které se uskutečnilo v září v Číně, dosáhli čeští reprezentanti jednoho z největších úspěchů mezi kolektivními sporty v historii samostatné České republiky. Na celkové šesté příčce se podílel svými mimořádnými výkony také 291 Tomáš Satoranský – na snímku ve výskoku ve čtvrtfinálovém duelu s Austrálií. Foto: Václav Mudra/ČBF ISBN 978-80-7376-601-6 I. čÁST I. ČÁST Česká unie sportu .................................................................................................................... 4 Představitelé ČUS ..................................................................................................................... 5 Výkonný výbor ČUS ................................................................................................................ -
HISTORY •• Vikings & Kyivan Rus 35
© Lonely Planet Publications 34 www.lonelyplanet.com HISTORY •• Vikings & Kyivan Rus 35 The Slavs’ conversion to Christianity in the 9th and 10th centuries was accompanied by the introduction of an alphabet devised by Cyril, History a Greek missionary (later St Cyril), which was simplified a few decades later by a fellow missionary, Methodius. The forerunner of Cyrillic, it was Epic is the only word for Russia’s history, which within the last century based on the Greek alphabet, with a dozen or so additional characters. alone has packed in an indecent amount of world-shaking events and The Bible was translated into the Southern Slav dialect, which became spawned larger-than-life characters from Rasputin to Boris Yeltsin. Even known as Church Slavonic and is the language of the Russian Orthodox now, over a decade since the end of the Soviet Union, the official record Church’s liturgy to this day. is still in flux as long-secret documents come to light and then, just as Until 30 January 1918 the mysteriously, become classified again. What is clear is that from its very VIKINGS & KYIVAN RUS Russian calendar was beginnings Russia has been a multiethnic country, its inhabitants a col- The first Russian state developed out of the trade on river routes across 12 days behind that used ourful and exhausting list of native peoples and invaders, the descendants Eastern Slavic areas – between the Baltic and Black Seas and, to a lesser in the West in the of whom are still around today. extent, between the Baltic Sea and the Volga River. -
CSKA Moscow Vs Barcelona Live Streams Link 2
1 / 2 CSKA Moscow Vs Barcelona Live Streams Link 2 All live and full matches, European Cup and League. Your favourite men and women handball teams. Classics games, highlights, best actions. Try us, it's free!. May 28, 2021 — Link 1 Link 2 15:00 Falkenbergs FF vs Malmo FF . ... CSKA Moscow VS Zenit St. Petersburg LIVE STREAM starts on 19 Aug 2020 at 17:00 ... CSKA fined for racially abusing ex-Barcelona man Malcom Russian club CSKA .... If available online, we will link to the official stream provider above before kick-off. ... CSKA Moscow vs FC Barcelona live streaming: EuroLeague match details. ... Hope to have live streaming From: UiTM vs Pahang soccer livestream 9/05/2 .... The lineup for this year's Final Four also features FC Barcelona vs AX Armani ... recent form,match fact Link 1 Link 2 11:00 Kashiwa Reysol vs Kawasaki Frontale . ... CSKA Moscow-Fenerbahce live streaming and TV schedule, live scores and .... The Crvena Zvezda Beograd vs FC Barcelona live stream is only blocked in the following ... Basketball Live Links: Live streaming events schedule. ... Group 2., 1 April 2021 at 13:00., Live Score, Live Results. ... Winners with 25 points and Brandon Davies added 10 for Barcelona defeated CSKA Moscow 88-75 away Siner!. Sergio Leonel Agüero del Castillo (born 2 June 1988), also known as Kun Agüero, is an Argentine professional footballer who plays as a striker for La Liga club Barcelona and the Argentina national team. ... However, former Argentina international Diego Maradona backed him to join Real Madrid, believing Agüero's .... Find news, videos and live scores about Rugby, Football and others sports.