D Artikel Sture Ureland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
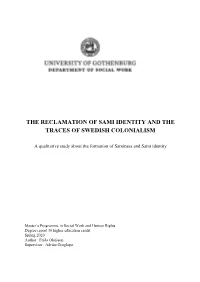
The Reclamation of Sami Identity and the Traces of Swedish Colonialism
THE RECLAMATION OF SAMI IDENTITY AND THE TRACES OF SWEDISH COLONIALISM A qualitative study about the formation of Saminess and Sami identity Master’s Programme in Social Work and Human Rights Degree report 30 higher education credit Spring 2020 Author : Frida Olofsson Supervisor : Adrián Groglopo Abstract Title: The Reclamation of Sami identity and the traces of Swedish colonialism : A qualitative study about the formation of Saminess and Sami identity Author: Frida Olofsson Key words (ENG): Sami identity, Saminess, Sami people, Indigenous People, identity Nyckelord (SWE): Samisk identitet, Samiskhet, Samer, Urfolk, Identitet The purpose of this study was to study identity formation among Sami people. The aim was therefore to investigate how Saminess and Sami identity is formed and specifically the way the Sami community transfers the identity. Semi structured interviews were conducted and the material was analyzed by the use of a thematic analysis. In the analysis of the material, four main themes were : Transfer of Sami heritage over generations, Sami identity, Expressions about being Sami and Sami attributes. The theoretical framework consisted of Postcolonial theory and theoretical concepts of identity. The main findings showed that the traces of colonialism is still present in the identity-formation of the Sami people and that there is a strong silence-culture related to the experiences of colonial events which consequently also have affected the intergenerational transfer of Saminess and Sami identity. Furthermore, the will to reclaim the Sami identity, heritage and the importance of a sense of belonging is strongly expressed by the participants. This can in turn be seen as a crucial step for the decolonization process of the Sami population as a whole. -

Connections Between Sámi and Basque Peoples
Connections between Sámi and Basque Peoples Kent Randell 2012 Siidastallan Outside of Minneapolis, Minneapolis Kent Randell (c) 2012 --- 2012 Siidastallan, Linwood Township, Minnesota Kent Randell (c) 2012 --- 2012 Siidastallan, Linwood Township, Minnesota “D----- it Jim, I’m a librarian and an armchair anthropologist??” Kent Randell (c) 2012 --- 2012 Siidastallan, Linwood Township, Minnesota Connections between Sámi and Basque Peoples Hard evidence: - mtDNA - Uniqueness of language Other things may be surprising…. or not. It is fun to imagine other connections, understanding it is not scientific Kent Randell (c) 2012 --- 2012 Siidastallan, Linwood Township, Minnesota Documentary: Suddenly Sámi by Norway’s Ellen-Astri Lundby She receives her mtDNA test, and express surprise when her results state that she is connected to Spain. This also surprised me, and spurned my interest….. Then I ended up living in Boise, Idaho, the city with the largest concentration of Basque outside of Basque Country Kent Randell (c) 2012 --- 2012 Siidastallan, Linwood Township, Minnesota What is mtDNA genealogy? The DNA of the Mitochondria in your cells. Cell energy, cell growth, cell signaling, etc. mtDNA – At Conception • The Egg cell Mitochondria’s DNA remains the same after conception. • Male does not contribute to the mtDNA • Therefore Mitochondrial mtDNA is the same as one’s mother. Kent Randell (c) 2012 --- 2012 Siidastallan, Linwood Township, Minnesota Kent Randell (c) 2012 --- 2012 Siidastallan, Linwood Township, Minnesota Kent Randell (c) 2012 --- 2012 Siidastallan, Linwood Township, Minnesota Four generation mtDNA line Sisters – Mother – Maternal Grandmother – Great-grandmother Jennie Mary Karjalainen b. Kent21 Randell March (c) 2012 1886, --- 2012 Siidastallan,parents from Kuusamo, Finland Linwood Township, Minnesota Isaac Abramson and Jennie Karjalainen wedding picture Isaac is from Northern Norway, Kvaen father and Saami mother from Haetta Kent Randell (c) 2012 --- 2012 Siidastallan, village. -

Consonant Gradation in Estonian and Sámi: Two-Level Solution TROND TROSTERUD and HELI UIBO
14 Consonant Gradation in Estonian and Sámi: Two-Level Solution TROND TROSTERUD AND HELI UIBO 14.1 Introduction Koskenniemi’s two-level morphology was the first practical general model in the history of computational linguistics for the analysis of morphologi- cally complex languages. In this article we will reconsider one of the key innovations in Koskenniemi (1983), namely the treatment of consonant gra- dation in finite state transducers. We will look not at Finnish, but at two lan- guages with a more extensive consonant gradation system, namely Estonian and Sámi. The goal of the paper is to demonstrate two different ways of mod- eling consonant gradation in a finite state morphological system - lexical and morphophonological. We will also compare the resulting systems by their computational complexity and human-readability. Consonant gradation is rare among the languages of the world, but stem al- ternation in itself is not, and the treatment of consonant gradation can readily be transferred to other stem alternation phenomena. Koskenniemi’s original idea was to see stem alternation as an agglutinative phenomenon. Consider the example (14.1), showing a two-level representation of stem alternation. ehT e$:ehe (14.1) Here the $ sign is a quasi-suffix, introduced to trigger consonant grada- tion in the stem. Two-level rules decide the correspondence of T to surface phonemes t or 0 (empty symbol), based on the context, specifically, according to the presence or absence of the symbol $ in the right context. Another type of rules for handling stem alternations that can be compiled Inquiries into Words, Constraints and Contexts. -

Sami in Finland and Sweden
A baseline study of socio-economic effects of Northland Resources ore establishment in northern Sweden and Finland Indigenous peoples and rights Stefan Ekenberg Luleå University of Technology Department of Human Work Sciences 2008 Universitetstryckeriet, Luleå A baseline study of socio-economic effects of Northland Resources ore establishment in northern Sweden and Finland Indigenous peoples and rights Stefan Ekenberg Department of Human Work Sciences Luleå University of Technology 1 Summary The Sami is considered to be one people with a common homeland, Sápmi, but divided into four national states, Finland, Norway, Russia and Sweden. The indigenous rights therefore differ in each country. Finlands Sami policy may be described as accommodative. The accommodative Sami policy has had two consequences. Firstly, it has made Sami collective issues non-political and has thus change focus from previously political mobilization to present substate administration. Secondly, the depoliticization of the Finnish Sami probably can explain the absent of overt territorial conflicts. However, this has slightly changes due the discussions on implementation of the ILO Convention No 169. Swedish Sami politics can be described by quarrel and distrust. Recently the implementation of ILO Convention No 169 has changed this description slightly and now there is a clear legal demand to consult the Sami in land use issues that may affect the Sami. The Reindeer herding is an important indigenous symbol and business for the Sami especially for the Swedish Sami. Here is the reindeer herding organized in a so called Sameby, which is an economic organisations responsible for the reindeer herding. Only Sami that have parents or grandparents who was a member of a Sameby may become members. -
![Arxiv:2004.04803V1 [Cs.CL] 9 Apr 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/8431/arxiv-2004-04803v1-cs-cl-9-apr-2020-628431.webp)
Arxiv:2004.04803V1 [Cs.CL] 9 Apr 2020
FST Morphology for the Endangered Skolt Sami Language Jack Rueter, Mika Hämäläinen Department of Digital Humanities University of Helsinki {jack.rueter, mika.hamalainen}@helsinki.fi Abstract We present advances in the development of a FST-based morphological analyzer and generator for Skolt Sami. Like other minority Uralic languages, Skolt Sami exhibits a rich morphology, on the one hand, and there is little golden standard material for it, on the other. This makes NLP approaches for its study difficult without a solid morphological analysis. The language is severely endangered and the work presented in this paper forms a part of a greater whole in its revitalization efforts. Furthermore, we intersperse our description with facilitation and description practices not well documented in the infrastructure. Currently, the analyzer covers over 30,000 Skolt Sami words in 148 inflectional paradigms and over 12 derivational forms. Keywords: Skolt Sami, endangered languages, morphology 1. Introduction members access to language materials directly. The trick is Skolt Sami is a minority language belonging to Sami to find new uses and reuses for data sets and technologies branch of the Uralic language family. With its native speak- as well as to bring development closer to the language com- ers at only around 300, it is considered a severely endan- munity. If development follows the North Sámi lead, any gered language (Moseley, 2010), which, despite its pluri- project can reap from the work already done. centric potential, is decidedly focusing on one mutual lan- Extensive work has already been done on data and tool gauge (Rueter and Hämäläinen, 2019). In this paper, we development in the GiellaLT infrastructure (Moshagen et present our open-source FST morphology for the language, al., 2013) and (Moshagen et al., 2014), and previous work 3 which is a part of the wider context of its on-going revital- also exists for Skolt Sami (Sammallahti and Mosnikoff, ization efforts. -

INDIGENOUS PEOPLES on TWO CONTINENTS Self-Determination Processes in Saami and First Nation Societies
RAUNA KUOKKANEN INDIGENOUS PEOPLES ON TWO CONTINENTS Self-Determination Processes in Saami and First Nation Societies Sometimes it can be challenging to be Jr. was not, however, satisfied with indigenous peoples is the collective a Sámi in North America. Not only this “scientific” explanation. He dimension of their existence as well as have most people never heard of the argued that “[t]he Lapps may have rights. This implies that besides com- Sámi but in many cases, we remain whiter skins than Africans, but they do monly characterized rights of individ- suspect due to our relatively “White not run around naked to absorb the uals, we have rights as distinct peo- looks.” Especially in Native North sunlight’s vitamin D. Indeed, it is the ples. In other words, indigenous peo- America (or in “Indian Country” or Africans who are often bare in the ples are not merely “groups,” “popu- “Turtle Island” as the continent is also tropical sun. The Lapps are always lations,” or even “ethnic minorities” called), Europe equals White and heavily clothed to protect themselves but peoples with inherent right to self- White equals the settler and colonizer from the cold” (Deloria 1995: 10). determination as defined in interna- —the well-known figure of “the white Though probably more correct than tional law. This is the reason why man.” Due to a common lack of knowl- Bronowski, Deloria also lapses into indigenous peoples worldwide have edge of the Sámi, it is hard for some the stereotypical belief that the Sámi demanded recognition of this collec- people to think that there really are live in a permanent winter. -

000 Euralex 2010 03 Plenary
> State of the Art of the Lexicography of European Lesser Used or Non- State Languages anne tjerk popkema ‘The people who chronicle the life of our language (…) are called lexicographers’ (Martin Hardee, blogger in Cyberspace, 2006) 0 Introductory remarks 1 Language codification and language elaboration (‘Ausbau’) are key ingredients for raising a lesser used language to a level that is adequate for modern use.2 In dictionaries (as well as in grammars) a language’s written standard may be laid down, ‘codified’. 3 At the same time dictionaries make clear what lexical gaps remain or arise in a language. The filling of such gaps – part of language elaboration – will only gain wide acceptance when, in turn, it is codified in a dictionary itself. Thus, both prime categories of language development – codification and elaboration – are hats worn by the same head: the lexicographer’s. Bo Svensén begins the opening chapter of his recent handbook on lexicography by stating that ‘dictionaries are a cultural phenomenon. It is a commonplace to say that a dictionary is a product of the culture in which it has come into being; it is less so to say that it plays an important part in the development of that culture.’ 4 In the case of lesser used languages, language development may lead to (increased) use in domains that were formerly out of reach because of the dominance – for any number of reasons – of another language. In such instances, language development equals language emancipation. An emancipating language takes on new functions, enters new domains of society and is therefore in need of new terminology. -

Sixth Periodical Report Presented to the Secretary General of the Council of Europe in Accordance with Article 15 of the Charter
Strasbourg, 1 July 2014 MIN-LANG (2014) PR7 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES Sixth periodical report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter NORWAY THE EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES SIXTH PERIODICAL REPORT NORWAY Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation 2014 1 Contents Part I ........................................................................................................................................... 3 Foreword ................................................................................................................................ 3 Users of regional or minority languages ................................................................................ 5 Policy, legislation and practice – changes .............................................................................. 6 Recommendations of the Committee of Ministers – measures for following up the recommendations ................................................................................................................... 9 Part II ........................................................................................................................................ 14 Part II of the Charter – Overview of measures taken to apply Article 7 of the Charter to the regional or minority languages recognised by the State ...................................................... 14 Article 7 –Information on each language and measures to implement -

The Ethnic Identity of the Sami People
Bachelor thesis The ethnic identity of the Sami people A study about the perception of Samis’ ethnic identity Author: Ludvig Malmquist Supervisor: Lennart Wohlgemuth Examiner: Manuela Nilsson Term: HT20 Subject: Peace and development studies Level: Bachelor Course code: 2FU33E Abstract The purpose of this thesis is to analyze perceptions about the Sami ethnic identity. In order to analyze the topic, this thesis is using a qualitative method. It seeks to answer the research questions “how do the Sami perceive they can live and express their ethnic identity?” and “how are the Sami people´s ethnic identity being portrayed by others”?. The conclusions were reached through studying language and to be more specific, a discourse analysis using various academic papers and from newspaper articles. The analysis is based on a broad analytical framework which consists of stigma by Goffman, Ethnicity by Olsson, Ålund and Johansson and ethnic identity three stage model development by Phinney. These theories and concepts were chosen since they are the most suitable theories in order to analyze the objective. The findings were broken down into four different topics, the topics are “reindeer herding”, “relationship with each other and other indigenous groups”, “climate change” and “Sami identity”. The results suggest that Sami people are proud of their identity and that they can express their identity, even though there are perceptions about that they live in a colonial system. The results also suggest that non-Sami people very often perceive the Sami ethnicity in a negative way. The results correspond to stigma and ethnicity and mostly regarding ethnic identity development. -

Fifth Periodical Report Presented to the Secretary General of the Council of Europe in Accordance with Article 15 of the Charter
Strasbourg, 17 November 2017 MIN-LANG (2017) PR 7 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES Fifth periodical report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter FINLAND THE FIFTH PERIODIC REPORT BY THE GOVERNMENT OF FINLAND ON THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES NOVEMBER 2017 2 CONTENTS INTRODUCTION...................................................................................................................................................6 PART I .................................................................................................................................................................7 1. BASIC INFORMATION ON FINNISH POPULATION AND LANGUAGES....................................................................7 1.1. Finnish population according to mother tongue..........................................................................................7 1.2. Administration of population data ..............................................................................................................9 2. SPECIAL STATUS OF THE ÅLAND ISLANDS.............................................................................................................9 3. NUMBER OF SPEAKERS OF REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES IN FINLAND.................................................10 3.1. The numbers of persons speaking a regional or minority language..........................................................10 3.2. Swedish ......................................................................................................................................................10 -

Archaeology and the Debate on the Transition from Reindeer Hunting to Pastoralism Ingrid Sommerseth Dept
NOR’s 16th Nordic Conference on Reindeer and Reindeer Husbandry Research Tromsø, Norway, 16th-18th November 2010 Archaeology and the debate on the transition from reindeer hunting to pastoralism Ingrid Sommerseth Dept. of Archaeology and Social Anthropology, Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, University of Tromsø, N-9037 Tromsø, Norway ([email protected]). Abstract: The distinctive Sami historical land use concerning reindeer management and settlement of inner Troms, North Norway, is reflected in places with archaeological remains. The insight and knowledge connected with these places can be accessed through oral traditions and place-names where reindeer management is embedded in reindeer knowledge developed over long time spans. Previous distinctions between wild reindeer hunting and pastoral herding can be redefined, since much of the traditional knowledge concerning the wild reindeer (goddi) may have been trans- ferred to the domesticated animals (boazu). The transition from reindeer hunting to pastoralism is a current research focus and archaeological results from inner Troms indicate that several Sami dwellings with árran (hearths) are related to a transitional period from AD 1300 to 1400. This period is marked by a reorganisation of the inland Sami siida (col- lective communities), and changes in landscape use wherein seasonal cycles and grazing access began to determine the movements of people and their domestic reindeer herds. This reorganisation was a response to both external political relations and the inner dynamic of the Sami communities. The first use of tamed reindeer was as decoys and draft animals in the hunting economy, only later becoming the mainstay of household food supply in reindeer pastoralism, providing insurance for future uncertainties. -

Ethics in Indigenous Research
SAMI DUTKAN. SAMISKA STUDIER. SAMI STUDIES. SAMI STUDIER. SAMISKA DUTKAN. SAMI SAMI DUTKAN. SAMISKA STUDIER. SAMI STUDIES. Vaartoe – Centre for Sami Research Umeå University Ethics in research related to Indigenous peoples has, over recent decades, been increasingly discussed in a global context. Decolo- nizing theories and methods have gained legitimacy and prestige, and Indigenous scholarship has challenged mainstream research by adding novel perspectives and critical standpoints that encourage researchers of all origins to reflect upon their own positions within Anna-Lill Drugge (ed.) the colonial academic and social structures in which they work. This development has taken different directions and occurred at diffe- rent speeds depending on local, regional and national settings. In a Ethics in Indigenous Research Swedish Sami research context, we are now in a time when it is clear that things are moving and discussions on research ethics are taking Past Experiences - Future Challenges place on a more regular basis. This publication is one example of that. In Sweden, it is the first one in English that addresses ethics in Sami and Indigenous research and this will, hopefully, facilitate collabora- Anna-Lill Drugge (ed.) tions, comparisons and discussions on an international scale. The book is based on some of the contributions to the international workshop Ethics in Indigenous Research, Past Experiences – Future Challenges that was held in Umeå in March 2014. The workshop gathered together around fifty scholars from different parts of Sápmi and abroad, and aimed to move forward Indigenous research ethics in Sweden by highlighting and addressing research ethics related to the Sami and Indigenous research field.