Verlag Huber & Co. Aktiengesellschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Diffusion Du Ski En Suisse Jusqu'à L'entre-Deux-Guerres
La diffusion du ski en Suisse jusqu'à l'entre- deux-guerres Autor(en): Busset, Thomas Objekttyp: Article Zeitschrift: Traverse : Zeitschrift für Geschichte = Revue d'histoire Band (Jahr): 23 (2016) Heft 1: Masse, Märkte und Macht in der Geschichte des Sports = Masse, marchés et pouvoir dans l'histoire du sport PDF erstellt am: 04.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-650806 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch La diffusion du ski en Suisse jusqu'à l'entre-deux-guerres Thomas Busset Si elle n'a guère suscité l'attention du monde académique, la diffusion du ski en Suisse n'en est pas moins bien documentée grâce aux nombreuses chroniques et monographies qui lui sont consacrées. -

Curlers1 Supplement WENGEN CURLING
I PALACE HOTEL • WENGEN 1 § § Leading in the Jungfrau region.— A first-class Hotel with personal atmosphere. Write for this winter's SPECIAL ALL-INCLUSIVE TERMS during JANUARY FRITZ BORTER and FAMILY Same proprietors :— VILLA MAGLIASINA- Magliaso § The delightful, small first-class Hotel on the Golf Course of Lugano § Page One su-m 0»*£i# ^ round EIGERGLETSCHER KLEINE SCHEIDEGG LAUBERHORN • MANNLICHEN WENGEN THANKS TO THE FAVOURABLE SEASON AND SPECIAL TICKETS Ask for the NEW SKI-ING GUIDE BY CHR. RUBI, WENGEN obtainable from Head Office, Interlaken, against one International Reply Coupon. WENOERNALP + JUNGFRAU RAILWAYS Page Two INTERLAKEN-SWITZERLAND rts vnmei* Spo In the Winter Sports Shop at Harrods you'll find the best of everything you need for your trip to the snowy slopes. Ski expert Lotti Smith is here to help you choose your kit and set you on the right track for the most successful winter holiday yet. HARRODS LTD LONDON SWI Page Three illllll!!llll!l!lli:H[llllllllllllllllllllllll!!liii!l[l!!li[l!!:illlllllllllllllllll]!l!!ii!UIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllltillilBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHEp GORDON LOWES RENDEZVOUS for SKIERS Make our friendly shop your half-way house to the Snows, where expert advice for seniors and juniors on Clothes and Equipment is always available. Among special features are the Head and Kurz Ski, latest Elastic Vorlages, after-Ski wear, Italian boots and Hiring Scheme. Send your Ski early for relacquering, new bindings, edges, etc. Write for our popular Catalogue " TO THE SNOWS" Prompt Mail Order Service 21-23, Brompton Arcade Knightsbridge, London S.W.3 =g Norwegian Fisherman's Sweater in oiled wool Phone: KENsington 4494/5/6 Cables Gorlowe: London §| 3 45/-. -

Alpine Notes
ALPINE NOTES ' He was not only brave, he was cool, determined and resourceful wqen action was needed, as I have seen on more than one occasion that called for all these qualities. Nothing daunted or confused him. He dashed at a fire or rushed in search of an incident, after a bomb had fallen, with incredible speed. 'Fanshawe had served with this Post since before the beginning of the war, and was Senior Warden until he moved to another area only a few days before his death. He was not on duty when the raid started, but he rushed out to a fire in an adjoining area and was killed instantly by a heavy bomb which destroyed the burning building. I know he died as I have seen him on many occasions putting every ounce of his strength and skill into his voluntary task. ' He is a great loss to our work. He has made that greatest of all contributions to the cause of freedom and decency. I know his example of high heroism and devotion will not be wasted. And for himself and I like to think of that side to which he paid no regard he has reached the heights towards \vhich we all climb.' • ALPINE NOTES Year of THE ALPINE CLUB OBITUARY: Election. Pilkington, L. • • • • • • 1878 • Harrison, H. E. B. • • • • • 1890 Worthington, A. H. • • • • • 1894 Williamson, 0. K. • • • • • I895 Goggs, F. S. • • • • • • 1906 Macartney, H. J. • • • • • 1911 Clark, Professor A. J. • • • • • 1923 , Fanshawe, R. A. • • • • • 1929 Sussdorf, Louis, jun. • • • • • 1934 MEMBERS SERVING WITH His MAJESTY's ARMED FoRcEs. -

Mythos Eiger Zusammengestellt Von Marco Bomio
Mythos Eiger Zusammengestellt von Marco Bomio Zusammengestellt von Marco Bomio, 3818 Grindelwald Inhaltsverzeichnis 1 Der Mythos ..................................................................................................................... 1 1.1 Wie der Mythos Eiger entstand ............................................................................... 1 2 Der Berg ......................................................................................................................... 2 2.1 Versuche, den Namen zu deuten ............................................................................ 2 4 Die Chronik .................................................................................................................... 3 5 Die Erstbegehungen vom Eiger ...................................................................................... 4 6 Literatur .......................................................................................................................... 5 7 Kontaktieren Sie uns ...................................................................................................... 5 22.02.2013 I 1 Der Mythos «Wenn die Wand zu machen ist, machen wir sie – oder bleiben drin!» Diese Aussage von Edi Rainer und Willy Angerer 1936 über die Eiger Nordwand bewahrheitete sich für die beiden – sie blieben drin. Aus dem Erstbesteigungsversuch der Eiger Nordwand im Sommer 1936 wurde das wohl bekannteste Drama der Eiger Nordwand. Gemeinsam mit Andreas Hinterstoisser und Toni Kurz aus Deutschland kamen die beiden Österreicher -

Fell and Rock Climbing Club of the ENGLISH LAKE DISTRICT VOL
THE Fell and Rock Climbing Club OF THE ENGLISH LAKE DISTRICT VOL. 8. 1980. No. 8. LIST OF OFFICERS. President: G. BASTERFIELD Vice-Presidents: G. S. BOWER G. A. SOLLY Honorary Editor of Journal: MRS. R. S. T. CHORLEY, The Rookery, Stanmore, Middlesex. Assistant Hon. Editor: GRAHAM WILSON, High Bield, Loose, Maidstone. from whom the journal may be obtained. Honorary Librarian: Miss M. M. CAIN, Rosebank House, Ramsbottom, nr. Manchester. Honorary Secretary: J. C. APPLEYARD, Greystones, Torver, Coniston, Lanes. Honorary Treasurer: W. G. MILLIGAN, 59 Croslands Park, Barrow. Trustees of Club Funds: A. P. ABRAHAM, F. L. COOK and G. A. SOLLY Members of Committee: P. D. BOOTHROYD G. G. MACPHEE T. R. BURNETT L. H. POLLITT MRS. B. EDEN-SMITH L. W. SOMERVELL Miss M. FITZGIBBON A W. WAKEFIELD A. T. HARGREAVES Miss K. WARD D. LEIGHTON E. WOOD-JOHNSON Honorary Members: GEORGE D. ABRAHAM BRIG.-GEN. THE HON. C. G. BRUCE BENTLEY BEETHAM J. NORMAN COLLIE W. P. HASKETT-SMITH GEOFFREY HASTINGS THB RT. HON. LORD LECONFIELD LT.-COL. E. F. NORTON N. E. ODELL E. H. P. SCANTLEBURY GODFREY A. SOLLY T. HOWARD SOMERVELL ARTHUR W. WAKEFIBLD L. R. WILBERFORCE GEOFFREY WINTHROP YOUNG ■-*<*& Photo by R C. Waktfield LITTLE PETERMANN AND PETERMANN PEAK, SEEN FROM THE E. PETERMANN PEAK 275 attention more than anything else, and that was a monstrous pyramid of ice to the west, rising about 4,850 feet above a high mountain ridge. This glorious peak could bear none other name than that of Petermann, the honoured originator of the first German Arctic Expedition." With only a rough sketch made in 1926 among the Cambridge Peaks from which to decide a route, we were on our way up to the first proposed camp by 5 p.m. -

Alpine Notes
ALPINE NOTES ALPINE NOTES Year of Election. THE ALPINE CLUB OBITUARY : Hartley, G. W. 0 • • • • 0 188r Pole, Mark • 0 • • • • • 1893 M orland, J. C. • • • • • 0 1906 Worthington, W. B. • • • • • 1907 Patterson, J. D. • • • • • • 1911 Rudolf, M. E. S. • • • • • • 1923 Overton, M. R. C. • • • • • 1932 A DEBT OF GRATITUDE. We believe that all our members will desire to express their gratitude to our Assistant Secretary, and also to our caretakers Mr. and Mrs. Mitchell, who have faithfully and gallantly carried out their duties at the Club premises during these very trying days and thus maintained this essential part in the life of the Alpine Club. PAINTING BY E. T. CoMPTON. We acknowledge with gratitude the gift of a water-colour drawing by E. T. Compton, presented to the Club by Herr Stephan von Kuffner in memory of his father Herr Moriz von Kuffner, depicting the Presanella from the Vedretta di Lares. HoNOURS. We congratulate Mr. L. S. Amery on his appointment as His Majesty's Secretary of State for India; Lt.-General Sir R. C. Wilson, K.C.M.G., on his appointment as A.D.C. General to His Majesty the King; and Mr. G. Seligman on the award of the Back Grant by the Royal Geographical Society, in honour of his glacier research work in the region of the Jungfraujoch. EnwARD WHYMPER CENTENARY. The centenary of Edward Whymper's birth has been celebrated at Chamonix, where prayers were said at his tomb, on which wreaths were deposited by the Alpine Club and the Ski Club of Great Britain, the French Alpine Club, the municipality of Chamonix, and Alpine. -

TWO NOTABLE OBERLANDERS. O. A. Haster
• • • • TWO NOTABLE OBERLANDERS • • Crepe rubber boots are the best footwear. Knees and elbows should be covered by closely woven m[Jterial which will not catch. The extra weight of a small water flask would be well justified. At least six hours should be allowed for the climb and return to the bivouac. • TWO NOTABLE OBERLANDERS BY G. A. -HASLER • 1. CHRISTIAN JOSSI, SOHN HRISTIAN Jossi was born in I 872, seventy years old this year as he reminded me the other day. He received his Guide's book in I892, but he certainly did some porter's job with his great father before then. I know that he· was with Christen and Dr. ,Burckhardt of Basel in I 890 on a traverse of Klein Fiescherhorn from Schwarzegg to Bergli, and with his father and myself on an ascent of Schreckhorn on April 22, I 89 I. It must have been a big job to live up to his father's reputation, but. there is no question that although the son of a famous father always • has a hard row to hoe, Christian J ossi has made a distinctive reputation • for himself. From the first entry in his book where, with his father and Peter Schlegel, he assisted I4 members of the Sektion Bern S.A.C., headed by the late Dr. I5i.ibi, in an ascent of the Mettenberg (July 3, I 892) to the end of it, there passes in front of our eyes a marvellous kaleidoscope of well known names and widespread districts. I should say there is no district in the Alps where he has not done good work and much work. -

Alpine Notes
ALPINE NOTES ALPINE NOTES Year of THE ALPINE CLUB OBITUARY : Election. Howard, G. E. • • • • • 1907 Roger-Smith, H. R. • • • • I9IO Gates, Caleb F., Jr. • • • • • I928 Hey, Wilson H. • • • • • I929 Hobday, S. R. • • • • • • I933 Sarpy, A. U. • • • • • • I936 ALPINE JouRNAL. Index to Vols. 39- 58. Copies of this index are still available and may be ordered from the Assistant Secretary, Alpine Club, 74, South Audley Street, London, W. I. Price 2os. post free. Copies of the Index to Vols. I6- 38 are also available, price 2os. post free. · Back numbers of the ALPINE JOURNAL are generally extant ·: prices on application. HoNORARY MEMBERSHIP. At the Winter Dinner on December 6, I955, Sir Edwin Herbert announced, amid applause, that His Royal . Highness the Duke of Edinburgh had graciously accepted Honorary Membership of the Alpine Club. We are glad to announce, also, that Dr. G. M. Trevelyan, former Master of Trinity, has been elected an Honorary Member of the Club. ScHALLIHORN : FIRST AscENT FROM THE ScHALLIJOCH. E. A. Broome with Alois and Heinrich Pollinger claimed to have made the first ascent of the North ridge of the Schallihorn in 1903, 1 but was later told by George Y eld that the ridge had been once previously climbed, • though no particulars of this expedition were ever given. 2 It would be of interest to know if any information is available about this supposed earlier ascent. G. Winthrop Young was under the impression that his party was making the first ascent of the ridge in I 907, 3 but this was not · so, though the matter of Broome's priority is still undecided. -
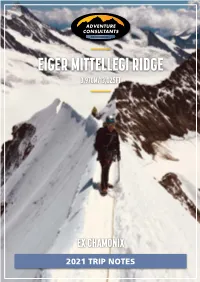
Eiger Guided Ascent Mittellegi Ridge Ex Chamonix 2021
EIGER MITTELLEGI RIDGE 3,970M/13,025FT EX CHAMONIX 2021 TRIP NOTES EIGER MITTELLEGI RIDGE TRIP NOTES 2021 TRIP DETAILS Dates: Available on demand from July to September Duration: 6 days Departure: ex Chamonix, France Price: €5,300 1:1 guide to climber ratio Climbers reach the false summit of the Eiger. Photo: Paul Palanca The Eiger is a dramatic mountain steeped in a colourful history, not because of its first ascent via the West Flank in 1858, but more-so because of the attempts to climb its formidable Nordwand (North Face) in the 1930s that saw prospective ascensionists perish. We climb the Eiger by the long and exposed Mittellegi Ridge, the East Ridge of the mountain overlooking the famous North Face. The first few days of the programme involve warming up on some classic peaks around Chamonix and then in the Oberland close to the Eiger. These ascents are very good for getting your mind and body prepared for the intensity of climbing a big alpine route like the Eiger’s Mittellegi Ridge. The climbing on the Mittellegi is predominantly on rock with a very exposed snow crest near the top. Initially, HISTORY you will climb in the dark but as dawn breaks you will be suitably impressed with the exposure on both sides The Eiger was first climbed via the West Flank in 1858 of the ridge! The climb stays near the ridgeline, moving by Charles Barrington, Christian Almer and Peter from side to side of the ridge, over and around towers Bohren. The first ascent of the Mittellegi Ridge was and in the steeper sections we are aided by a thick made by Fritz Amatter, Samuel Brawand, Yuko Maki hand line that is fixed in place on the mountain. -

1 Timeline of Vermont Skiing Ca. 1853: “At Some Time in His Middle Years
Timeline of Vermont Skiing New England Ski Museum In preparation for 2014 Annual Exhibit Ca. 1853: “At some time in his middle years he (Joseph Seavey Hall) built a trail up Burke Mountain, near East Burke, Vermont, and later enlarged it into a bridle path. He claimed that it was he who transformed the Crawford Path from a blazed and cairned trial into a bridle path. He built the first summit house that was anything more than an emergency shelter. He completed the Carriage Road from just above the Halfway House to the summit…In his early forties he marched through Pennsylvania with the 11 th regiment, Vermont Volunteers, and fought in the Battle of Gettysburg. …After the Civil War he went west, mined silver in Nevada, and then moved on to California, where, according to family tradition, he once more indulged his passion for building roads up mountains and houses on mountains by constructing another carriage road, this one up Mt. Diablo.” Bradford F. Swan, “Joseph Seavey Hall, White Mountain Guide,” Appalachia, Magazine number 130 (June 15, 1960), 57-58. 1860: “Mountain recreation at Burke dates back to 1860 when Lt. Joseph Seaver (sic) Hall of East Burke cut a trail to the mountain’s summit and erected a cabin there. Picnickers and hikers used the trail to climb to the mountaintop which was a popular pastime in Vermont in the late 1880s.” Karen D. Lorentz, The Great Vermont Ski Chase . (Shrewsbury, Vermont: Mountain Publishing, Inc., 2005), 54 1892: “Winter sport was organized on a permanent commercial basis under the direction of the Woodstock Inn as early as 1892, when the inn opened its doors for the first time. -

Viele Wege Führen Auf Den Eiger Mittellegigrat
Alpinismus, Berg- u. a. Sportarten torenkämpfen, wieder richtiges Schau- Alpinismo e altri sport spiel um Leben und Tod geboten wird. di montagna «Eiger live» eben. Und wo Publikum, da auch Darsteller. Nach wie vor übt Alpinisme et autres sports diese Wand eine grosse Anziehungskraft de montagne auf jeden ambitionierten Bergsteiger aus. Man muss «sie» einfach gemacht haben. Heute ist die Heckmairroute natürlich längst nicht mehr die bergsteigerische Viermal Eiger: einfach bis schwer Herausforderung, die sie vor 70 Jahren war. Trotzdem, auch wenn der Spitzen- bergsteiger Ueli Steck die Route in Viele Wege führen auf 2:47:33 Std. durchrannt hat, ist sie im- den Eiger mer noch eine ernsthafte Tour. Dass, im Verhältnis zur Anzahl Begehungen, viel Der Eiger und seine Nordwand: Für weniger Bergsteiger in dieser Wand ums den Berufsfotografen und Bergführer Leben kommen als in früheren Jahren, Robert Bösch stellt Letztere eine rie- hat vor allem einen Grund: Verunfallte sige Bühne dar. Bösch zeigt aber oder stecken gebliebene Seilschaften auch anhand von Bildern aus vier werden heute dank Helikopter und rou- verschiedenen Routen, dass der tinierten Rettungsleuten meist rechtzei- Berg noch mehr bietet1. tig aus der Wand geholt. Dass gewisse Bergsteiger damit kalkulieren, ist eine Wer Eiger sagt, meint Eigernordwand – eher penible Tatsache. die grösste Schaubühne der Welt, in der, Der Eiger bietet aber eine weit grössere 2000 Jahre nach den römischen Gladia- Palette als «nur» die weltberühmte Route Einer Himmelsleiter gleich schwingt durch die Spinne. Neben einigen Dut- sich der Mittellegigrat zum Eiger- 1 Sein Buch Schweiz Alpin. Die schönsten Touren zend weiteren kombinierten Routen gipfel auf. -

IN Melvioriam
IN MEMORIAM • IN MElVIORIAM GEORGE EDWARD MANNERING r862-1947 GEORGE EowARD MANNERING died in Christchurch, New Zealand, on October 29, 1947, in his eighty-sixth year. He was elected to the Alpine Club in 1891, and made Honorary Member in 1935. In r8gr he wrote his book u rith Axe and Rope in the New Zealand Alps, and in 1943 his book Eighty Years in New Zealand was published. He was one of the founders in r8gr of the New Zealand Alpine Club, was the first editor of its Journal, Secretary in 1895, President in 1932-34 and was made an Honorary Member in 1935. He was born in New Zealand, the son of Theophilus Samuel Mannering, who had come from England in 1852. In 1876 the family visited Britain and Mannering was a pupil at King's College, Taunton. Before returning to New Zealand at the end of 1877 he visited the Continent, and from Geneva had his first view of the Swiss Alps. Always fond of the open air life, although he followed the calling of a banker, he became interested in the mountains of his native country. The visit to New Zealand of the Rev. W. S. Green with his Swiss guides in 1882, and his attempt to climb Mt. Cook, attracted Manner ing's attention, and although he had, up to that time, been climbing only the front hills and lower peaks in different parts of the Southern Alps, he determined to attempt the ascent of this, the highest mountain in New Zealand. In the years from early in 1886 to 1890 he made five attempts on Mt.