Annuß Elfriede Jelinek – Theater Des Nachlebens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diplomarbeit
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Polyphone Sprachkompositionen: Elfriede Jelineks Hörspiele als Radiokunst“ Verfasser Christoph Kepplinger angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im September 2007 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A332 Studienrichtung lt. Studienblatt: Deutsche Philologie Betreuerin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Pia Janke Inhalt 1. EINLEITUNG..............................................................................................................................................2 2. DIE REALISIERUNG DER TEXTE ALS HÖRSPIEL...........................................................................5 2.1. VON DEN FRÜHEN HÖRSPIELEN ZU DEN THEATERTEXT-BEARBEITUNGEN .........................................5 2.2. PERFORMANCE, POP UND MULTIMEDIA ...............................................................................................9 2.3. DER MEDIALE WANDEL UND DIE RE-POSITIONIERUNG DER AUTORIN..............................................12 3. PARTITUREN FÜR DEN RUNDFUNK .................................................................................................20 3.1. SCHREIB- UND BEARBEITUNGSVERFAHREN FÜR HÖRBARE TEXTE ...................................................20 3.2. VON DER GESCHRIEBENEN ZUR KLINGENDEN SPRACHE....................................................................24 3.3. DAS SCHWEIGEN – VOX FEMINARUM...................................................................................................31 3.4. POLYPHONE STIMMEN-KOMPOSITION ...............................................................................................33 -

A QUIET EVENING of DANCE by WILLIAM FORSYTHE Pääyhteistyökumppanit / Partners / Partners Sponsorit / Sponsors / Sponsorer Thu–Fri 22.–23.8
©Bill Cooper #juhlaviikot #helsinkifestival The visit is produced in collaboration with Jane and Aatos Erkko Foundation and Dance House Helsinki. A Sadler´s Wells London Production JANE and AATOS ERKKO FOUNDATION A QUIET EVENING OF DANCE BY WILLIAM FORSYTHE Pääyhteistyökumppanit / Partners / Partners Sponsorit / Sponsors / Sponsorer Thu–Fri 22.–23.8. Finnish National Opera and ballet, Almi Hall PRODUCTION CREDITS Dancers: Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman (understudied by Brit Rodemund in Helsinki), Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf “RubberLegz“ Yasit, Ander Zabala Composer/Music: Morton Feldman, Nature Pieces from Piano No.1. From, First Recordings (1950s) – The Turfan Ensemble, Philipp Vandré © Mode (for Epilogue) A Sadler’s Wells London Production Composer/Music: Jean‐Philippe Rameau, Hippolyte et Aricie: Ritournelle, from A Quiet Evening of Dance Une Symphonie Imaginaire, Marc Minkowski & Les Musiciens du Louvre © 2005 By William Forsythe Deutsche Grammophon GmbH, Berlin (for Seventeen/Twenty One) and Lighting Design: Tanja Rühl and William Forsythe Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf “RubberLegz” Yasit and Ander Zabala. Costume Design: Dorothee Merg and William Forsythe Co-produced with Théâtre de la Ville, Paris; Théâtre du Châtelet, Paris; Festival d’Automne Sound Design: Niels Lanz à Paris; Festival Montpellier Danse 2019; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; The Shed, New York; Onassis Cultural Centre, Athens; deSingel international arts campus, Antwerp. For Sadler’s Wells Artistic Director & Chief Executive: Alistair Spalding CBE First performed at Sadler’s Wells London on 4 October 2018. Executive Producer: Suzanne Walker Head of Producing & Touring: Bia Oliveira Winner of the FEDORA - VAN CLEEF & ARPELS Prize for Ballet 2018. -

Werke HP 12.12
DIE WELTWEITEN ÜBERSETZUNGEN VON ELFRIEDE JELINEKS WERKEN SAMT AUFFÜHRUNGSDOKUMENTATION (Stand: Dezember 2012) Verzeichnet sind nicht nur alle Übersetzungen, die durch Publikation oder Aufführungen öffentlich gemacht wurden, sondern auch unveröffentlichte Übersetzungen von Theatertexten. Aufführungen, szenische Lesungen und Hörspielbearbeitungen sind mittels Pfeilsymbol ( ) den jeweiligen Übersetzungen zugeordnet. Datum, Ort der Aufführung bzw. Lesung und RegisseurIn werden angeführt, bei Hörspielen auch Produzent und Sender. Geordnet ist die Dokumentation nach Gattungen, innerhalb dieser Gliederung nach dem Erscheinungsdatum der Originaltexte. Die Übersetzungen der einzelnen Texte sind alpha- betisch nach der Zielsprache gegliedert. Gibt es mehrere Übersetzungen eines Werkes in dieselbe Sprache, folgen diese Übersetzungen chronologisch aufeinander. Neuauflagen bzw. verschiedene Veröffentlichungen derselben Übersetzung – beispielsweise in Form einer Taschenbuchausgabe – sind ebenfalls chronologisch angeordnet. Abkürzungen Hg. HerausgeberIn DN Doppelnennung I Inszenierung LA Lizenzausgabe Ü ÜbersetzerIn SAMMELBÄNDE BULGARISCH Drami . (Dramen ). Ü: Vladko Murdarov. Sofia: Riva Verlag 2005. DN darin: Patekata. S. 7-12. (= Immer hinauf auf den Steg. Wie der Mensch auf die Bühne kommt ) Spjashtata krasavitsa. S. 13-26. (= Dornröschen ) 17.9.2007 Mladezhki teatar, Sofia, I: Veselin Dimov (gemeinsam mit Snez- hanka (= Schneewittchen ), Titel: Smartta i Momicheto (= Der Tod und das Mädchen ) Rosamunde . S. 27-46. (= Rosamunde ) Klara Sh . S. 47-118. (= Clara S.) 8.9.2005 Festival Apollonien, Sozopol, I: Dessislava Shpatova Malchanieto. S. 119-130. (= Das Schweigen ) Dzhaki. S. 131-166. (= Jackie ) Klaudia. Tjalo i zhena. S. 167-174. (= Claudia. Körper und Frau ) Vstrani. (Im Abseits). Ü: Vladko Murdarov. Sofia: Riva Verlag 2008. DN darin: Vstrani. Nobelova lekcija. S. 7-28. (= Im Abseits ) Kakvo se sluchi, sled kato Nora napusna mazha si, ili Oporite na obshtestvoto. -

Gunter E. Grimm
GUNTER E. GRIMM Faust-Opern Eine Skizze Vorblatt Publikation Erstpublikation Autor Prof. Dr. Gunter E. Grimm Universität Duisburg-Essen Fachbereich Geisteswissenschaften, Germanistik Lotharstr. 65 47057 Duisburg Emailadresse: [email protected] Homepage: <http://www.uni-duisburg-essen.de/germanistik/mitarbeiterdaten.php?pid=799> Empfohlene Zitierweise Beim Zitieren empfehlen wir hinter den Titel das Datum der Einstellung oder des letzten Updates und nach der URL-Angabe das Datum Ihres letzten Besuchs die- ser Online-Adresse anzugeben: Gunter E. Grimm: Faust Opern. Eine Skizze. In: Goethezeitportal. URL: http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/goethe/faust-musikalisch_grimm.pdf GUNTER E. GRIMM: Faust-Opern. Eine Skizze. S. 2 von 20 Gunter E. Grimm Faust-Opern Eine Skizze Das Faust-Thema stellt ein hervorragendes Beispiel dar, wie ein Stoff, der den dominanten Normen seines Entstehungszeitalters entspricht, bei seiner Wande- rung durch verschiedene Epochen sich den jeweils herrschenden mentalen Para- digmen anpasst. Dabei verändert der ursprüngliche Stoff sowohl seinen Charakter als auch seine Aussage. Schaubild der Faust-Opern Die „Historia von Dr. Faust“ von 1587 entspricht ganz dem christlichen Geist der Epoche. Doktor Faust gilt als Inbegriff eines hybriden Gelehrten, der über das dem Menschen zugestandene Maß an Gelehrsamkeit und Erkenntnis hinausstrebt und zu diesem Zweck einen Pakt mit dem Teufel abschließt. Er wollte, wie es im Volksbuch heißt, „alle Gründ am Himmel vnd Erden erforschen / dann sein Für- GUNTER E. GRIMM: Faust-Opern. Eine Skizze. S. 3 von 20 witz / Freyheit vnd Leichtfertigkeit stache vnnd reitzte jhn also / daß er auff eine zeit etliche zäuberische vocabula / figuras / characteres vnd coniurationes / damit er den Teufel vor sich möchte fordern / ins Werck zusetzen / vnd zu probiern jm fürname.”1 Die „Historia“ mit ihrem schrecklichen Ende stellte eine dezidierte Warnung an diejenigen dar, die sich frevelhaft über die Religion erhoben. -

"With His Blood He Wrote"
:LWK+LV%ORRG+H:URWH )XQFWLRQVRIWKH3DFW0RWLILQ)DXVWLDQ/LWHUDWXUH 2OH-RKDQ+ROJHUQHV Thesis for the degree of philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen 'DWHRIGHIHQFH0D\ © Copyright Ole Johan Holgernes The material in this publication is protected by copyright law. Year: 2017 Title: “With his Blood he Wrote”. Functions of the Pact Motif in Faustian Literature. Author: Ole Johan Holgernes Print: AiT Bjerch AS / University of Bergen 3 Acknowledgements I would like to thank the following for their respective roles in the creation of this doctoral dissertation: Professor Anders Kristian Strand, my supervisor, who has guided this study from its initial stages to final product with a combination of encouraging friendliness, uncompromising severity and dedicated thoroughness. Professor Emeritus Frank Baron from the University of Kansas, who encouraged me and engaged in inspiring discussion regarding his own extensive Faustbook research. Eve Rosenhaft and Helga Muellneritsch from the University of Liverpool, who have provided erudite insights on recent theories of materiality of writing, sign and indexicality. Doctor Julian Reidy from the Mann archives in Zürich, with apologies for my criticism of some of his work, for sharing his insights into the overall structure of Thomas Mann’s Doktor Faustus, and for providing me with some sources that have been valuable to my work. Professor Erik Bjerck Hagen for help with updated Ibsen research, and for organizing the research group “History, Reception, Rhetoric”, which has provided a platform for presentations of works in progress. Professor Lars Sætre for his role in organizing the research school TBLR, for arranging a master class during the final phase of my work, and for friendly words of encouragement. -

Faust: Ein Bildungsdrama Florian Breitkopf Washington University in St
Washington University in St. Louis Washington University Open Scholarship All Theses and Dissertations (ETDs) 1-1-2011 Faust: Ein Bildungsdrama Florian Breitkopf Washington University in St. Louis Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/etd Recommended Citation Breitkopf, Florian, "Faust: Ein Bildungsdrama" (2011). All Theses and Dissertations (ETDs). 460. https://openscholarship.wustl.edu/etd/460 This Thesis is brought to you for free and open access by Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in All Theses and Dissertations (ETDs) by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. WASHINGTON UNIVERSITY Department of Germanic Languages & Literatures FAUST: EIN BILDUNGSDRAMA DER BILDUNGSDISKURS DER GOETHEZEIT UND SEINE LITERARISCHE REFLEKTION IN JOHANN WOLFGANG GOETHES FAUST by Florian Dominik Breitkopf A thesis presented to the Graduate School of Arts and Sciences of Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts May 2011 Saint Louis, Missouri copyright by Florian Dominik Breitkopf 2011 Meinem Vater, Helmut Anton Breitkopf. Gliederung 1. Einleitung und Zielsetzung............................................................................................1 2. Der Bildungsbegriff .....................................................................................................10 2.1. Einführung. Das Bildungsprojekt der Goethezeit .................................................10 -
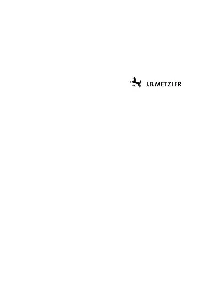
Jelinek- Handbuch
Pia Janke (Hrsg.) Jelinek- unter Mitarbeit von Christian Schenkermayr und Agnes Zenker Handbuch Verlag J. B. Metzler Stuttgart · Weimar Forschungsplattform Elfriede Jelinek | Universität Wien | Institut für Germanistik Bibliografische Information der Deutschen National bibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-476-02367-4 ISBN 978-3-476-05270-4 (eBook) DOI 10.1007/978-3-476-05270-4 Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. © 2013 Springer-Verlag GmbH Deutschland Ursprünglich erschienen bei J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 2013 www.metzlerverlag.de [email protected] V Inhalt Einleitung . VII Die Ausgesperrten (Dagmar C. G. Lorenz) . 89 Hinweise für die Benutzung . X Die Klavierspielerin Siglenverzeichnis . XI (Alexandra Tacke) . 95 Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr; Lust; Gier I. Leben und Öffentlichkeit . 1 (Rita Svandrlik) . 102 Die Kinder der Toten Biographische Aspekte und (Sabine Treude) . 113 künstlerische Kontexte Neid (Uta Degner) . 2 (Daniela Strigl). 119 Politisches und feministisches Kurzprosa Engagement (Fatima Naqvi). 125 (Pia Janke, Stefanie Kaplan) . 9 Theatertexte. 131 Selbstpräsentation Was geschah, nachdem Nora ihren Mann (Peter Clar) . 21 verlassen hatte oder Stützen der Gesell - Publikationsformen und schaften; Clara S.; Krankheit oder Werküberlieferung Moderne Frauen (Pia Janke, Teresa Kovacs). 27 (Dagmar von Hoff). 131 Burgtheater; Erlkönigin; Präsident Abend- II. Schreibverfahren . 35 wind; Ich liebe Österreich; Das Lebewohl (Evelyn Deutsch-Schreiner) . -
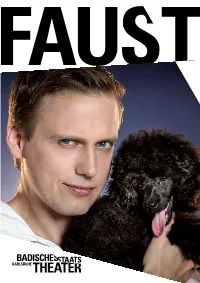
Programmheft Nr
FAUST 1 WERD ICH ZUM AUGENBLICKE SAGEN: VERWEILE DOCH! DU BIST SO SCHON! DANN MAGST DU MICH IN FESSELN SCHLAGEN, DANN WILL ICH GERN ZUGRUNDE GEHN! FAUST Der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang Goethe Faust JANNEK PETRI Mephistopheles HEISAM ABBAS Margarete KIM SCHNITZER Marthe Schwerdtlein LISA SCHLEGEL Valentin LUIS QUINTANA Wagner / Gretchens Mutter SVEN DANIEL BÜHLER Der Herr / Die Hexe / Lieschen MEIK VAN SEVEREN Faust 2-6 / Erdgeist / Bürger / Gesellen in ENSEMBLE Auerbachs Keller / Meerkatzen / Hexen in Walpurgisnacht Regie MICHAEL TALKE Bühne BARBARA STEINER Kostüme INGE MEDERT Musik JOHANNES MITTL Licht CHRISTOPH PÖSCHKO Dramaturgie ROLAND MARZINOWSKI Theaterpädagogik BENEDICT KÖMPF PREMIERE 28.9.17 KLEINES HAUS Aufführungsdauer 2 Stunden, keine Pause Regieassistenz SARAH STEINFELDER Bühnenbildassistenz ANNE HORNY Kostümas- sistenz ADÈLE LAVILLAUROY Soufflage HANS-PETER SCHENCK Inspizienz JULIKA VAN DEN BUSCH Regiehospitanz SANDER LYBEER, PAULINA ROSALIE MÜLLER Bühnenbild- hospitanz LEILA HASSAN POUR ALMANI Technische Direktion HARALD FASSLRINNER, RALF HASLINGER Bühne Kleines Haus HENDRIK BRÜGGEMANN, MORITZ HAUPTVOGEL, EDGAR LUGMAIR Leiter der Be- leuchtungsabteilung STEFAN WOINKE Leiter der Tonabteilung STEFAN RAEBEL Ton JAN FUCHS, DIETER SCHMIDT Leiterin der Requisite MEGAN ROLLER Requisite CLEMENS WIDMANN Werkstättenleiter GUIDO SCHNEITZ Konstrukteur EDUARD MOSER Malsaal- vorstand GIUSEPPE VIVA Leiter der Theaterplastiker LADISLAUS ZABAN Schreinerei ROUVEN BITSCH Schlosserei MARIO WEIMAR Polster- und Dekoabteilung UTE WIEN- -

Reviewed Scott Dissertation Final
MURDEROUS MOTHERS: FEMINIST VIOLENCE IN GERMAN LITERATURE AND FILM (1970-2000) Claire E. Scott A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill and Duke University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Carolina-Duke Graduate Program in German Studies. Chapel Hill 2017 Approved by: Kata Gellen Stefani Engelstein Richard Langston Priscilla Layne Inga Pollmann ©2017 Claire E. Scott ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Claire E. Scott: Murderous Mothers: Feminist Violence in German Literature and Film (1970-2000) (Under the direction of Kata Gellen) This dissertation analyzes literary and filmic representations of violent mothers from late 20th-century Germany. It employs feminist theories of language and theories of the voice and the body in film to enhance close readings of texts in which female protagonists defy gendered expectations by perpetrating acts of aggression. Through an interplay between thematic violence and the transgression of aesthetic conventions, these works generate an imaginary of feminist violence that advances feminist politics. Highlighting this dynamic reveals female bodies and voices as important sites for working through both past and contemporary violence in the German context. In addition, this work has broader theoretical significance as an intermediary between feminist theories of language and materialist feminist theories. Instead of strategies for emancipation, these texts generate female subjectivities that are engaged, not in assertions of individuality, but in collective and collaborative storytelling practices. The first chapter considers Dea Loher’s Manhattan Medea (1999) and Christa Wolf’s Medea. Stimmen (1996). Both of these texts use the story of Medea to come to terms with a historical context in which the voices of outsiders are excluded. -

HELLERAU Magazin #2 – 2019
HELLERAU Magazin #2 – 2019 1 Editorial Liebe Besucher*innen und Freund*innen schichte zurückreicht: der Fall der Ber- von HELLERAU, liner Mauer 1989 und das Ende des Sozia- 2 Festival Appia Stage Reloaded lismus. Auch hier geht es immer wieder Texte und Interviews: Claudia Märzendorfer, HELLERAU startet mit dem Festival „Appia um einen neuen Blick auf die Ereignisse Ursula Sax, subject to_change Stage Reloaded“ in die Saison 2019/20. Die vor und nach 1989, die in den künstleri- Rekonstruktion der berühmten Experimen- schen Formaten insbesondere biografi- 10 Kreatur talbühne des Bühnenbildners Adolphe sche Geschichten ins Zentrum rücken. Sasha Waltz & Guests Appia und des Lichtkünstlers Alexander von HELLERAU arbeitet mit vielen freien Ensem- Salzmann bezieht sich auf eine Zeitenwende bles der Genre Musik, Theater, Tanz, Perfor- 11 Caída Del Cielo vor mehr als 100 Jahren, auf die Entstehung mance sowie in interdisziplinären Formen Rocío Molina der Moderne. HELLERAU hat in dieser Zeit zusammen. Jede der Künstler*innen und maßgeblich mitgespielt – als Gartenstadt, Companys entwickeln regional und interna- 12 Powerhouse mit den Deutschen Werkstätten Hellerau, tional Projekte, in denen das Publikum ganz Planningtorock mit seinem Festspielhaus, das die europäi- unterschiedlich beteiligt wird. Wir erleben sche Avantgarde anlockte, aber auch als immer wieder, wie neugierig Künstler*innen 13 Porträtkonzert kulturelle Bildungsanstalt mit dem selbstge- und Besucher*innen aufeinander zugehen. Aribert Reimann steckten Ziel, eine neue musikalisch-rhyth- Viele Kunstformate können sich heutzutage mische Schule zu entwickeln. ohne die aktive Beteiligung des Publikums 14 Festival 89/19 – Vorher/Nachher Wie weit zurück geht zeitgenössische gar nicht entwickeln – eine neue Qualität, die Texte und Interviews: Carsten „Erobique“ Meyer, Kunst, wie relevant ist sie für die Gegen- auf der künstlerischen Ebene einen Zustand Paul Pötsch, Lea Connert, wart und welche Impulse kann sie für die der Gesellschaft spiegelt. -

EINE COMIC-ADAPTION VON GOETHES DRAMA Ilaria MELONI
BAIG VII, febbraio 2014 FAUST DER TAXIFAHRER: EINE COMIC-ADAPTION VON GOETHES DRAMA Ilaria MELONI (Cagliari) 1. Einleitung Der Faust-Mythos, der seinen Ursprung in der historischen Figur des Zauberers Georg (Johann) Faust hat,1 ist weiterhin »unerschöpflich«, wie Hans Blumenberg in seiner Arbeit am Mythos betont.2 Dies zeigt sich über die Jahrhunderte hinweg nicht nur in den bereits berühmten literarischen Bearbeitungen, in den zahlreichen Bühnendarstellungen (von Marlowe und Goethe bis Thomas Mann, von Gounod bis Murnau, Sokurov und Strehler), sondern auch in den gegenwärtigen einzigartigen Auslegungen, wie jene von Ste- fano Ricci und Giovanni Forte (Serie: Wunderkammer Soap #2_faust, 2011), in der Faust in unsere multimediale Epoche versetzt ist und mit dem Teuflischen durch Fernsehen, Com- puter und Internet in Berührung kommt.3 Darüber hinaus bietet das legendäre Teufelsbündnis und vor allem Goethes Faust starken Anreiz für Comicautoren, wie Monika Schmitz-Emans in ihrem Buch Literatur- Comics. Adaptationen und Transformationen der Weltliteratur (2012, 296ff.) zeigt. Hier geht sie un- ter anderem auf die verschiedenen Transpositionen des Zeichners Osamu Tezuka ein, der der Tradition und dem Zeichenstil des Mangas entsprechend den populären Faust-Stoff »auf inhaltlich wie stilistisch sehr unterschiedliche Weisen«4 nacherzählt. Überdies befasst sich Schmitz-Emans mit der Faust-Bearbeitung von Christian Schieckel (1991), einer ge- zeichneten Theateraufführung von Goethes-Drama, die zeichnerisch »an Holzschnitte der Dürerzeit« erinnert,5 -

Goethe's Urfaust and the Enlightenment
Goethe’s Urfaust and the Enlightenment: Gottsched, Welling and the “Turn to Magic” By Copyright 2014 James Michael Landes Submitted to the graduate degree program in Germanic Languages and Literatures and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. ________________________________ Chairperson Professor Leonie Marx ________________________________ Co-Chairperson Professor Frank Baron ________________________________ Professor Maria Carlson ________________________________ Professor William Keel ________________________________ Professor Per Øhrgaard Date Defended: 10 March 2014 The Dissertation Committee for James Michael Landes certifies that this is the approved version of the following dissertation: Goethe’s Urfaust and the Enlightenment: Gottsched, Welling and the “Turn to Magic” ________________________________ Chairperson Professor Leonie Marx ________________________________ Co-Chairperson Professor Frank Baron Date approved: 10 March 2014 ii Abstract The Urfaust, composed in the early 1770s, is the first draft of Johann Wolfgang von Goethe’s (1749-1832) masterpiece, Faust, Teil I (1808). While this early draft is relatively unexamined in its own right, an examination of this work in the context of its original creation offers insights into Goethe’s creative processes at the time in relation to the Enlightenment poetic debates of the eighteenth century, through which literary critics, such as J.C. Gottsched (1700-1766) attempted to define the rules by which poetic construction should operate. In examining the Urfaust, one can see how Goethe’s poetic aims transcended those of the Enlightenment debate, going far beyond the Enlightenment critics of Gottsched, such as J.J. Bodmer (1698-1783) and J.J. Breitinger (1701-1776) in making the case for additional room for the fantastic in poetic construction.