Aserbaidschan – Ressourcen | Konflikt(E) | Transformationen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Semi Annual Report April 2008
FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES SEMI ANNUAL REPORT APRIL 2008 FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES SEMI ANNUAL REPORT APRIL 2008 TABLE OF CONTENTS Federation of Euro-Asian Stock Exchanges 3 Deutsche Boerse 10 Garanti Asset Management 13 Is Investment 14 NASDAQ OMX 16 Tayburn Kurumsal 18 Finans Asset Management 20 Quartal FLife 21 Stock Exchange Profiles Abu Dhabi Securities Market 24 Amman Stock Exchange 28 Armenian Stock Exchange 32 Bahrain Stock Exchange 36 Baku Interbank Currency Exchange 40 Baku Stock Exchange 44 Banja Luka Stock Exchange 46 Belarusian Currency and Stock Exchange 50 Belgrade Stock Exchange 54 Bucharest Stock Exchange 58 Bulgarian Stock Exchange 62 Cairo and Alexandria Stock Exchanges 66 Georgian Stock Exchange 70 Iraq Stock Exchange 74 Istanbul Stock Exchange 78 Karachi Stock Exchange 82 Kazakhstan Stock Exchange 86 Kyrgyz Stock Exchange 90 Lahore Stock Exchange 94 Macedonian Stock Exchange 96 Moldovan Stock Exchange 100 Mongolian Stock Exchange 104 Montenegro Stock Exchange 108 Muscat Securities Market 112 Palestine Securities Exchange 116 Sarajevo Stock Exchange 120 State Commodity & Raw Materials Exchange of Turkmenistan 122 Tehran Stock Exchange 126 Tirana Stock Exchange 130 “Toshkent” Republican Stock Exchange 134 Ukrainian Stock Exchange 138 Zagreb Stock Exchange 142 Affiliate Member Profiles CDA Central Depository of Armenia 147 Central Registry Agency Inc. of Turkey 148 Central Securities Depository of Iran 149 Macedonian Central Securities Depository 150 Misr For Clearing, Settlement & Central Depository 151 Securities Depository Center (SDC) of Jordan 152 Takasbank - ISE Settlement and Custody Bank, Inc. 153 Tehran Securities Exchange Technology Management Company (TSETMC) 154 Member List 155 FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES (FEAS) The Federation of Euro-Asian Stock Exchanges Semi Annual Report April 2008 is published by the Federation of Euro-Asian Stock I.M.K.B Building, Emirgan 34467 Istanbul, Turkey Exchanges. -

Post-Show Release
22nd Azerbaijan International Construction Exhibition Post-show release CASPIAN CONSTRUCTION WEEK The Caspian Region’s largest building exhibition, BakuBuild 2016, the 22nd Azerbaijan International Construction Exhibition opened its doors on 19 October at Baku Expo Center. BakuBuild is the most important trade event in the region for building and architecture, and design and renovations. Every year, professionals from a range of different countries attend the exhibition to find business partners. Start of BakuBuild 2016 marked the beginning of Caspian Construction Week, comprising of Aquatherm Baku 2016 and Securika CIPS 2016 exhibitions. The official opening ceremony was attended by Deputy Minister of Economy of the Republic of Azerbaijan – Mr. Niyazi Safarov, Deputy Head of the Agency for the control of security in the building of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan – Mr. Elkhan Asadov, vice-president of the National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic Vugar Zeynalov and Executive Director of ITE Group – Mr. Edward Strachan. Speakers noted the important role of the exhibition in the development of the construction industry of the country, the transformation of a modern infrastructure of Azerbaijan and noted the importance of professional contacts and exchange of experience between the industrialists and businessmen of different countries. This year Caspian Construction Week gathered 292 companies from 24 countries and occupies 2 pavilions and Lobby of the Baku Expo Center. Iran, Italy and the UAE will have national display booths, and Turkey hosted a large stand as well. French companies presented group stand. Azerbaijani companies made up 50% of exhibitors. The Sponsors of BakuBuild 2016 were Corella (NB Group), and Akkord Cement, and the media partner of the exhibition was the trade magazine “House and Interior” (“Dom i Interyer”). -

22Nd Azerbaijan International Telecommunications and Information Technologies Exhibition and Conference
22nd Azerbaijan International Telecommunications and Information Technologies Exhibition and Conference Post-show From 29 November to 2 December in Azerbaijan capital city Baku hosted Azerbaijan International Telecommunications and Information Technologies Exhibition and Conference, Bakutel 2016 officially launching the ICT Week. Every year for over 20 years, Bakutel, the largest exhibition in the region, has been bringing together leading players of the communications market. As the main arena for presenting IT products and services, Bakutel had acquired status as the main business platform where new contacts and businesses are created. The Ministry of Communications and HighTechnologies of the Republic of Azerbaijan has provided invaluable support to Bakutel. The show is also respected globally and is supported by institutions, such as the United Nations, the International Telecommunication Union, the Regional Commonwealth in the field of Communications (RCC) and the Global Association of the Exhibition Industry. The organisers of the event are Iteca Caspian and Caspian Event Organisers (CEO). This year, Bakutel coincides with celebrations for the 135th Anniversary of Communications in Azerbaijan. One hundred and thirty five years ago, the Nobel Brothers laid the first telephone line in Baku and, since then, Azerbaijan has had its own place in the history of the communications industry. Today, Azerbaijan's ICT industry growth rate ranks first in the non-oil sector of the economy, which can be seen at the exhibition President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and his spouse Mehriban Aliyeva had viewed BakuTel- 2016, which brought together over 200 companies from 18 countries, with 40% of the total number of participants being returning exhibitors at Bakutel. -

Improvement of Operation and Regulation of Capital and Financial Derivatives Markets in Azerbaijan Government Publications Registration Number 11-1051000-000955-01
Presented by the MOEF, Republic of Korea 2018/19 KSP Policy Consultation Report Azerbaijan Improvement of Operation and Regulation of Capital and Financial Derivatives Markets in Azerbaijan Government Publications Registration Number 11-1051000-000955-01 2018/19 KSP Policy Consultation Report Azerbaijan Improvement of Operation and Regulation of Capital and Financial Derivatives Markets in Azerbaijan 2018/19 KSP Policy Consultation Report Project Title Improvement of Operation and Regulation of Capital and Financial Derivatives Markets in Azerbaijan Prepared for The Government of the Republic of Azerbaijan In Cooperation with Financial Market Supervisory Authority (FIMSA) Supported by Ministry of Economy and Finance (MOEF), Republic of Korea Prepared by Korea Development Institute (KDI) Project Directors Sanghoon Ahn, Executive Director, Center for International Development (CID), KDI Youngsun Koh, Executive Director, Global Knowledge Exchange & Development Center, Former Executive Director, CID, KDI Project Manager Tai-Hee Lee, Specialist, CID, KDI Project Officer Hyunyi Choi, Senior Research Associate, Division of Development Research, CID, KDI Senior Advisor Joo Hyun Kim, Former President, Korea Deposit Insurance Corporation Principal Investigator Jaejoon Han, Professor, Inha University Authors Chapter 1. Hyunduk Suh, Professor, Inha University Metin Yolciyev, Baku Stock Exchange Chapter 2. Jaejoon Han, Professor, Inha University Orkan Baghirov, Invest AZ Chapter 3. Wook Chang, Duksung Women’s University Museyyib Mehdiyev, Baku Stock -

Azerbaijan Industry Bank OJSC
Azerbaijan Industry Bank OJSC Consolidated Financial Statements and Independent Auditors’ Report For the year ended 31 December 2016 Azerbaijan Industry Bank OJSC Consolidated financial statements and independent auditors report Table of contents Page Statement of management' s responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2016 1 Independent auditors' report 2-3 Consolidated statement of financial position 4 Consolidated statement of comprehensive income 5 Consolidated statement of changes in equity 6 Consolidated statement of cash flows 7-8 Notes to the consolidated financial statements 9-65 Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the co nsolidated frnancial s tatements For the year ended 31 Decernber 2016 The following statement is made with a view to distingushrng tespective responsibilities of the management and those of the tndependent auditors in relation to the consolidated financial statements of " Azerbarjan Industry Bank" Open Joint Stock Company (the "Bank") and its subsidiary (collectively refered to as the "Gtoup"). The management is responsible fot the prepatation of the consolidated financial statements that present fafuly the financial position of the Group as at31. Decembet 2016,the tesults of its operations, cash flows and changes m equlty for the year then ended, in accotdance with Intetnational Financial Repotrng Standards ("IFRS"). In ptepadng the consolidated financial statements, management is responsible for: . Propedy selecting and app\ang accounting policies; . Ptesenting information, including accounting policies, in a manner that plovides televant, reliable, compatable and understandable information; o Ptoviding additional disclosures when compliance with the specific requilements in IFRSs are insuffrcient to enable users to undetstand the impact of particular transactions, other events and conditions on the Group's consolidated financial position and financial performance; . -

Futures & Derivatives
Reprinted with permission from Futures and Derivatives Law Report, Vol- ume 36, Issue 3, K2016 Thomson Reuters. Further reproduction without permission of the publisher is prohibited. For additional information about this publication, please visit www.legalsolutions.thomsonreuters.com. March 2016 ▪ Volume 36 ▪ Issue 3 REPORT DERIVATIVES dence from the Soviet Union in 1991 has started a new chapter in the development REGULATION IN of Azerbaijani securities markets. AZERBAIJAN Soon after gaining independence, Azer- Ulvia Zeynalova-Bockin baijan adopted the Law “On Securities Ulvia Zeynalova-Bockin is a senior as- and Stock Exchanges”3 (now repealed), sociate in the Baku oce of Dentons. which regulated the securities market with Her practice includes banking law, Islamic nance, real estate nance, the objective of protecting the interests of mergers and acquisitions, as well as investors. At the same time the govern- corporate law and nance. She also has ment launched the First State Privatiza- experience in securities and nancial tion Program4, creating a hundreds of joint regulation, including work with the Corporation Finance Division of the stock companies and thousands of share- U.S. Securities & Exchange holders on the basis of privatized state Commission. She has provided legal enterprises. The State Committee on Se- support to local and international curities of the Republic of Azerbaijan (the clientele in high-prole matters, includ- 5 ing advising on the rst IPO to be listed “State Securities Committee”) was estab- on the Baku Stock Exchange and advis- lished in 1998, followed soon thereafter ing major investment banks on by the establishment of the modern Civil Azerbaijani derivatives and securities Code of the Republic of Azerbaijan.6 Not regulation. -

2014-20152014-2015
2014-20152014-2015 www.amchamaz.org TABLE OF CONTENTS YEAR AT A GLANCE 2 MESSAGE FROM THE PRESIDENT 4 AMCHAM STRUCTURE 6 MEMBERSHIP 8 CHARITY 15 FINANCIAL STATEMENTS 16 COMMITTEES 20 PROJECTS 28 GOVERNMENT RELATIONS 31 INTERNATIONAL RELATIONS 34 EVENTS 36 IMPACT AZERBAIJAN 44 M2M & M2M+ DISCOUNT PROGRAMS 46 INTERNSHIP 49 MEMBERSHIP LIST 50 E-AMCHAM 63 CONTACT US 64 1 2014 • CSR Committee meeting • AmCham ICT Committee Meeting JAN • AmCham Tax & Customs Committee Meeting • AmCham January Members' Luncheon & Fair GLANCE A T • Travel, Hospitality and Tourism Committee • CEO Breakfast at Hilton A FEB Meeting • Monthly Members Luncheon: AmCham • “E-Government in Action Conference” working Annual General Assembly 2014 group YEAR YEAR AT A GLANCE A YEAR AT • ICT Conference working group meeting • AmCham March Banking Finance & Insurance MAR • Labor/Human Resources Committee Meeting Committee Meeting • Tax&Customs Committee Meeting • AmCham Members' Luncheon • Tax&Customs Committee Meeting APR • HR Committee Meeting • AmCham April Members' Luncheon • ICT Committee Meeting • New Business Opportunities in Kazakhstan • CEOs Breakfast • HR Committee Meeting • AmCham May Board Meeting MAY • Joint Banking, Finance & Insurance and Tax & • CSR Committee Meeting Customs Committees Meeting • AmCham May Members' Luncheon • AmCham Trade Mission to the Western Regions • Business-after-hours Summer Party JUN • • CEO Breakfast • Working Group on Education • June joint Banking, Finance & Insurance and • AmCham and PASHA Bank Summer Tax & Customs Committees Meeting -

Annual Sustainable Development Report 2018 2019
Annual Sustainable Development Report 2018 2019 1 Contents 2 SOCAR son illərdə öz uğurlu fəaliyyəti ilə regional və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfdən müəyyən edilən beynəlxalq enerji bazarlarında mövqeyini gücləndi- Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri proqramına qoşulmuş və rir, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin möhkəmlənməsinə, proqramda göstərilən hədəflərə nail olmaq üçün qüv- 1.0 Message from the President 04 2.0 About this Report 07 3.0 About the Company 11 4.0 SOCAR’s Contribution to the Sustainable Development Goals 37 5.0 Corporate Governance 43 6.0 Human Resources 63 7.0 Support for Local Social Development 89 8.0 Occupational Health and Safety 97 9.0 Environmental Activities 111 10.0 SOCAR’s Performance Indicators 141 11.0 GRI Content Index and Independent Assurance Statement 168 xalqımızın maddi rifah halının yaxşılaşmasına dəyər- vələrini səfərbər etmişdir. Ölkə iqtisadiyyatının aparıcı li töhfələr verir. Azərbaycan Respublikası 2015-ci ildə qüvvəsi olan SOCAR fəaliyyət və təşəbbüslərini In reIn 3 MESSAGE FROM THE PRESIDENT In recent years, SOCAR has been reinforcing its posi- tion in both regional and global energy markets to sup- port the strengthening of the country’s economic power and improvement of the nation’s welfare. In 2015, the Republic of Azerbaijan adopted the UN Sustainable Development Goals and mobilized its forces to achieve the goals set out in the program. As one of the driving forces in the country’s economy, SOCAR seeks to align its activities and initiatives with the Sustainable Devel- opment Goals. We have already begun to set targets to achieve the Sustainable Development Goals by the year 2030. In light of the need to adapt to rapid development and changes in the world oil and gas industry and to keep pace with global competition, SOCAR began the draft- ing of “SOCAR’s Corporate Strategy to 2035” based on its “Comprehensive Strategic Development Plan to To overcome these challenges, we need to develop our 2035”2025” that was approved in 2011. -
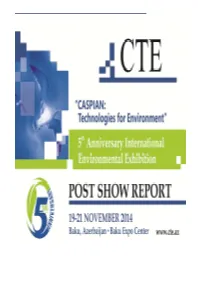
CTE Report Eng.Pdf
BRIEF Date of foundation: 2010 Caspian: Technologies for the Environment – an international environmental exhibition is considered the only event for ecological and environmental matters held in the Caspian and Caucasus regions for the past 5 years, and one which comprehensively presents innovative developments in the field of environmental protection and natural resources management. The exhibition is held with support from and the active participation of the Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan. The exhibition is organised by Iteca Caspian LLC, Caspian Event Organisers LLC and its partner, ITE Group PLC. EXHIBITION TEAM Rena Abutalibova Project Manager Iteca Caspian LLC Jale Mammadova Project Manager Iteca Caspian LLC Babek Amashov Technical Manager Iteca Caspian LLC Emiliya Aliyeva Technical Manager Iteca Caspian LLC SUPPORT SPONSOR The Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan OFFICIAL PARTNERS Official Official Security Official stand hotels travel partner partner builder OFFICIAL OPENING CEREMONY The official opening ceremony and VIP tour were attended by Mr. Huseyn Bagirov, Minister of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan, Mr. Edward Strachan, Executive Director of ITE Group PLC, representatives of the diplomatic corps, the media and exhibitors. The companies awarded by the special certificates: Best Costumer Attraction – AZERBAIJAN CASPIAN SHIPPING CJSC Best Debut – NATIONAL PAVILION OF CZECH REPUBLIC Best Performance – WWF - AZERBAIJAN Best Shell Scheme – MATATANT A Best Stand Design – STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC (SOCAR) Most Original Stand - AZERBAIJAN AMELIORATION AND WATER FARM OJSC PARTICIPANTS Number of participants: 77 Domestic participants: 47 International participants: 30 Gross: 2175 sq.m. -

Federation of Euro-Asian Stock Exchanges
FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES YEARBOOK 2002/2003 FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES YEARBOOK 2002/2003 FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES > YEARBOOK 2002/2003 > PAGE 1 TABLE OF CONTENTS President’s Message 3 Articles Federation of Euro-Asian Stock Exchanges 4 Takasbank 8 HP Capital Markets Framework 10 World Federation of Exchanges 12 The International Accounting Standards Board 14 Stock Exchange Profiles Amman Stock Exchange 16 Lahore Stock Exchange 52 Armenian Stock Exchange 19 Macedonian Stock Exchange 55 Baku Interbank Currency Exchange 22 Moldovan Stock Exchange 59 Baku Stock Exchange 25 Mongolian Stock Exchange 62 Bulgarian Stock Exchange 28 Muscat Securities Market 65 Cairo and Alexandria Stock Exchanges 31 Palestine Securities Exchange 68 Dhaka Stock Exchange 34 State Commodity & Raw Materials Georgian Stock Exchange 37 Exchange of Turkmenistan 71 Istanbul Stock Exchange 40 Tehran Stock Exchange 73 Karachi Stock Exchange 43 Tirana Stock Exchange 76 Kazakhstan Stock Exchange 46 “Toshkent” Republican Stock Exchange 79 Kyrgyz Stock Exchange 49 Ukrainian Stock Exchange 82 Zagreb Stock Exchange 85 Member List 89 FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES (FEAS) I.M.K.B, Reflitpafla Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan 34467 Istanbul, Turkey Tel: (90 212) 298 2160 Fax: (90 212) 298 2209 E-mail: [email protected] Web address: www.feas.org Contacts: Mr. Aril Seren, Secretary General Ms. Rosalind Marshall, Assistant Secretary General The Federation of Euro-Asian Stock Exchanges Yearbook 2002/2003 is published by the Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. All editorial material was collated and edited by the Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. The design, production and distribution was coordinated by the Federation of Euro-Asian Stock Exchanges. -

Cooperation Among the Stock Exchanges of the Oic Member Countries
Journal of Economic Cooperation, 27 -3 (2006), 121-162 COOPERATION AMONG THE STOCK EXCHANGES OF THE OIC MEMBER COUNTRIES SESRTCIC In response to the increased competition prevailing in the international financial markets, national stock exchanges around the world recently made several attempts to upgrade their cooperation and improve their integration. Those attempts took often the form of coalitions, common trading platforms, mergers, associations, federations and unions. Like others, the OIC countries have recently intensified their efforts to promote cooperation among their stock exchanges with a view to developing and consolidating a mechanism for a possible form of integration among themselves. This paper reviews the experiences of various stock exchange alliances established at regional and international levels and draws some lessons for the OIC countries’ stock exchanges in terms of the need for harmonising their physical, institutional and legal frameworks and policies and sharing their investor base. 1. INTRODUCTION As the international trade and financial flows accelerated, the global economy witnessed an increase in the pace of integration. This process of globalisation is most evidently observed in the capital and financial markets. One important element that has led to such a result is the technological advancement in the information and telecommunications sector. Hence, financial transactions became instantaneous and the information guiding investments open to everybody. In this context, technological advancements and the resulting accelerated flow of information have increased efficiency, fairness, transparency and safety in the international financial and capital markets. 122 Journal of Economic Cooperation As those developments introduced new prospects and benefits to the stock markets all around the world, they increased competition among the financial markets, securities exchanges in particular. -

Press Conference on 10Th Azerbaijan International Education Exhibition
A pressA press conference conference on theon 10ththe 10th Anniversary Anniversary Azerbaijan Azerbaijan International International Education Education Exhibition Exhibition that thatwill bewill be organizedorganized at at the the Baku Baku Expo Expo Center Center in in partnership partnership with with the the Ministry Ministry of of Education Education was was held held on on October October 6. 6. Speakers Speakers at at thethe eventevent saidsaid AzerbaijanAzerbaijan InternationalInternational EducationEducation ExhibitionExhibition isis thethe onlyonly eventevent inin thethe fieldfield ofof educationeducation inin thethe country.country. AA totaltotal ofof 800800 companiescompanies havehave attendedattended thethe exhibitionexhibition soso far.far. ThisThis year,year, representativesrepresentatives ofof universities,universities, collegescolleges andand otherother educationaleducational institutionsinstitutions fromfrom Azerbaijan,Azerbaijan, Turkey,Turkey, Germany,Germany, Latvia, Latvia, Lithuania, Lithuania, Czech Czech Republic, Republic, Hungary, Hungary, Poland, Poland, Belarus, Belarus, Jordan Jordan will willintroduce introduce their their educational educational programs to visitors of the exhibition. AmongAmong the localthe localexhibitors exhibitors are Azerbaijanare Azerbaijan State State University University of Oil of and Oil Industry,and Industry, Azerbaijan Azerbaijan Technical Technical University, Azerbaijan State Economic University, Baku Business University, Azerbaijan Architecture and Construction University,University,