Jürgen Lamprecht, Ronald C.Stoyan, Klaus Veit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

I N S I D E T H I S I S S
Publications from February/février 1998 Volume/volume 92 Number/numero 1 [669] The Royal Astronomical Society of Canada The Beginner’s Observing Guide This guide is for anyone with little or no experience in observing the night sky. Large, easy to read star maps are provided to acquaint the reader with the constellations and bright stars. Basic information on observing the moon, planets and eclipses through the year 2000 is provided. There The Journal of the Royal Astronomical Society of Canada Le Journal de la Société royale d’astronomie du Canada is also a special section to help Scouts, Cubs, Guides and Brownies achieve their respective astronomy badges. Written by Leo Enright (160 pages of information in a soft-cover book with a spiral binding which allows the book to lie flat). Price: $12 (includes taxes, postage and handling) Looking Up: A History of the Royal Astronomical Society of Canada Published to commemorate the 125th anniversary of the first meeting of the Toronto Astronomical Club, “Looking Up — A History of the RASC” is an excellent overall history of Canada’s national astronomy organization. The book was written by R. Peter Broughton, a Past President and expert on the history of astronomy in Canada. Histories on each of the centres across the country are included as well as dozens of biographical sketches of the many people who have volunteered their time and skills to the Society. (hard cover with cloth binding, 300 pages with 150 b&w illustrations) Price: $43 (includes taxes, postage and handling) Observers Calendar — 1998 This calendar was created by members of the RASC. -

Spatial Distribution of Galactic Globular Clusters: Distance Uncertainties and Dynamical Effects
Juliana Crestani Ribeiro de Souza Spatial Distribution of Galactic Globular Clusters: Distance Uncertainties and Dynamical Effects Porto Alegre 2017 Juliana Crestani Ribeiro de Souza Spatial Distribution of Galactic Globular Clusters: Distance Uncertainties and Dynamical Effects Dissertação elaborada sob orientação do Prof. Dr. Eduardo Luis Damiani Bica, co- orientação do Prof. Dr. Charles José Bon- ato e apresentada ao Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em preenchimento do requisito par- cial para obtenção do título de Mestre em Física. Porto Alegre 2017 Acknowledgements To my parents, who supported me and made this possible, in a time and place where being in a university was just a distant dream. To my dearest friends Elisabeth, Robert, Augusto, and Natália - who so many times helped me go from "I give up" to "I’ll try once more". To my cats Kira, Fen, and Demi - who lazily join me in bed at the end of the day, and make everything worthwhile. "But, first of all, it will be necessary to explain what is our idea of a cluster of stars, and by what means we have obtained it. For an instance, I shall take the phenomenon which presents itself in many clusters: It is that of a number of lucid spots, of equal lustre, scattered over a circular space, in such a manner as to appear gradually more compressed towards the middle; and which compression, in the clusters to which I allude, is generally carried so far, as, by imperceptible degrees, to end in a luminous center, of a resolvable blaze of light." William Herschel, 1789 Abstract We provide a sample of 170 Galactic Globular Clusters (GCs) and analyse its spatial distribution properties. -

Guide Du Ciel Profond
Guide du ciel profond Olivier PETIT 8 mai 2004 2 Introduction hjjdfhgf ghjfghfd fg hdfjgdf gfdhfdk dfkgfd fghfkg fdkg fhdkg fkg kfghfhk Table des mati`eres I Objets par constellation 21 1 Androm`ede (And) Andromeda 23 1.1 Messier 31 (La grande Galaxie d'Androm`ede) . 25 1.2 Messier 32 . 27 1.3 Messier 110 . 29 1.4 NGC 404 . 31 1.5 NGC 752 . 33 1.6 NGC 891 . 35 1.7 NGC 7640 . 37 1.8 NGC 7662 (La boule de neige bleue) . 39 2 La Machine pneumatique (Ant) Antlia 41 2.1 NGC 2997 . 43 3 le Verseau (Aqr) Aquarius 45 3.1 Messier 2 . 47 3.2 Messier 72 . 49 3.3 Messier 73 . 51 3.4 NGC 7009 (La n¶ebuleuse Saturne) . 53 3.5 NGC 7293 (La n¶ebuleuse de l'h¶elice) . 56 3.6 NGC 7492 . 58 3.7 NGC 7606 . 60 3.8 Cederblad 211 (N¶ebuleuse de R Aquarii) . 62 4 l'Aigle (Aql) Aquila 63 4.1 NGC 6709 . 65 4.2 NGC 6741 . 67 4.3 NGC 6751 (La n¶ebuleuse de l’œil flou) . 69 4.4 NGC 6760 . 71 4.5 NGC 6781 (Le nid de l'Aigle ) . 73 TABLE DES MATIERES` 5 4.6 NGC 6790 . 75 4.7 NGC 6804 . 77 4.8 Barnard 142-143 (La tani`ere noire) . 79 5 le B¶elier (Ari) Aries 81 5.1 NGC 772 . 83 6 le Cocher (Aur) Auriga 85 6.1 Messier 36 . 87 6.2 Messier 37 . 89 6.3 Messier 38 . -

Hubble Sees a Unique Cluster: One of the 'Hidden 15' 22 April 2013
Hubble sees a unique cluster: One of the 'hidden 15' 22 April 2013 almost always see them in the same region of the sky. Palomar 2 is an exception to this, as it is around five times further away from the center of the Milky Way than other clusters. It also lies in the opposite direction—further out than Earth—and so it is classed as an "outer halo" globular. It is also unusual due to its apparent dimness. The cluster is veiled by a mask of dust, dampening the apparent brightness of the stars within it and making it appear as a very faint burst of stars. The stunning NASA/ESA Hubble Space Telescope image shows Palomar 2 in a way that could not be captured from smaller or ground-based telescopes—some amateur astronomers with large telescopes attempt to observe all of the obscure and well-hidden Palomar 15 as a challenge, to see how many they can pick out from the starry sky. Credit: ESA/NASA, Hubble Provided by NASA (Phys.org) —Palomar 2 is part of a group of 15 globulars known as the Palomar clusters. These clusters, as the name suggests, were discovered in survey plates from the first Palomar Observatory Sky Survey in the 1950s, a project that involved some of the most well-known astronomers of the day, including Edwin Hubble. They were discovered quite late because they are so faint—each is either extremely remote, very heavily hidden behind blankets of dust, or has a very small number of remaining stars. This particular cluster is unique in more than one way. -

Astronomy Magazine Special Issue
γ ι ζ γ δ α κ β κ ε γ β ρ ε ζ υ α φ ψ ω χ α π χ φ γ ω ο ι δ κ α ξ υ λ τ μ β α σ θ ε β σ δ γ ψ λ ω σ η ν θ Aι must-have for all stargazers η δ μ NEW EDITION! ζ λ β ε η κ NGC 6664 NGC 6539 ε τ μ NGC 6712 α υ δ ζ M26 ν NGC 6649 ψ Struve 2325 ζ ξ ATLAS χ α NGC 6604 ξ ο ν ν SCUTUM M16 of the γ SERP β NGC 6605 γ V450 ξ η υ η NGC 6645 M17 φ θ M18 ζ ρ ρ1 π Barnard 92 ο χ σ M25 M24 STARS M23 ν β κ All-in-one introduction ALL NEW MAPS WITH: to the night sky 42,000 more stars (87,000 plotted down to magnitude 8.5) AND 150+ more deep-sky objects (more than 1,200 total) The Eagle Nebula (M16) combines a dark nebula and a star cluster. In 100+ this intense region of star formation, “pillars” form at the boundaries spectacular between hot and cold gas. You’ll find this object on Map 14, a celestial portion of which lies above. photos PLUS: How to observe star clusters, nebulae, and galaxies AS2-CV0610.indd 1 6/10/10 4:17 PM NEW EDITION! AtlAs Tour the night sky of the The staff of Astronomy magazine decided to This atlas presents produce its first star atlas in 2006. -

Catalogue of Excitation Classes P for 750 Galactic Planetary Nebulae
Catalogue of Excitation Classes p for 750 Galactic Planetary Nebulae Name p Name p Name p Name p NeC 40 1 Nee 6072 9 NeC 6881 10 IC 4663 11 NeC 246 12+ Nee 6153 3 NeC 6884 7 IC 4673 10 NeC 650-1 10 Nee 6210 4 NeC 6886 9 IC 4699 9 NeC 1360 12 Nee 6302 10 Nee 6891 4 IC 4732 5 NeC 1501 10 Nee 6309 10 NeC 6894 10 IC 4776 2 NeC 1514 8 NeC 6326 9 Nee 6905 11 IC 4846 3 NeC 1535 8 Nee 6337 11 Nee 7008 11 IC 4997 8 NeC 2022 12 Nee 6369 4 NeC 7009 7 IC 5117 6 NeC 2242 12+ NeC 6439 8 NeC 7026 9 IC 5148-50 6 NeC 2346 9 NeC 6445 10 Nee 7027 11 IC 5217 6 NeC 2371-2 12 Nee 6537 11 Nee 7048 11 Al 1 NeC 2392 10 NeC 6543 5 Nee 7094 12 A2 10 NeC 2438 10 NeC 6563 8 NeC 7139 9 A4 10 NeC 2440 10 NeC 6565 7 NeC 7293 7 A 12 4 NeC 2452 10 NeC 6567 4 Nee 7354 10 A 15 12+ NeC 2610 12 NeC 6572 7 NeC 7662 10 A 20 12+ NeC 2792 11 NeC 6578 2 Ie 289 12 A 21 1 NeC 2818 11 NeC 6620 8 IC 351 10 A 23 4 NeC 2867 9 NeC 6629 5 Ie 418 1 A 24 1 NeC 2899 10 Nee 6644 7 IC 972 10 A 30 12+ NeC 3132 9 NeC 6720 10 IC 1295 10 A 33 11 NeC 3195 9 NeC 6741 9 IC 1297 9 A 35 1 NeC 3211 10 NeC 6751 9 Ie 1454 10 A 36 12+ NeC 3242 9 Nee 6765 10 IC1747 9 A 40 2 NeC 3587 8 NeC 6772 9 IC 2003 10 A 41 1 NeC 3699 9 NeC 6778 9 IC 2149 2 A 43 2 NeC 3918 9 NeC 6781 8 IC 2165 10 A 46 2 NeC 4071 11 NeC 6790 4 IC 2448 9 A 49 4 NeC 4361 12+ NeC 6803 5 IC 2501 3 A 50 10 NeC 5189 10 NeC 6804 12 IC 2553 8 A 51 12 NeC 5307 9 NeC 6807 4 IC 2621 9 A 54 12 NeC 5315 2 NeC 6818 10 Ie 3568 3 A 55 4 NeC 5873 10 NeC 6826 11 Ie 4191 6 A 57 3 NeC 5882 6 NeC 6833 2 Ie 4406 4 A 60 2 NeC 5879 12 NeC 6842 2 IC 4593 6 A -

HET Publication Report HET Board Meeting 3/4 December 2020 Zoom Land
HET Publication Report HET Board Meeting 3/4 December 2020 Zoom Land 1 Executive Summary • There are now 420 peer-reviewed HET publications – Fifteen papers published in 2019 – As of 27 November, nineteen published papers in 2020 • HET papers have 29363 citations – Average of 70, median of 39 citations per paper – H-number of 90 – 81 papers have ≥ 100 citations; 175 have ≥ 50 cites • Wide angle surveys account for 26% of papers and 35% of citations. • Synoptic (e.g., planet searches) and Target of Opportunity (e.g., supernovae and γ-ray bursts) programs have produced 47% of the papers and 47% of the citations, respectively. • Listing of the HET papers (with ADS links) is given at http://personal.psu.edu/dps7/hetpapers.html 2 HET Program Classification Code TypeofProgram Examples 1 ToO Supernovae,Gamma-rayBursts 2 Synoptic Exoplanets,EclipsingBinaries 3 OneorTwoObjects HaloofNGC821 4 Narrow-angle HDF,VirgoCluster 5 Wide-angle BlazarSurvey 6 HETTechnical HETQueue 7 HETDEXTheory DarkEnergywithBAO 8 Other HETOptics Programs also broken down into “Dark Time”, “Light Time”, and “Other”. 3 Peer-reviewed Publications • There are now 420 journal papers that either use HET data or (nine cases) use the HET as the motivation for the paper (e.g., technical papers, theoretical studies). • Except for 2005, approximately 22 HET papers were published each year since 2002 through the shutdown. A record 44 papers were published in 2012. • In 2020 a total of fifteen HET papers appeared; nineteen have been published to date in 2020. • Each HET partner has published at least 14 papers using HET data. • Nineteen papers have been published from NOAO time. -

Astronomical Coordinate Systems
Appendix 1 Astronomical Coordinate Systems A basic requirement for studying the heavens is being able to determine where in the sky things are located. To specify sky positions, astronomers have developed several coordinate systems. Each sys- tem uses a coordinate grid projected on the celestial sphere, which is similar to the geographic coor- dinate system used on the surface of the Earth. The coordinate systems differ only in their choice of the fundamental plane, which divides the sky into two equal hemispheres along a great circle (the fundamental plane of the geographic system is the Earth’s equator). Each coordinate system is named for its choice of fundamental plane. The Equatorial Coordinate System The equatorial coordinate system is probably the most widely used celestial coordinate system. It is also the most closely related to the geographic coordinate system because they use the same funda- mental plane and poles. The projection of the Earth’s equator onto the celestial sphere is called the celestial equator. Similarly, projecting the geographic poles onto the celestial sphere defines the north and south celestial poles. However, there is an important difference between the equatorial and geographic coordinate sys- tems: the geographic system is fixed to the Earth and rotates as the Earth does. The Equatorial system is fixed to the stars, so it appears to rotate across the sky with the stars, but it’s really the Earth rotating under the fixed sky. The latitudinal (latitude-like) angle of the equatorial system is called declination (Dec. for short). It measures the angle of an object above or below the celestial equator. -
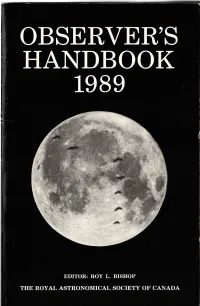
Observer's Handbook 1989
OBSERVER’S HANDBOOK 1 9 8 9 EDITOR: ROY L. BISHOP THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY OF CANADA CONTRIBUTORS AND ADVISORS Alan H. B atten, Dominion Astrophysical Observatory, 5071 W . Saanich Road, Victoria, BC, Canada V8X 4M6 (The Nearest Stars). L a r r y D. B o g a n , Department of Physics, Acadia University, Wolfville, NS, Canada B0P 1X0 (Configurations of Saturn’s Satellites). Terence Dickinson, Yarker, ON, Canada K0K 3N0 (The Planets). D a v id W. D u n h a m , International Occultation Timing Association, 7006 Megan Lane, Greenbelt, MD 20770, U.S.A. (Lunar and Planetary Occultations). A lan Dyer, A lister Ling, Edmonton Space Sciences Centre, 11211-142 St., Edmonton, AB, Canada T5M 4A1 (Messier Catalogue, Deep-Sky Objects). Fred Espenak, Planetary Systems Branch, NASA-Goddard Space Flight Centre, Greenbelt, MD, U.S.A. 20771 (Eclipses and Transits). M a r ie F i d l e r , 23 Lyndale Dr., Willowdale, ON, Canada M2N 2X9 (Observatories and Planetaria). Victor Gaizauskas, J. W. D e a n , Herzberg Institute of Astrophysics, National Research Council, Ottawa, ON, Canada K1A 0R6 (Solar Activity). R o b e r t F. G a r r i s o n , David Dunlap Observatory, University of Toronto, Box 360, Richmond Hill, ON, Canada L4C 4Y6 (The Brightest Stars). Ian H alliday, Herzberg Institute of Astrophysics, National Research Council, Ottawa, ON, Canada K1A 0R6 (Miscellaneous Astronomical Data). W illiam H erbst, Van Vleck Observatory, Wesleyan University, Middletown, CT, U.S.A. 06457 (Galactic Nebulae). Ja m e s T. H im e r, 339 Woodside Bay S.W., Calgary, AB, Canada, T2W 3K9 (Galaxies). -
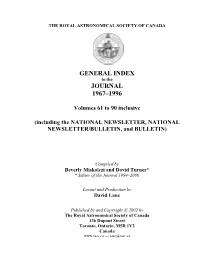
Index to JRASC Volumes 61-90 (PDF)
THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY OF CANADA GENERAL INDEX to the JOURNAL 1967–1996 Volumes 61 to 90 inclusive (including the NATIONAL NEWSLETTER, NATIONAL NEWSLETTER/BULLETIN, and BULLETIN) Compiled by Beverly Miskolczi and David Turner* * Editor of the Journal 1994–2000 Layout and Production by David Lane Published by and Copyright 2002 by The Royal Astronomical Society of Canada 136 Dupont Street Toronto, Ontario, M5R 1V2 Canada www.rasc.ca — [email protected] Table of Contents Preface ....................................................................................2 Volume Number Reference ...................................................3 Subject Index Reference ........................................................4 Subject Index ..........................................................................7 Author Index ..................................................................... 121 Abstracts of Papers Presented at Annual Meetings of the National Committee for Canada of the I.A.U. (1967–1970) and Canadian Astronomical Society (1971–1996) .......................................................................168 Abstracts of Papers Presented at the Annual General Assembly of the Royal Astronomical Society of Canada (1969–1996) ...........................................................207 JRASC Index (1967-1996) Page 1 PREFACE The last cumulative Index to the Journal, published in 1971, was compiled by Ruth J. Northcott and assembled for publication by Helen Sawyer Hogg. It included all articles published in the Journal during the interval 1932–1966, Volumes 26–60. In the intervening years the Journal has undergone a variety of changes. In 1970 the National Newsletter was published along with the Journal, being bound with the regular pages of the Journal. In 1978 the National Newsletter was physically separated but still included with the Journal, and in 1989 it became simply the Newsletter/Bulletin and in 1991 the Bulletin. That continued until the eventual merger of the two publications into the new Journal in 1997. -

108 Afocal Procedure, 105 Age of Globular Clusters, 25, 28–29 O
Index Index Achromats, 70, 73, 79 Apochromats (APO), 70, Averted vision Adhafera, 44 73, 79 technique, 96, 98, Adobe Photoshop Aquarius, 43, 99 112 (software), 108 Aquila, 10, 36, 45, 65 Afocal procedure, 105 Arches cluster, 23 B1620-26, 37 Age Archinal, Brent, 63, 64, Barkhatova (Bar) of globular clusters, 89, 195 catalogue, 196 25, 28–29 Arcturus, 43 Barlow lens, 78–79, 110 of open clusters, Aricebo radio telescope, Barnard’s Galaxy, 49 15–16 33 Basel (Bas) catalogue, 196 of star complexes, 41 Aries, 45 Bayer classification of stellar associations, Arp 2, 51 system, 93 39, 41–42 Arp catalogue, 197 Be16, 63 of the universe, 28 Arp-Madore (AM)-1, 33 Beehive Cluster, 13, 60, Aldebaran, 43 Arp-Madore (AM)-2, 148 Alessi, 22, 61 48, 65 Bergeron 1, 22 Alessi catalogue, 196 Arp-Madore (AM) Bergeron, J., 22 Algenubi, 44 catalogue, 197 Berkeley 11, 124f, 125 Algieba, 44 Asterisms, 43–45, Berkeley 17, 15 Algol (Demon Star), 65, 94 Berkeley 19, 130 21 Astronomy (magazine), Berkeley 29, 18 Alnilam, 5–6 89 Berkeley 42, 171–173 Alnitak, 5–6 Astronomy Now Berkeley (Be) catalogue, Alpha Centauri, 25 (magazine), 89 196 Alpha Orionis, 93 Astrophotography, 94, Beta Pictoris, 42 Alpha Persei, 40 101, 102–103 Beta Piscium, 44 Altair, 44 Astroplanner (software), Betelgeuse, 93 Alterf, 44 90 Big Bang, 5, 29 Altitude-Azimuth Astro-Snap (software), Big Dipper, 19, 43 (Alt-Az) mount, 107 Binary millisecond 75–76 AstroStack (software), pulsars, 30 Andromeda Galaxy, 36, 108 Binary stars, 8, 52 39, 41, 48, 52, 61 AstroVideo (software), in globular clusters, ANR 1947 -

Lifting the Dust Veil from the Globular Cluster Palomar 2
MNRAS 493, 2688–2693 (2020) doi:10.1093/mnras/staa510 Advance Access publication 2020 February 20 Lifting the dust veil from the globular cluster Palomar 2 ‹ Charles Bonatto and Ana L. Chies-Santos Downloaded from https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/493/2/2688/5741731 by Universidade Federal do Rio Grande Sul user on 29 May 2020 Departamento de Astronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Bento Gonc¸alves 9500, Porto Alegre 91501-970, RS, Brazil Accepted 2020 February 18. Received 2020 February 18; in original form 2020 January 17 ABSTRACT This work employs high-quality Hubble Space Telescope (HST) Advanced Camera for Surveys (ACS) F606W and F814W photometry to correct for the differential reddening affecting the colour–magnitude diagram (CMD) of the poorly studied globular cluster (GC) Palomar 2. Differential reddening is taken into account by assuming that morphological differences among CMDs extracted across the field of view of Palomar 2 correspond essentially to shifts (quantified in terms of δE(B − V)) along the reddening vector due to a non-uniform dust distribution. The average reddening difference over all partial CMDs is δE(B − V ) = 0.24 ± 0.08, with the highest reaching δE(B − V) = 0.52. The corrected CMD displays well-defined and relatively narrow evolutionary sequences, especially for the evolved stars, i.e. the red giant, horizontal, and asymptotic giant branches (RGB, HB, and AGB, respectively). The average width of the upper main sequence and RGB profiles of the corrected CMD corresponds to 56 per cent of the original one. Parameters measured on this 5 CMD show that Palomar 2 is ≈13.25 Gyr old, has the mass M ∼ 1.4 × 10 M stored in stars, is affected by the foreground E(B − V) ≈ 0.93, is located at d ≈ 26 kpc from the Sun, and is characterized by the global metallicity Z/Z ≈ 0.03, which corresponds to the range −1.9 ≤ [Fe/H] ≤−1.6 (for 0.0 ≤ [α/Fe] ≤+0.4), quite consistent with other outer halo GCs.