Multilink Offeneer Brief Krim
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Accountability by Numbers: a New Global Transitional Justice Dataset (1946–2016)
Article Accountability by Numbers: A New Global Transitional Justice Dataset (1946–2016) Genevieve Bates, Ipek Cinar, and Monika Nalepa In an era of democratic backsliding, scholars and policymakers wonder if failure to reckon with former authoritarian elites and their collaborators plays a role. Yet without adequate data on the way former autocracies and countries emerging from conflict deal with human rights violators, it is hard to tell if new democracies are unstable because of their failure to reckon with their former authoritarian elites or despite it. We introduce a dataset of personnel transitional justice events that allows scholars to answer such questions, disaggregating these events temporally from the date of a country’s democratization. The time series nature of our data allows scholars to measure key characteristics of states’ dealing with their past and complements existing transitional justice datasets by focusing not only on post-conflict societies and not only on post-authoritarian societies, but on both. To showcase the possibilities our data affords scholars, we use it to develop three novel measures of personnel transitional justice: severity, urgency, and volatility. The granular structure of our data allows researchers to construct additional measures depending on their theoretical questions of interest. We illustrate the use of severity of transitional justice in a regression that also employs data from the Varieties of Democracy project. e live in an era of democratic backsliding: fragile have access to temporally organized data on how states deal W new democracies are at risk of reverting back to with outgoing autocrats, their collaborators, and perpe- dictatorship. To see examples of this, one need trators of human rights violations. -

This Post As Tangentially Related to Leveymg's Most Excellent Recent Diary
This post as tangentially related to leveymg's most excellent recent diary "Larger CIA and DoD Privatization Scandal Emerging from Walter Reed Story, US Attorneys Firing" which centers around hedge fund giant Cerberus. If you haven't had a chance to check that diary out, be sure to do so because it is a very worthwhile read. In this diary, we're going to delve into the intertwined, and quite convoluted scandals involving, among st other things: - Alleged bribes to Ariel Sharon by Martin Schlaff, an Austrian industrialist, that were used to pay back illegal campaign contributions Sharon used in 1999. - The scandalous collapse of Refco, the commodity futures giant, and the related collapse of BAWAG, one of Austria's largest banks (Cerberus recently bought BAWAG, BTW). - Martin Schlaff's investment in Yasser Arafat's "Oasis Casino", and that casino was tied into by the BAWAG/Refco scandals AND Ariel Sharon's right-hand-man Dov Weissman. - Martin Schlaff's and George "Macaca" Allen's involvement with the "Xybernaut" pump-and-dump stock fraud. - Martin Schlaff's apparent financier of far-Right Israeli politician Avigdor Lieberman - and finally, the potential for a crisis in Israel's democracy due to endemic corruption, and the chilling figures that could take advantage of such a crisis. Get to know your BAWAG So, let's get started with a look at the BAWAG scandal that rocked Austria's politics: Austrian Bank Scandal: When Socialists Play With Money From the desk of Chris Gillibrand on Tue, 2006-04-04 22:53 A major banking scandal is rocking the Austrian political elites – left and right. -

„Merkel-Putin-Coming-Out“ (Pdf)
A ABCDCEF ABCD BE !"# E $E%D&CDE%D%ECF'EF&%D$E(CF'&$E%D)*+& (CF'C&(,$(CF'-.'FD&*(CF'-.'FC&(CF'-.'FD FD /%DA,C)BCAB012-BA 3B E 4)BCAB%D,C44E-F5&46D7-A CF3--E3'A8%DCCCC F'(CEEEC(F.CC'43-D"EE"99E-F5 FD ABCDEFBCEA !"#$#%DD& '"( )*+ , -'.)( )+D / ( 0 ( ( ( 1"2))1-( 0"-D 3-"45 '2 ( 6(+67.D/ - $ ( . ( 4#EB89.),:;4( ( 1+<,3"%( += )5>>---D"D>>6>( >>)>( >ABB?BD@A@DACAB@D 9:.ABDBC:-( BDBDABB?; 0#"F))""":( "#%( 0 9D.)@C$%EDC , E) ( %D 0( -#( D ( .#* BCDBADABE %EF% ABCD EFFFFF F ! !"F #$$#!%&#C '(( ( "( (()F!!)FE*!!!!!!+$B$CC %%$ %&&B,-)FE*.-- '(( (! ("%/0$+#(1)!%&#%!,!!!A234 4D,5 C#&%&&01)%&#%'6,7 889*),:23:'E;F,<;EA4"4=D C Andere meinen, für das Management ei- ner Olympia-Kandidatur, die mit Bildern und Liedern aus dem Wendeherbst 1989 gegen nationale Konkurrenz das Rennen machte, sei mehr Sensibilität vonnöten. Tiefensee selbst hatte bei der Städtekür auf der Bühne mit dem Cello „Dona nobis pa- cem“ intoniert, die Botschaft der friedli- chen Revolution gegen die Staatsmacht. Eine „schwierige Debatte“, sagte er ver- gangenen Mittwoch, als Thärichen auf zu- nehmenden Druck beschlossen hatte, sein Amt einstweilen ruhen zu lassen. „Eine Entscheidung ist immer in der Situation zu sehen, in der sie gefällt wurde.“ Von heu- te aus betrachtet, deutet Tiefensee damit wohl an, war Thärichens Berufung falsch. Bei dem SPD-Politiker schien zunächst der bewährte Reflex zu funktionieren: Der Spross einer katholischen Bürgerfamilie PETER ENDIG / DPA versteht es, notwendige Reparaturen – Leipziger Olympia-Werbung: „Nationale Aufgabe“ auch nach selbst verschuldeten Unfällen – als gewollte Verschönerung zu verkaufen. -
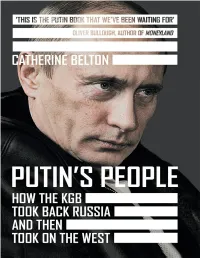
Conversations with Vladimir Putin, P.69 Back to Text 28
PUTINS PEOPLE How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West Catherine Belton Copyright William Collins An imprint of HarperCollinsPublishers 1 London Bridge Street London SE1 9GF WilliamCollinsBooks.com This eBook first published in Great Britain by William Collins in 2020 Copyright © Catherine Belton 2020 Cover photograph © Getty Images Catherine Belton asserts the moral right to be identified as the author of this work A catalogue record for this book is available from the British Library All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. By payment of the required fees, you have been granted the non-exclusive, non-transferable right to access and read the text of this e- book on-screen. No part of this text may be reproduced, transmitted, down- loaded, decompiled, reverse engineered, or stored in or introduced into any information storage and retrieval system, in any form or by any means, whether electronic or mechanical, now known or hereinafter invented, without the express written permission of HarperCollins Source ISBN: 9780007578795 Ebook Edition © April 2020 ISBN: 9780007578801 Version: 2020-04-29 Dedication To my parents, Marjorie and Derek, as well as to Richard and to Catherine Birkett. Epigraph ‘Russian organised-crime leaders, their members, their associates, are moving into Western Europe, they are purchasing property, they are establishing bank accounts, theyre establishing companies, theyre weaving themselves into the fabric of society, and by the time that Europe develops an awareness its going to be too late. Former FBI special agent Bob Levinson ‘I want to warn Americans. As a people, you are very naïve about Russia and its intentions. -
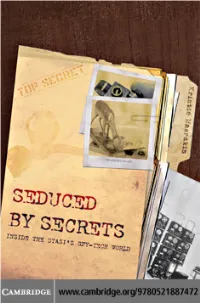
Seduced by Secrets: Inside the Stasi's Spy-Tech World
P1: SBT 9780521188742pre CUNY1276/Macrakis 978 0 521 88747 2 January 17, 2008 14:21 This page intentionally left blank ii P1: SBT 9780521188742pre CUNY1276/Macrakis 978 0 521 88747 2 January 17, 2008 14:21 SEDUCED BY SECRETS More fascinating than fiction, Seduced by Secrets takes the reader inside the real world of one of the most effective and feared spy agencies in history. The book reveals, for the first time, the secret technical methods and sources of the Stasi (East German Ministry for State Security) as it stole secrets from abroad and developed gadgets at home, employing universal, highly guarded techniques often used by other spy and security agencies. Seduced by Secrets draws on secret files from the Stasi archives, includ- ing CIA-acquired material, interviews and friendships, court documents, and unusual visits to spy sites, including “breaking into” a prison, to demonstrate that the Stasi overestimated the power of secrets to solve problems and cre- ated an insular spy culture more intent on securing its power than protecting national security. It re-creates the Stasi’s secret world of technology through biographies of agents, defectors, and officers and by visualizing James Bond– like techniques and gadgets. In this highly original book, Kristie Macrakis adds a new dimension to our understanding of the East German Ministry for State Security by bringing the topic into the realm of espionage history and exiting politically charged commentary. Kristie Macrakis is a professor of the history of science at Michigan State University. She received her Ph.D. in the history of science from Harvard University in 1989 and then spent a postdoctoral year in Berlin, Germany. -

The Miscreants' Global Bust-Out: Preface | Deep Capture
4/12/2019 The Miscreants' Global Bust-Out: Preface | Deep Capture Home About Enter your search keywords Story of Deep Capture Michael Milken and Dendreon The Movie Mitchell Report AntiSocialMedia Data Archive Podcast Categorized | Featured Stories, The Deep Capture Campaign The Miscreants’ Global Bust-Out: Preface Posted on 28 April 2011 by Patrick Byrne “A bust-out is a scheme customarily employed by organized crime to deplete the assets of a legit imate business, thus forcing it into bankruptcy.” State of New Jersey Commission of Investigation 1988 Report, “Subversion By Organized Crime And Other Unscrupulous Elements of the Check Cashing Industry” “BUSTOUT: a confidence scheme in which an established business is taken over, a large stock of merchandise is purchased on credit and quickly sold, and the business is then abandoned or bankruptcy is declared.” – Merriam-Webster Dictionary Mark Mitchell has continued exploring the financial instability of the last four years, including the crash of 2008 and the Flash Crash of 2010. His conclusion is that various activities associated with market manipulation (e.g., naked short selling, high frequency trading, derivatives such as Credit Default Swaps and synthetic CDOs, sponsored access, regulatory capture, press manipulation) follow a familiar leverage-and-loot pattern and can be traced to a fairly cohesive network that includes Italian and Russian organized crime, Sunni extremist financiers with ties to Al Qaeda, the Russian FSB, the Albanian Mafia, agents of the Iranian regime, and close associates of Michael Milken. The result, “The Miscreants’ Global Bust-Out”, is 230 pages long. DeepCapture will be publishing it in approximately 25 installments over the coming weeks. -

A Tale of Gazoviki, Money and Greed
Source Stern magazine, September 13, 2007 Page 192 Section BUSINESS Author Hans-Martin Tillack A tale of gazoviki, money and greed Dubious methods and shady partners The managers of the Gazprom corporation are casting a network of front companies over Europe – but in whose interests? This is the story of an invasion. A massive campaign, planned well in advance. The General Staff is located far away in the east, in Moscow, the capital of Russia. The target area is Germany – and the rest of Western Europe. The invasion is about gas. But, even more, it is about large amounts of money. Large amounts of money for very few people. People who want above all to remain anonymous. This is the story of Gazprom, the Russian gas giant. With a market value of 180 billion euros – more than double that of Siemens – Gazprom is the biggest company in Europe and, at the same time, one of the least transparent. Indeed, Gazprom seems to have elevated concealment to the rank of a business principle. For former German Chancellor Gerhard Schröder (SPD) it was a “point of honor” to accept 250,000 euros a year for sitting on the shareholders’ committee of Gazprom’s subsidiary Nord Stream. According to Schröder it was in the interests “of our country and of Europe.” But the story of this invasion is teeming with ex-Stasi officers and shady figures. It is a story of letterbox companies that do not even have a letterbox, of companies nestled within companies. The overriding impression? That they are concealing flows of funds. -

Stasi, Gangster, Russenmafia? Wie Der Österreichische Investor Martin Schlaff Zum Milliardär Wurde Von Matthias Holland-Letz
SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Feature Stasi, Gangster, Russenmafia? Wie der österreichische Investor Martin Schlaff zum Milliardär wurde Von Matthias Holland-Letz Sendung: Mittwoch, 19. Oktober 2016 Redaktion: Wolfram Wessels Regie: Günter Maurer Produktion: SWR 2016 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Service: SWR2 Feature können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/feature.xml Mitschnitte aller Sendungen der Redaktion SWR2 Feature sind auf CD erhältlich beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden zum Preis von 12,50 Euro. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Bestellungen per E-Mail: [email protected] Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Bedrohlich klingende Musik. Peter Pilz, österreichischer Politiker: „Faktum ist, dass Martin Schlaff extrem gut vernetzt ist. Von dubiosen russischen und bulgarischen Kreisen bis rein in die Spitzen der österreichischen Politik und in polizeinahe Bereiche….“ Bedrohlich klingende Musik. Florian Scheuba, österreichischer Kabarettist: „Martin Schlaff ist eine faszinierende Gestalt, eine schillernde Figur, über die man sehr wenig weiß…“ Bedrohlich klingende Musik. Zitator 2: „Stasi, Gangster, Russenmafia? Wie der österreichische Investor Martin Schlaff zum Milliardär wurde.“ Sprecher: Ein Feature von Matthias Holland-Letz. -

Anfrage 1 Von 2
1167/7 XXIII . GP - Anfrage 1 von 2 1167/J XXIII. GP Eingelangt am 04 .07.2007 Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert . Abweichungen vom Original sind m&glich. Anfrage des Abgeordneten Dr. Martin Graf and anderer Abgeordneter an den Bundesminister Mr Inneres betreffend : Ausstellung eines Dienstpasses fur Mag . Martin Schlaff. Herrn Mag . Martin Schaff, geb. am 6.8 .1953 in Wien, wurde am 5 .4 .2000 mit Gultigkeit 4 .4.2000 ein Dienstpass mit der Nr . S0012547 ausgestellt. Das Bundesministerium fur Inneres (BMI), Generaldirektion f . d . Offentliche Sicherheit, Gruppe D - Interpol, Abt . H/8 - EDOK (MR Mag . Pretzner) teilte am 28 .2 .2000 dem Bundesministerium fur auswartige Angelegenheiten (BMAA) mit, dass im Zuge der Uberprufung von Mag . Martin Schlaff, geb. am 6.8.1953 in Wien, wegen Beihilfe zur Korruption von Herrn Moti Naftali - „Polizeidirektor and Reprasentant der israelischen Polizei in Deutschland” - beim BMI angefragt wurde, ob es den Tatsachen entspricht, ob Martin Schlaff einen osterreichischen Diplomatenpass besitze . Das BMI ersuchte das BMAA um Uberprufung and Verstandigung (ZI . 1 630 179/1-II/OC 02). Das BMAA erwiderte daraufhin am 16 .3.2000, dass Schlaff zwar keinen Diplomatenpass, wohl aber einen Dienstpass mit der Nr . S0003169 fuhre . Nach Nachfrage im eigenen Ministerium and weiterer Korrespondenz ubermittelte die Generaldirektion f. d . Offentliche Sicherheit, Gruppe D - Interpol, Abt . U/8 - EDOK (MR Mag. Pretzner) an den „Reprasentanten der israelischen Polizei in Deutschland” in Bonn die Information, dass die fur Dienstpasse zustandige Abteilung des Bundesministerium Mr Inneres mitteilte, dass fur Mag. Martin Schlaff am 5 .4 .2000 mit Gultigkeit 4.4 .2000 ein neuer Dienstpass mit der Nr. -
Public Bids and Squeeze-Outs in Germany
Public Bids and Squeeze-Outs in Germany A Statistical Survey (2002 – 2016) Public Bids and Squeeze-Outs in Germany A Statistical Survey (2002 – 2016) Preface For the past several years Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP has published legal and practical information regarding German public M&A transactions. For the new edition of this compilation, we have collected and analyzed information related to public bids and squeeze-outs in Germany from January 2002 through December 2016. The content of this Book is divided into three surveys: Survey I contains detailed information on 472 tender offers, takeover and/or mandatory offers launched under the Takeover Act, and includes, among other information, data on: — Bidder and target; — Amount and type of consideration; — Premium; — Conditions; — Position taken by the target management; and — Success of the bid. Survey II offers information on 145 exemptions from the obligation to make a mandatory bid in situations where control is gained over a target. Survey III presents data regarding 509 squeeze-outs of minority shareholders of German stock corporations. At the end of the Book we have included an index of all companies involved as bidder, applicant for an exemption, majority shareholder or target. In order to allow you to quickly find particular transactions or companies, you can search terms and names in this Book. For additional information on these search functionalities please see “Search Functionalities in this Book”. We hope this compilation of data will prove to be a useful resource regarding public bids and squeeze-outs in Germany. If you have any queries, please feel free to contact the undersigned or any of your regular contacts at Cleary Gottlieb. -

Download the Transcript
DEMOCRACY-2020/10/02 1 THE BROOKINGS INSTITUTION DISINFORMED DEMOCRACY: THE PAST, PRESENT, AND FUTURE OF INFORMATION WARFARE Washington, D.C. Friday, October 2, 2020 Welcoming Remarks: JOHN R. ALLEN President, The Brookings Institution Opening Conversation: How Disinformation Threatens World Order: KEYNOTE: H.R. McMASTER Fouad and Michelle Ajami Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University Former U.S. National Security Advisor MODERATOR: FIONA HILL Senior Fellow, Center on the United States and Europe The Brookings Institution Panel 1: The Road to Russian Interference in 2016: MODERATOR: FIONA HILL Senior Fellow, Center on the United States and Europe The Brookings Institution CATHERINE BELTON Special Correspondent, Reuters ARKADY OSTROVSKY Russia and Easter Europe Editor, The Economist THOMAS RID Professor of Strategic Studies Johns Hopkins School of Advanced International Studies DAVID SHIMER Global Fellow, Woodrow Wilson International Center for Scholars Associate Fellow, Yale University Panel 2: Domestic Drivers of Disinformation: MODERATOR: CHRIS MESEROLE Fellow and Deputy Director, Artificial Intelligence and Emerging Technology Initiative The Brookings Institution RENÉE DiRESTA Research Manager, Stanford Internet Observatory ANDERSON COURT REPORTING 1800 Diagonal Road, Suite 600 Alexandria, VA 22314 Phone (703) 519-7180 Fax (703) 519-7190 DEMOCRACY-2020/10/02 2 ELAINE KAMARCK Senior Fellow and Director, Center for Effective Public Management The Brookings Institution KATE STARBIRD Associate Professor, Human Centered Design & Engineering University of Washington Panel 3: Novel strategies for countering information warfare MODERATOR: FIONA HILL Senior Fellow, Center on the United States and Europe The Brookings Institution EILEEN DONAHOE Executive Director, Global Digital Policy Incubator, Stanford University Former U.S. Ambassador, United National Human Rights Council THOMAS KENT Adjunct Associate Professor of International and Public Affairs Columbia University DANIEL KIMMAGE Principal Deputy Coordinator, Global Engagement Center U.S. -

SHABTAI TZVI, LABOR ZIONISM and the HOLOCAUST by Barry Chamish
SHABTAI TZVI, LABOR ZIONISM AND THE HOLOCAUST by Barry Chamish CHAPTER ONE – DESTROYING YESHA ALM 1 - NAMING THE YESHA SPIES Poor deluded Israelis believe that the current moment of justice, when the government actually has freed the army to arrest their murderers, is a lasting trend. They will soon learn that the Oslo game is just on brief hold and the real goal of intimidating the Jewish residents of Yesha from their homes is merely on the backburner. Admittedly, the more perceptive see the signs. Two more Yesha rabbis have been murdered in the past month, Shapira and Dickstein, upping the total to about an even dozen in the past four years. And there is no denying that the murder of Rabbi Eliahu Shapira of Peduel wasn’t random terrorism. He was ambushed by a highly trained hit squad which possessed exact intelligence about his whereabouts. And another Arab girls’ school was bombed without deaths and again Jewish settler “extremists” were blamed. These same “extremists” blamed for similar school bombs in East Jerusalem and Tzur Bahr don’t exist. They are the creation of a group of Shabak officers, working hand in hand with the CIA and PLO, to remove Israel and its citizens from Yesha. And guess who the Israeli behind the plot is? Read on: CIA begins training Palestinian officers By Amira Hass, Ha’aretz 17 September 2002 “A training course for Palestinian Authority security officers got underway yesterday in Jericho. The course is being run by a team of security experts from the Central Intelligence Agency, Jordan and Egypt, and is taking place at the Intercontinental Hotel in Jericho.