Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption Der Nördlichen Oberpfalz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verkehrsmengenkarte 2010 Neustadt A. D. Waldnaab
St 2177 Wiedent St 2167 3719 TIR 28 13099 hof 3838 4 202 Emtmanns- 7 6141 6136 Seybothen- 9322 St 2121 6140 1 6137 6138 6139 Schönhaid 2 St 2167 BT 42 170 911 berg Frauen- 383 t 61419400 BT 18 Trevesen Voitenthan B 15 S Neuen- Ottmannsreuth Hauen- reuth 851 Ober- 61379552 reuth St 2169 Redenbach reuth dorf 61399404 61409702 BT 17 Göppmannsbühl St 2170 TIRSCHENREUTH Großkonreuth 1340 a.Berg bruck 3775 Muckenthal 61399103 509 B 22 Haidenaab T Trettmanns 3730 240 St 2665 IR 61399403 61409409 Göppmannsbühl 340 61389402 458 Zeulenreuth 61379554 61379555 2 8 St 2167 26 61369718 8 165 a.Bach Oberölschnitz Draisenfeld Schön- Frauenreuth St Bern- R 2989 6268 I St 2181 1465 2172 1056 8668 7144 T Godas fuß 18 dorf Eisersdorf TIR 4 Speichers- Haunritz 69 61399002 119 376 Lauterbach 541 St 2665 451 Neusteinreuth Unterölschnitz 53 Pfaben Friedenfels S St 2167 Matzers- t TIR 1 Dippers- Sägmühle 61379704 2 23692 Hohenwald Lohnsitz reuth Kirchenlaibach Wirbenz Kötzers- 1 61399703 reuth 61369452 7 B B dorf 61409413 0 BT 17 1 2 B 22 501 Seidlers- 3527 5 939 dorf St 2121 TIR 38 280 Birk Brüderes 61369719 KEMNATH reuth 61409101 2032 61409701 Laub Griesbach Eichschlag B 22 24 Gumpen 53 61389405 Boxdorf 94 61369450 310 Oberndorf Schönreuth 4962 431 715 Windischen- 61379123 Pirk St 2167 Tiefenthal B 22 2057 Gründlbach 40 3 812 115 1412 9 9085 Fortschau TIR 32 TIR 32 61389703 Klein- Lanken- Altenküns- St 2184 61389701 A laibach Selbitz Roslas Waldeck 113 reuth berg 61369449 94 Kuchen- Siegritz 1249 konreuth St 2184 904 61379253 St 2181 1419 St 2167 Unter- reuth -

LINIE 8438 Landkreis Neustadt an Der Waldnaab Schlammersdorf – Vorbach – Speinshart – Ausgabe Neustadt Am Kulm – Trabitz 2020 Bach Landkreis Neustadt an Der Waldnaab
BAXI LINIENPLAN www.new-baxi.de LINIE 8438 Landkreis Neustadt an der Waldnaab Schlammersdorf – Vorbach – Speinshart – Ausgabe Neustadt am Kulm – Trabitz 2020 Bach Landkreis Neustadt an der Waldnaab BEISPIEL 848 84 8440 84 841 Neustadt 842 an der aldnaab Landkreis Neustadt 84 84 8440 an der Waldnaab 84 844 LINIENPLAN Vrba Neustadt a ul 848 Windisesenba laersdr Trabit einsart 84 irendeenreut senba id ressat ersreut irentuba 8440 84 Neustadt trnstein 841 Schwarenba an der Waldnaab lssenbrg l rafenwr Parkstein Altenstadt an der Waldnaab ergenberg Teisseil Waldturn 842 antel irit etsriet leystein Waidaus irk 84 renriet Weieraer Etenrit Venstrau 84 Klberg Leutenberg 84 sba LueWildenau slarn DAS BAXI KURZ ERKLÄRT 844 Linie buchen Tnnesberg DIREKT VON A nach B 09602 637 9797 Die Fahrt bis zum jeweiligen Anmeldeschluss* buchen und kurz folgende vier Informationen Am Beispiel der Linie 8440, vom kleinen Ort Bach zum Landratsamt in angegeben: die Nummer der Linie, die gewünschte Fahrt gemäß Fahrplan, den Namen der Neustadt an der Waldnaab. Haltestelle, an der man einsteigen möchte und den Zielort. Das BAXI fährt nur die Haltestellen und Ortsteile an, für die eine Anmeldung vorliegt. So bringt einen das BAXI schnell, direkt und bequem zum Zielort. Einfach einsteigen Zur bestätigten Abfahrtszeit einfach an der vereinbarten Haltestelle einsteigen. Aussteigen können Sie innerhalb des angegebenen Zieles an jeder beliebigen Adresse – also auch direkt vor Ihrer Haustüre. Der Fahrpreis richtet sich nach dem Tarif Oberpfalz Nord (TON). Der TON Tarif kann im Internet unter www.ton-tarif.de ermittelt werden. Herausgeber Bequem ankommen Landratsamt Neustadt an der Waldnaab | Stadtplatz 38 | 92660 Neustadt an der Waldnaab Bequem und entspannt ankommen – so günstig wie ein Bus, so bequem wie ein Taxi. -

LINIE 8436 Landkreis Neustadt an Der Waldnaab Kohlberg – Mantel – Ausgabe Weiherhammer – Etzenricht 2020 Bach Landkreis Neustadt an Der Waldnaab
BAXI LINIENPLAN www.new-baxi.de LINIE 8436 Landkreis Neustadt an der Waldnaab Kohlberg – Mantel – Ausgabe Weiherhammer – Etzenricht 2020 Bach Landkreis Neustadt an der Waldnaab BEISPIEL 848 84 8440 84 841 Neustat 842 an er Walnaab Landkreis Neustadt 84 84 8440 an der Waldnaab 84 844 LINIENPLAN Vrba Neustadt a ul 848 Windisesenba laersdr Trabit einsart 84 irendeenreut senba id ressat ersreut irentuba 8440 84 Neustadt trnstein 841 Schwarenba an der Waldnaab lssenbrg l rafenwr Parkstein Altenstadt an der Waldnaab ergenberg Teisseil Waldturn 842 antel irit etsriet leystein Waidaus irk 84 renriet Weieraer Etenrit Venstrau 84 Klberg Leutenberg 84 sba LueWildenau slarn DAS BAXI KURZ ERKLÄRT 844 Linie buchen Tnnesberg DIREKT VON A nach B 09602 637 9797 Die Fahrt bis zum jeweiligen Anmeldeschluss* buchen und kurz folgende vier Informationen Am Beispiel der Linie 8440, vom kleinen Ort Bach zum Landratsamt in angegeben: die Nummer der Linie, die gewünschte Fahrt gemäß Fahrplan, den Namen der Neustadt an der Waldnaab. Haltestelle, an der man einsteigen möchte und den Zielort. Das BAXI fährt nur die Haltestellen und Ortsteile an, für die eine Anmeldung vorliegt. So bringt einen das BAXI schnell, direkt und bequem zum Zielort. Einfach einsteigen Zur bestätigten Abfahrtszeit einfach an der vereinbarten Haltestelle einsteigen. Aussteigen können Sie innerhalb des angegebenen Zieles an jeder beliebigen Adresse – also auch direkt vor Ihrer Haustüre. Der Fahrpreis richtet sich nach dem Tarif Oberpfalz Nord (TON). Der TON Tarif kann im Internet unter www.ton-tarif.de ermittelt werden. Herausgeber Bequem ankommen Landratsamt Neustadt an der Waldnaab | Stadtplatz 38 | 92660 Neustadt an der Waldnaab Bequem und entspannt ankommen – so günstig wie ein Bus, so bequem wie ein Taxi. -

Der Landkreis Neustadt an Der Waldnaab Und Seine Gemeinden Kliniken Nordoberpfalz AG Ihr Starker Gesundheitspartner in Der Region
Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab und seine Gemeinden Kliniken Nordoberpfalz AG Ihr starker Gesundheitspartner in der Region www.kliniken-nordoberpfalz.ag Vorwort des Landrats 1 Herzlich willkommen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab! Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen unseren Die hohe Lebensqualität in unserem Landkreis Landkreis Neustadt an der Waldnaab näher vor- bestimmen aber vor allem die Menschen, die hier stellen und Ihnen eine Reihe von interessanten und das gesellschaftliche Leben prägen und das gute hilfreichen Informationen mit an die Hand geben. Miteinander ausmachen. Das vorbildliche bür- gerschaftliche Engagement, sei es in Vereinen, Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab besteht Organisationen oder sonstigen Gruppierungen, aus 38 Gemeinden und erstreckt sich quer über die ist die Grundlage für das Gemeinschaftsleben im nördliche Oberpfalz. Von Kirchenthumbach im Wes- Landkreis NEW. ten bis Eslarn im östlichen Landkreis bietet unsere Region ein vielfältiges Angebot, um ein angeneh- Ich wünsche Ihnen eine informative und unterhalt- mes Leben führen zu können. Wir haben uns vom same Entdeckungstour auf den nachfolgenden Sei- „Armenhaus“ und „Zonenrandgebiet“ zur wirtschaft- ten dieser Broschüre durch unseren Landkreis und lichen Lokomotive in der Mitte Europas mit vielen unsere Städte, Märkte und Gemeinden. „Global Playern“ entwickelt. Eine der großen Stärken des Landkreises Neustadt Ihr an der Waldnaab ist es, dass bei uns abseits der überfüllten Ballungsräume zahlreiche interessante Arbeitsplätze vorhanden sind und bezahlbares Woh- nen möglich ist. Daneben bietet NEW eine hervor- ragend ausgebaute Infrastruktur, gute medizinische Versorgung, ein breites Bildungsangebot, schnelles Internet sowie einen bunten Mix an Kultur- und Frei- zeitmöglichkeiten. Wir erleben gerade eine „Renais- Andreas Meier sance des Landlebens“. -
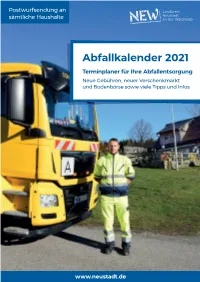
Abfallkalender 2021 Terminplaner Für Ihre Abfallentsorgung Neue Gebühren, Neuer Verschenkmarkt Und Bodenbörse Sowie Viele Tipps Und Infos
Postwurfsendung an sämtliche Haushalte Abfallkalender 2021 Terminplaner für Ihre Abfallentsorgung Neue Gebühren, neuer Verschenkmarkt und Bodenbörse sowie viele Tipps und Infos www.neustadt.de 1 Neustadt a. d. Waldnaab, im November 2020 Inhalte Branchenverzeichnis von A bis Z Hier finden Sie auf den genannten Seiten Inserate von Betrieben der Entsorgungsbranche. Diese Unternehmen tragen zur Realisierung des Abfallkalenders bei. wie in den vergangenen Jahren abschließen können. Ge- regelte, professionell organisierte und umweltgerechte Entsorgung kostet nun einmal auch zunehmend Geld! Wir liegen aber mit den Gebühren im Vergleich zu Thema Seite Thema Seite anderen Gebietskörperschaften immer noch auf einem moderaten Niveau. Zudem ist die Entsorgung eben nicht Abfall-ABC 20-29 Abbrüche 8 oben , 8 unten, 14u., 32 mehr ein einfaches Abholen und Ablagern, sondern eine Abfall-App 20 Akten- und Datenvernichtung 32 moderne Kreislaufwirtschaft, bei der die Abfälle je nach Anbieterverzeichnis 2 Altöl 12, 32 Verwertungsmöglichkeiten und Gefährlichkeit zu entsor- Ansprechpartner 5 Altreifen 7 u., 12, 14 u., 32 gen sind. Asbestabbau 8 o. Bauschutt 8 Auffüllmaterial 8 o., 14 u., 32 Ein gutes Beispiel ist das Müllkraftwerk Schwandorf, das Biotonne 36-37 Autobatterieentsorgung 5, 12, 32 Blaue Papiertonne 4, 33 seit über 38 Jahren in Betrieb ist und aus dem Rest- Autoteile (gebrauchte) 5, 32 müll des Verbandsgebietes jährlich 170.000 MWh Strom Bodenbörse 17 Autoverwertung 5, 14 u., 32 Branchenverzeichnis 2 erzeugt. Damit lassen sich über 83.000 Menschen mit Bauschutt 7 u., 8 o., 8 u., 12, 14 u., 32 Elektrizität versorgen. Mit dieser Energienutzung werden Deponie 8 Blaue Papiertonne 4, 12, 32, 33 jährlich 139 Millionen Liter Öl eingespart, was Treibhaus- Duale Systeme 31-32 gasemissionen von 8,25 Millionen Tonnen CO2-Äquiva- Containerdienste 7 u., 8 o., 11, 12, 14 o., 14 u., 32 Elektroschrott 18-19 lenten im Zeitraum von 1982 bis 2018 entspricht. -

Gernland-Nr3.Pdf
Nr. 3 Kost nix! Kost - Lesegenuss Gschichtn Schwärmen für die Königin Seite 12 Das fl iegende Fleisch Seite 16 Beschwipste Früchtchen Seite 36 2018 Herbst GLOSSAR Nr.Winter 3 Impressum Liebe Leserin, Herausgeber des Magazins Konzept, Redaktion, Grafik/Urheber Landkreis Neustadt an der Waldnaab Stadtplatz 38 lieber Leser, 92660 Neustadt an der Waldnaab Verantwortlich im Sinne des Presserechts Andreas Meier ich darf Ihnen heute die dritte Bei dieser Gelegenheit möchten wir Landrat KREATIVMALEINS Ausgabe unseres Regionalmagazins Ihnen auch unsere neue Marke „Denk Redaktionelle Mitarbeit Agentur für Marketing & Kommunikation „Gern.Land!“ vorstellen. Mit „Gern.Land!“ mal NEW“ näher bringen. Mit dieser Landkreis Neustadt an der Waldnaab Inh. F. Schläger wollen wir die Werbetrommel für Kampagne zeigen wir, dass wir das Barbara Mädl, Hannes Gilch, Claudia Prößl, Bernd Stengl Zu den Straßäckern 2 92637 Weiden unsere lokalen Direktvermarkter Landleben „neu denken“ und dass Agentur KREATIVMALEINS www.kreativmaleins.de rühren und so auch einer breiteren wir in der Nordoberpfalz, im Land- Florian Schläger, Silvia Kaiser-Schläger Öffentlichkeit vorstellen. kreis Neustadt an der Waldnaab, Art Direction sehr gut und gerne leben. Die neue Recht Florian Schläger Alle Rechte beim Herausgeber. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Auf- Die von unseren Direktvermarktern im Ausgabe steht daher unter dem Motto nahme in Onlinedienste sowie Internet und Vervielfältigungen auf Daten- Redaktion Landkreis Neustadt an der Waldnaab „NEW Lesegenuss“. träger wie z.B. CD-ROM, USB Sticks etc. nur nach vorheriger schritlicher Silvia Kaiser-Schläger mit viel Herzblut und Leidenschaft Zustimmung des Herausgebers und Urhebers. Druck hergestellten Produkte überzeugen Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann für die Richtigkeit nicht gehaf- SPINTLER Druck und Verlag GmbH vor allem durch ihre herausragen- kulinarischen und spannenden Ent- tet werden. -

Gemeinde Irchenrieth
# # # # # # # # #### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Erdkabelleitung SuedOstLink# # # # Verlauf der Grobtrassierung# – Gemeinde Irchenrieth # # # │ │ # # # # # # # # # # # # # # │ │ # # # # # # N │ # 0 500 1.000 # # │ Gemeindegebiet # # # Meter Bechtsrieth # # # # # # # # # # # # # # # # # Gemeindegebiet # Gemeindegrenzen # # # Schirmitz # # # # # # Trassenvorschlag # # # # # # # # # Trassenalternative # # # # # # Geschlossene Querung #### # # # # # # # # Trassenkorridor §8 NABEG # # # # # # # # # # Gasleitung (Bestand) # # # # # # # Wasserschutzgebiet Zone I und II # # # # # ## # # # # ## Wasserschutzgebiet Zone III ## # ## ## ## Schutzgebiet ## 1 Fauna-Flora-Habitat (FFH) ## ## # # # # # # # # # # ## │ EU-Vogelschutzgebiet ## │ ## ## # ## ## # Naturschutzgebiet ## # ## # # Bauleitplanung (FNP) # # Bauleitplanung (BP) # ## # # # # # # # # # # # # Gemeindegebiet # # # Irchenrieth # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## # # # # # # Gemeindegebiet # # # # # Pirk # # # # # # # # # # # │ │# │ # │ # # # # # # # # # # # 4 # # # # # # ## # 2 # # ## # # # # # # # ## # ## # # # # ## # 3 ## # ## # ## # ## # ## # ## │ │ # ## ## # ## │ # ## # ## # │## # ## # ## # # # # # # ## # ## ## ## # ## ## ## ## # # ## # # # # Sämtliche Informationen der Karte können sie detailliert unserem öffentlich zugänglichen WebGIS entnehmen: https://gis.arcadis.nl/age_prod/SuedOstLink# # Gasleitung (Bestand) 0 # 500 1.000 Darstellung des Gemeindegebiets # Meter # Wasserschutzgebiet -

Bayerisches Gesetz- Und Verordnungsblatt Nr. 8-2021
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 8/2021 211 Anhang (zu § 1 Nr. 14) Anlage 1 (zu § 1) Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer – Gebietsstand: 1. Januar 2021 – Amtlicher Amtlicher Gemeinde- Gemeindename Schlüsselzahl Gemeinde- Gemeindename Schlüsselzahl schlüssel schlüssel Regierungsbezirk Oberbayern 172 115 Bayerisch Gmain 0,0002078 172 116 Berchtesgaden, M 0,0004958 Kreisfreie Städte 172 117 Bischofswiesen 0,0004739 161 000 Ingolstadt 0,0120833 172 118 Freilassing, St 0,0009694 162 000 München, Landeshauptstadt 0,1450550 172 122 Laufen, St 0,0004276 163 000 Rosenheim 0,0046252 172 124 Marktschellenberg, M 0,0001072 172 128 Piding 0,0003598 Landkreis Altötting 172 129 Ramsau b.Berchtesgaden 0,0000959 171 111 Altötting, St 0,0008053 172 130 Saaldorf-Surheim 0,0003732 171 112 Burghausen, St 0,0014808 172 131 Schneizlreuth 0,0000900 171 113 Burgkirchen a.d.Alz 0,0006683 172 132 Schönau a.Königssee 0,0003569 171 114 Emmerting 0,0003366 172 134 Teisendorf, M 0,0006141 171 115 Erlbach 0,0000785 171 116 Feichten a.d.Alz 0,0000961 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 171 117 Garching a.d.Alz 0,0005643 173 111 Bad Heilbrunn 0,0003211 171 118 Haiming 0,0002164 173 112 Bad Tölz, St 0,0013921 171 119 Halsbach 0,0000802 173 113 Benediktbeuern 0,0003085 171 121 Kastl 0,0002315 173 115 Bichl 0,0001900 171 122 Kirchweidach 0,0001994 173 118 Dietramszell 0,0004690 171 123 Marktl, M 0,0002121 173 120 Egling 0,0004845 171 124 Mehring 0,0002176 173 123 Eurasburg 0,0004178 171 125 Neuötting, St 0,0005483 173 124 -

Verkehrsmengenkarte 2005 Neustadt A. D. Waldnaab
94 hof 6141 194 4 7 61419400 1 6140 2 2 611 t 1 S Redenbach t 2 6139 Schönhaid150 B 167 1851 T S St 2 7 77 1 t 21 IR 5 Großkonreuth T S 2 6138 Frauen- Voitenthan 9 6 B 8 1 TIRSCHENREUTH 109 6137 Trevesen reuth 2 S 61399404 266 t t 7250 S 2 Emtmanns- B 1 6136 Seybothen- T 61379552 7 Ober- Muckenthal 4 5 0 4684 St berg 2 6 ut 524 6 Frauenreuth 2 Hauen- re h 2 Trettmanns 1 Neuen- Ottmannsreuth Göppmannsbühl bruck t 4120 61389402 7 7 dorf S 195 6 TIR 4 2 reuth 21 a.Berg Haidenaab Schön- t Lauterbach 352 T 1762 S 8 B 22 61379555 I BT Göppmannsbühl 61379554 R fuß 61409409 R 7 Matzers- 1 S 61369718 I 61399002 6 Dippers- 7 2 1 Zeulenreuth a.Bach t t 2 TIR Bern- T 8 Godas S 2 135 Sägmühle Lohnsitz 1 reuth 7821 S 1 6139 reuth 7612 t 8 Hohenwald Draisenfeld 972 dorf Eisersdorf 2 Oberölschnitz 1 24837 1 Pfaben Friedenfels B Haunritz 2 17 576 Neusteinreuth 1 1 295 Laub 641 2 0 Griesbach 5 Speichers- 43 5 t 3570 6 S 26 Seidlers- T t IR 3 61409413 Unterölschnitz 2 Wirbenz S reuth 8 B 2 Kötzers- dorf Gumpen 3 61399403 61409101 Kirchenlaibach 9 7 61369449 6 1865 Gründlbach KEMNATH A 1 B B dorf Pirk 2 T Boxdorf t 3308 4214 17 61389405 2 61369719 S Klein- Birk B2318rüderes B T 258 2 Schönreuth I 2 R 495 konreuth Eichschlag Oberndorf 2119 200 281 3 95 61379123 2 84 61369450 R 32 Asch Windischen- 21 TI T t 100 S Brunn I S 41 Fortschau B 22 Siegritz t 2167 R Tiefenthal 6633 k 61379253 Marchaney 1413 Waldec St 61399405 1 Roslas Kuchen- 2181 St 2 Lodermühl Selbitz Wetzldorf 170 Falkenberg Altenküns- laibach 543 4886 299 Lanken- 42 reuth Bingarten TI Kohlbühl -

Verzeichnis Der Angehörigen Gemeinden Des Landkreises Neustadt A.D.Waldnaab
VERZEICHNIS DER ANGEHÖRIGEN GEMEINDEN DES LANDKREISES NEUSTADT A.D.WALDNAAB Gemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab Hausanschrift: Hauptstr. 6 92665 Altenstadt a.d.Waldnaab Telefon: 09602 6331 0 Fax: 09602 6331 44 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: http://www.altenstadt-waldnaab.de Gemeinde Bechtsrieth Hausanschrift: Hauptstr. 29 92699 Bechtsrieth Telefon: 0961 418000 Fax: 0961 48116 66 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: http://www.bechtsrieth.de Gemeinde Etzenricht Hausanschrift: Weidener Straße 14 92694 Etzenricht Telefon: 0961 42557 Fax: 0961 4161765 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: http://www.etzenricht.de Gemeinde Flossenbürg Hausanschrift: Hohenstaufenstr. 24 92696 Flossenbürg Telefon: 9603 9206 0 Fax: 9603 9206 25 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: http://www.flossenbuerg.de Gemeinde Georgenberg Hausanschrift: Flossenbürger Straße 1 92697 Georgenberg Telefon: 09658 338 Fax: 09658 1258 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: http://www.georgenberg.de VERZEICHNIS DER ANGEHÖRIGEN GEMEINDEN DES LANDKREISES NEUSTADT A.D.WALDNAAB Gemeinde Irchenrieth Hausanschrift: Landrat-Christian-Kreuzer-Str. 6 92699 Irchenrieth Telefon: 09659 772 Fax: 09659 649 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: http://www.irchenrieth.de Gemeinde Kirchendemenreuth Hausanschrift: Kirchendemenreuth 28 92665 Kirchendemenreuth Telefon: 09602 9430 0 Fax: 09602 9430 45 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: http://www.kirchendemenreuth.de Gemeinde Pirk Hausanschrift: Rathausplatz 4 92712 Pirk Telefon: 0961 42336 Fax: 0961 419186 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: http://www.gemeinde-pirk.de Gemeinde Püchersreuth Hausanschrift: Hauptstraße 5 92715 Püchersreuth Telefon: 09602 94300 Fax: 09602 9430 45 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: Gemeinde Schirmitz Hausanschrift: Hauptstr. -

2015 Im Überblick Jahresschrift Der Praemonstratenserabtei Speinshart 2015 Im Überblick Jahresschrift Der Praemonstratenserabtei Speinshart
8. Ausgabe 2015 im Überblick Jahresschrift der Praemonstratenserabtei Speinshart 2015 im Überblick Jahresschrift der Praemonstratenserabtei Speinshart Inhalt Ein Seelsorger mit Herz ............................................. 4 Konzerte im Kloster Speinshart .................................. 16 Zum Tod von Pater Emmanuel Hermann Breunig Neue Akzente bei den Speinsharter Konzerten Wolfgangsmedaille für Georg Girisch ........................ 6 Friedvolle Begegnung der Nationen .......................... 18 Auszeichnung für den Vorsitzenden des Fördervereins Sommerkonzerte 2015: Kultur schafft Frieden Barbara Stamm zu Gast beim Lichtmess-Empfang ..... 7 Nimm mich an nach deinem Wort ............................. 20 Gemeinde und Kloster begrüßen Landtagspräsidentin Frater Johannes Bosco legt seine feierliche Profess ab Ausstellungen im Oberen Konventgang ..................... 8 Baustelle Kloster ........................................................ 22 Skulpturen, Malerei und Photographie Der letzte Bauabschnitt läuft Fernsehgottesdienst an Fronleichnam ....................... 10 Barocktage Speinshart................................................ 23 Aus dem Klosterdorf in die deutschen Wohnzimmer Das neue Musikfestival im Kloster Ausstellungen im Kreuzgang ..................................... 11 Das Kloster virtuell erkunden .................................... 24 Zwei unterschiedliche Wanderausstellungen Panoramaaufnahmen des Klosters von S&D Spitzen-Tech Norbertusfest in Speinshart ....................................... 12 Der Geschichte -

Stories Winter FORSTER ORGANIC BAKERY Baking Food for the Soul
FOR FREE! FOR Landkreis Neustadt an der Waldnaab Stadtplatz 38 92660 Neustadt an der Waldnaab Tel.: 09602 79 - 0 Fax: 09602 79 - 1166 E-Mail: [email protected] www.neustadt.de Autumn Stories Winter FORSTER ORGANIC BAKERY Baking food for the soul RAUNETBACHTAL ALPACAS Easy to care for. Snug and cozy. Extraordinary. gefördert durch PRESSATH‘S TANNENLAND If only trees could talk CONTAINS A SUPPLIER DIRECTORY AND RECIPES A SUPPLIER DIRECTORY CONTAINS GLOSSARY Autumn Winter Impressum Magazine publishers Concept, Editorial Department, Art Design/Creator Landkreis Neustadt an der Waldnaab Stadtplatz 38 92660 Neustadt an der Waldnaab Responsible editor for the purposes of German media law Andreas Meier Dear reader, Landrat KREATIVMALEINS Agentur für Marketing & Kommunikation Editorial Collaboration Inh. F. Schläger Landkreis Neustadt an der Waldnaab Zu den Straßäckern 2 Barbara Mädl, Hannes Gilch, Claudia Prößl 92637 Weiden www.kreativmaleins.de Agentur KREATIVMALEINS Florian Schläger, Silvia Kaiser-Schläger Art Direction Florian Schläger The premiere issue of our „Gern.Land!“ re- I was, and I wish all of them plenty of enter- Legal All rights reserved by the publisher. All rights reserved. Reprints, inclusion in online Editorial Department gional magazine was published in early sum- taining and learning moments. services and the Internet, and reproductions on data storage media such as CD-ROM, Silvia Kaiser-Schläger mer of this year. USB flash drives, etc., are only permitted with the prior written consent of the publisher and the author. Illustration/Collaboration Jenny Kunz Once again, please allow me to extend my Despite careful selection of the sources, no liability will be accepted for their accuracy.