Die Natürliche Entwicklung Der Ostfriesischen Inseln. Von H
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Einfluß Der Kaninchenbeweidung Auf Die Vegetation Am Beispiel Des Straußgras-Dünenrasens Der Ostfriesischen Inseln
Tierarztliche Praxis ISSN NO: 0303-6286 Tuexenia 9 : 283-291. Göttingen 1989. Der Einfluß der Kaninchenbeweidung auf die Vegetation am Beispiel des Straußgras-Dünenrasens der Ostfriesischen Inseln - Karl Kiffe - Zusammenfassung Am Beispiel des Straußgras-Dünenrasens (Agrostio tennis - Poetum humilis, Koelerion albescentis) der Ostfriesischen Inseln wird der Einfluß des Wildkaninchens (Oryctolagus cuniculus L.) auf die Vegetation untersucht. Da Kaninchen nur auf vier der sieben großen Inseln Vorkommen, konnte die Assoziation unter sonst gleichen ökologischen Bedingungen in einer von Kaninchen nicht beweideten bzw. in einer beweide- ten Ausbildung untersucht werden. Ein Vergleich der beweideten und unbeweideten Probeflächen erbrachte folgende Resultate: 1. Die nicht von Kaninchen beweideten Flächen werden durch eine Reihe meist auffällig blühender, aus dauernder Phanerogamen gekennzeichnet: Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, H ieracium umbella- tum, Anthoxanthum odoratum, Jasione montana, Stellaria gramínea, Plantago lanceolata, Trifolium ar- vense u.a. 2. In stark von Kaninchen beweideten Flächen fehlen die oben genannten Arten fast vollständig. Die Va riante wird durch das vermehrte Auftreten von Brachythecium albicans, Ceratodon purpureus, Cladonia chlorophaea agg., Comicularia aculeata, Cerastium semidecandrum, Rubus caesius u.a. Arten charakteri siert. 3. Zwischen der „blumenreichen“ und der „blumenarmen“ Variarne der Assoziation vermittelt eine Ausbildung mit beiden Differentialartengruppen; sie treten jedoch jeweils mit nur geringer Stetigkeit auf. Diese intermediäre Ausbildung wurde stets in der Nähe von Kulturland gefunden. Die Kaninchen legen ihre Bauten zwar überwiegend in den Dünen an, sie suchen ihre Nahrung jedoch bevorzugt in den angren zenden Wiesen, Weiden oder Gärten. A bstract The influence of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) on vegetation is analysed in an Agrostio tenuis - Poëtum humilis (Koelerion albescentis) of the East Frisian Islands. -
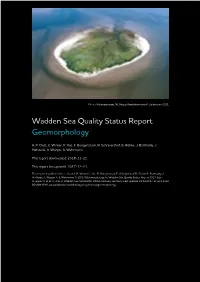
Wadden Sea Quality Status Report Geomorphology
Photo: Rijkswaterstaat, NL (https://beeldbank.rws.nl). Zuiderduin 2011. Wadden Sea Quality Status Report Geomorphology A. P. Oost, C. Winter, P. Vos, F. Bungenstock, R. Schrijvershof, B. Röbke, J. Bartholdy, J. Hofstede, A. Wurpts, A. Wehrmann This report downloaded: 2018-11-23. This report last updated: 2017-12-21. This report should be cited as: Oost A. P., Winter C., Vos P., Bungenstock F., Schrijvershof R., Röbke B., Bartholdy J., Hofstede J., Wurpts A. & Wehrmann A. (2017) Geomorphology. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. Eds.: Kloepper S. et al., Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. Last updated 21.12.2017. Downloaded DD.MM.YYYY. qsr.waddensea-worldheritage.org/reports/geomorphology 1. Introduction The hydro- and morphodynamic processes of the Wadden Sea form the foundation for the ecological, cultural and economic development of the area. Its extraordinary ecosystems, its physical and geographical values and being an outstanding example of representing major stages of the earth’s history are factors why the Wadden Sea received a World Heritage area qualification (UNESCO, 2016). During its existence, the Wadden Sea has been a dynamic tidal system in which the geomorphology of the landscape continuously changed. Driving factors of the morphological changes have been: Holocene sea-level rise, geometry of the Pleistocene surface, development of accommodation space for sedimentation, sediment transport mechanisms (tides and wind) and, the relatively recent, strong human interference in the landscape. In this report new insights into the morphology of the trilateral Wadden Sea gained since the Quality Status Report (QSR) in 2009 (Wiersma et al., 2009) are discussed. After a summary of the Holocene development (sub-section 2.1), the sand-sharing inlet system approach as a building block for understanding the morhodynamic functioning of the system with a special emphasis on the backbarrier (sub-section 2.2) is discussed, followed by other parts of the inlet-system. -

The Cultural Heritage of the Wadden Sea
The Cultural Heritage of the Wadden Sea 1. Overview Name: Wadden Sea Delimitation: Between the Zeegat van Texel (i.e. Marsdiep, 52° 59´N, 4° 44´E) in the west, and Blåvands Huk in the north-east. On its seaward side it is bordered by the West, East and North Frisian Islands, the Danish Islands of Fanø, Rømø and Mandø and the North Sea. Its landward border is formed by embankments along the Dutch provinces of North- Holland, Friesland and Groningen, the German state of Lower Saxony and southern Denmark and Schleswig-Holstein. Size: Approx. 12,500 square km. Location-map: Borders from west to east the southern mainland-shore of the North Sea in Western Europe. Origin of name: ‘Wad’, ‘watt’ or ‘vad’ meaning a ford or shallow place. This is presumably derives from the fact that it is possible to cross by foot large areas of this sea during the ebb-tides (comparable to Latin vadum, vado, a fordable sea or lake). Relationship/similarities with other cultural entities: Has a direct relationship with the Frisian Islands and the western Danish islands and the coast of the Netherlands, Lower Saxony, Schleswig-Holstein and south Denmark. Characteristic elements and ensembles: The Wadden Sea is a tidal-flat area and as such the largest of its kind in Europe. A tidal-flat area is a relatively wide area (for the most part separated from the open sea – North Sea ̶ by a chain of barrier- islands, the Frisian Islands) which is for the greater part covered by seawater at high tides but uncovered at low tides. -

Wetenschappelijk Jaaroverzicht 2015
www.catharinaziekenhuis.nl Wetenschappelijk Jaaroverzicht 2015 Onder redactie van: JMAH Jansen E Looije J Verhallen ATM Dierick-van Daele L van Coppenolle Een uitgave van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, 2016 © niets van deze uitgave mag worden gekopieerd zonder toestemming van de uitgever. 2 Inhoudsopgave Algemeen Klinisch Laboratorium 5 Anesthesiologie 11 Apotheek 19 Cardiologie 23 Cardiothoracale Chirurgie 54 Chirurgie 65 Dermatologie 163 Fysiotherapie 171 Gynaecologie 173 ICMT 187 Intensive Care 189 Inwendige geneeskunde 192 Kindergeneeskunde 206 Klinische Fysica 212 Kwaliteit 219 Longgeneeskunde 222 Maag, darm, leverziekten 231 Medische Psychologie 241 Mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie 244 Neurologie 246 Nucleaire Geneeskunde 251 Onderwijs & Onderzoek 254 Operatiekamers 258 Orthopedie 260 Pamm 264 Plastische Chirurgie 270 Radiologie 273 Radiotherapie 283 Spoedeisende hulp 291 Urologie 293 Boeken 298 Promoties 301 Wetenschapsavond 2015 Catharina Ziekenhuis 305 Tabellen 330 Auteursindex 337 3 Scientific advancement should aim to affirm and to improve human life Nathan Deal (1942) Nathan Deal. (n.d.). BrainyQuote.com. Retrieved April 6, 2016, from BrainyQuote.com Web site: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/n/nathandeal342936.html 4 Algemeen Klinisch Laboratorium 5 Berkel M van Beslisondersteuning is meer dan een algoritme: heparinepomp-protocol op de Intensive Care Boer AK*, Kreeftenberg H*, Bindels A*, Roos A*, Houterman S*, Korsten E*, van Dijk- van Berkel M* Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2015; 40(3): 211-2 geen abstract beschikbaar impactfactor: -- Boer AK Beslisondersteuning is meer dan een algoritme: heparinepomp-protocol op de Intensive Care Boer AK*, Kreeftenberg H*, Bindels A*, Roos A*, Houterman S*, Korsten E*, van Dijk- van Berkel M* Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2015; 40(3): 211-2 geen abstract beschikbaar impactfactor: -- Boer AK Cut-off values to rule out urinary tract infection should be gender-specific Geerts N*, Boonen KJ, Boer AK*, Scharnhorst V* Clin Chim Acta. -
Eco-Morphodynamic Processes in the Rhine-Meuse-Scheldt Delta and the Dutch Wadden Sea
Eco-morphodynamic processes in the Rhine- Z2827 March, 2001 Meuse Scheldt Delta Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea J. de Brouwer NIOO-CEMO A. Crosato WLI Delft Hydraulics N. Dankers Alterra W. van Duin Alterra P.M.J. Herman NIOO-CEMO W. van Raaphorst NIOZ M.J.F. Stive WL I Delft Hydraulics A.M. Talmon WL I Delft Hydraulics H. Verbeek RWS/RIKZ M.B. de Vries WL I Delft Hydraulics M. van der Wegen IHE J.C. WinterwerpWL Delft Hydraulics March, 2001 Same n vatti ng Eco-morphodynamic processes in the Rhine- Z2827 March, 2001 Meuse Scheldt Delta Contents Samenvatting iii 1 Introduction.................................................................................................................. 1-1 1.1 Aim of the project ...............................................................................................1-1 1.2 Present status ....................................................................................................... 1-1 2 Managerial questions and strategies.......................................................................2-1 2.1 Strategy plans ...................................................................................................... 2-1 2.1.1 Delta area................................................................................................2-1 2.1.2 Wadden Sea ........................................................................................... 2-1 2.1.3 Other policy documents .......................................................................2-2 -

Die Küste, 32 (1978), 84-93
Die Küste, 32 (1978), 84-93 Inseln vordersudlichen Nordseekuste Von Gunter Luck Der zwischen dem Astuar der Ems und der Jade gelegenen ostfriesischen Kiiste sind die sieben Duneninseln Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge sowie drei Strandinseln Lurje Hdrn, Memmert und Minsener Oog vor- gelagert. Vom Festland sind sie getrennt durch Wattgebiete wechselnder Ausdehnung, die bei Niedrigwasser trocken fallen und bei Hochwasser uberflutet sind. Die sich von Westen nach Osten erstreckende Inselkette ist durchbrochen von den Seegaten Osterems, Norderneyer Seegat, Wichter Ee, Accumer Ee, Otzumer Balje, Harle und Blaue Balje. In den Seegaten vollzieht sich der Wasseraustausch zwischen den Watt- gebieten und der offenen See. Die Gesamtausdehnung der Inselkette von Borkum-West bis Minsener Oog-Ost betrigt rd. 90 kni. In ihrer Lage zueinander sind die Inseln von Siiden nach Norden gestaffelt, und Wangerooge ist rd. 20 km n6rdlicher als Borkum gelegen. Die derzeitige Ausdehnung der Inseln und ihre Flichen sind in Tabelle 1 zusam- mengestellt. Das Klima ist - wie an der gesamten Nordseekiiste - mit kuhlen Sommern und ziemlich warmen Wintern marin geprigt. Infolge h ufiger Starkwindiagen mit ki*fliger Brandung ist der Aerosol-Gehalt der Luti besonders hoch, worauf der thera- peutisclie Effekt des Inselklimas fur Bronchialerkrankungen zuruckzufuhren ist. Die Vegetation der Inseln setzt sicti wesentlich aus salzvertrtglichen Pflanzen zu- sammen. Wegen des geringen Nahrungsangebotes ist die urspriinglidie Fauna verhiltnis- mittig artenarm. Lediglich die Avifauna ist, insbesondere wegen des Aufenthaltes durdi- ziehender V6gel, selir artenreich. Infolge karger Erwerbsmbglichkeiten waren die Inseln ursprtinglich nur schwach besiedelt (Tab. 2). Erst nachdem die klimatherapeutischen Wirkungen des Seeklimas erkannt waren und sie als Erholungsgebiere Bedeutung erlangten, stiegen die Einwohner- zahlen stetig an. -

Generalplan Küstenschutz Ostfriesische Inseln
Generalplan Küstenschutz Niedersachsen - Ostfriesische Inseln Herausgeber: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Am Sportplatz 23 26506 Norden Mai 2010 Internet: www.nlwkn.niedersachsen.de Vertrieb: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz -Direktion- Am Sportplatz 23 26506 Norden [email protected] 2 Generalplan Küstenschutz Niedersachsen - Ostfriesische Inseln Liebe Leserinnen und Leser wir ein Vorsorgemaß von 50 cm für den Mee- des Generalplans Inselschutz, resspiegelanstieg der kommenden 100 Jahre und zukünftige Auswirkungen des Klimawan- die schweren Sturmfluten von November dels. Massive Bauwerke in der Deichlinie wie 2006 und November 2007 mit Höchstwasser- Siele oder Schöpfwerke werden zudem so aus- ständen von 2,55 Meter über dem normalen gelegt, dass eine Nacherhöhung insgesamt von Tidehochwasser am Pegel Norderney haben es bis zu einem Meter möglich ist. wieder einmal deutlich gemacht: Küstenschutz und Inselschutz hat höchste Priorität. Für die sandigen Küsten der Ostfriesischen Inseln werden die Belastungen in Folge des Bereits 2007 haben wir den Generalplan Kü- Klimawandels langfristig zunehmen: Als Schutz stenschutz für das Festland vorgelegt, darauf vor Erosion werden deshalb Sandaufspülungen aufbauend ist nun der Generalplan für die Inseln als naturnahe Maßnahme des Küstenschutzes fertig gestellt. Wir geben ihn hiermit allen Inter- zukünftig an Bedeutung gewinnen. Hierfür wer- essierten und insbesondere den Bewohnern der den auch Sandentnahmen aus dem Küstenvor- Ostfriesischen Inseln an die Hand. feld erforderlich sein, die Priorität vor anderen Fest steht: Die Ostfriesischen Inseln sind Nutzungen haben müssen. einmalig. Deshalb ist der Schutz der sieben Angesichts der auf absehbare Zeit knappen dauerhaft bewohnten Inseln vor Sturmfluten, die öffentlichen Haushalte ist dabei auch eine mög- Sicherung ihres Bestandes und damit der Hei- lichst wirtschaftliche und inselnahe Kleibeschaf- mat ihrer Bewohner zwingend erforderlich. -

Weather and Natural Catastrophes in Medieval and Early Modern Europe: Storms, Floods, Fires, Earthquakes, and Pandemics
Humanities and Social Science Research; Vol. 4, No. 3; 2021 ISSN 2576-3024 E-ISSN 2576-3032 https://doi.org/10.30560/hssr.v4n3p32 Weather and Natural Catastrophes in Medieval and Early Modern Europe: Storms, Floods, Fires, Earthquakes, and Pandemics Albrecht Classen1 1 The University of Arizona, USA Correspondence: Albrecht Classen, The University of Arizona, USA. Received: June 27, 2021; Accepted: July 23, 2021; Published: August 19, 2021 Abstract Ecocriticism and Medieval Natural Catastrophes Literary Evidence? Ecocriticism in the Humanities has alerted us in the last few years to the considerable potentials of building significant bridges between the Sciences (Meteorology, Atmospheric Sciences, Vulcanism, etc.), on the one hand, and Literary and Historical Studies on the other, and to draw insights from both sides of the equation for an increased understanding of universal phenomena of great importance for all human societies.[1] Climate change, for instance, is not something we can understand today by simply looking at samples or data reflecting current conditions, as if our current situation had emerged only in the last fifty or so years. Major changes in our natural environment are mostly the result of long-term forces impacting our material and cultural world, and weather patterns and significant disruptions have had a huge impact on human society throughout time. Nevertheless, we can probably agree that the current situation of our physical conditions have dramatically deteriorated over the last decades because of human-made factors, if we consider the daunting global warming affecting us all right now in the twenty-first century as a result of the Industrial Revolution and the modern consume society which endangers the survival of our world (Anthropocene). -

Lancewadplan Description of Cultural Entities in the Wadden Sea Region
LancewadPlan Description of Cultural Entities in the Wadden Sea Region Elaborated by the project LancewadPlan (Integrated Landscape and Cultural Heritage Management and Development Plan for the Wadden Sea Region) Project Period: June 2004 – June 2007 Co-financed by the EU Interreg IIIB North Sea Programme Final version July 2007 Cultural Entities page 2 Contents SUMMARY ................................................................................................................. 4 Blåvandshuk to Ribe, DK............................................................................................ 5 Ribe to Tønder, DK................................................................................................... 16 Wadden Sea Islands Rømø - Mandø – Fanø, DK .................................................... 25 Sylt, SH..................................................................................................................... 37 Wiedingharde, SH .................................................................................................... 44 Bökingharde, SH ...................................................................................................... 50 Nordergosharde, SH................................................................................................. 56 Föhr, SH ................................................................................................................... 62 Amrum, SH.............................................................................................................. -
Natural Sea Level Indicators Recording the Fluctuations of The
16 Indicators of Sea Level Holger Freund, Institute of Geobotany, University of Natural Sea Level Indicators Recording the Hanover, FRG & Hansjörg Streif, Geological Survey Fluctuations of the Mean High Tide Level in of Lower Saxony, FRG the Southern North Sea Due to coastal erosion on the seaward side of Methods the East Friesian barrier islands, horizons con- For the reconstruction of former sea-level stands, sisting of subfossil tidal flat and salt marsh organic deposits formed in the course of Holocene deposits are exposed which embrace the time transgression and regression cycles are key sourc- span of the last 2000 years. These deposits are es of evidence. These are peat layers, palaeosoil ho- natural sea level indicators recording former rizons (Dwog horizons), tidal flat and salt marsh fluctuations of the mean high tide level in the deposits. They bear material that is amenable to German Bight. By the use of various palaeo- radiocarbon dating and that offers the opportunity ecological techniques, including pollen, plant to fix former mean sea levels by decoding the envi- macrofossil and diatom analyses, it has been ronmental record contained in the form of macro- possible to reconstruct those fluctuations. The and microfossils, in other words the reconstruction information gap between the geological record of the facies. of Holocene sea-level fluctuations, on the one hand, and those of recent tide gauge measure- It is widely recognized that the system of the ments, on the other hand, has thus been par- East Friesian barrier islands is not stable, the posi- tially bridged. tion of the islands being closely tied-in with ma- rine morphodynamic processes. -

Forschungsstelle Küste
Forschungsstelle Küste Niedersächsisches Landesamt für Ökologie Preprint Proceedings 24th International Conference on Coastal Engineering Kobe, Japan, ASCE, New York Hanz D. Niemeyer LONG-TERM MORPHODYNAMICAL DEVELOPMENT OF THE EAST FRISIAN ISLANDS AND COAST LONG-TERM MORPHODYNAMICAL DEVELOPMENT OF THE EAST FRISIAN ISLANDS AND COAST Hanz D. Niemeyer1 Abstract The morphology of the East Frisian Islands and Coast has experienced enormous changes in the course of the last centuries. The resedimentation of medieval sturm bays has played a dominant role within these morphodynamical processes which could no longer only be credited to the impacts of littoral drift. Reconstructions of former coastal morphology have been used to quantify the long-term development of significant parameters for the tidal basins of the East Frisian Wadden Sea. Additionally also the tidal volumes for situations since 1650 could be determined. On this basis the long-term stability of common empirical relationships was checked. Introduction The East Frisian Islands and Coast are part of the Frisian Wadden Sea which ranges from the eastern part of the Dutch across the German to the southern part of the Danish North Sea coast (fig. 1) and consist of a chain of seven barrier islands separated by tidal inlets from each other through which the tidal basins with intertidal areas and supratidal salt marshes are filled and emptied during each tidal cycle. The tidal range is about 2,5 m and the yearly mean offshore significant wave height is about 0,7 to 1,0 m. It is therefore a mixed energy tide-dominated coast according to the classification of HAYES [1975]. -

The Influence of Low Dutch on the English Vocabulary
The Influence of Low Dutch on the English Vocabulary E.C. Llewellyn bron E.C. Llewellyn, The Influence of Low Dutch on the English Vocabulary. Oxford University Press, Londen 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/llew001infl01_01/colofon.htm © 2007 dbnl / erven E.C. Llewellyn iii Introduction THE words treated in this book have been collected from the pages of the Oxford English Dictionary and the Supplement to that work. I have not used the English Dialect Dictionary, as words in dialectal use only do not fall within the scope of my work. I have been as inclusive as possible. Borrowings from Low Dutch that found a place in the English vocabulary for a short time only, and then became obsolete, have been included; words which were never really naturalized, and those recorded but once, have not been excluded. I have found a place for the numerous Low Dutch words which have been borrowed into English in South Africa, North America, the East and West Indies, and Guiana. I have included a few Dutch words, such as ridder and marten, which have passed into English indirectly through French, and conversely many French words, e.g. such verbs as domineer, cashier, and fineer, which have passed into English through Low Dutch. A class of words similar to this last is that of words of Portuguese and Spanish or of native Malay and South African origin borrowed into Dutch, thence passing into English in their Dutch form. I have taken the explanations of the meanings of the words as given by the Oxford English Dictionary.