Geologica Hungarica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Act Cciii of 2011 on the Elections of Members Of
Strasbourg, 15 March 2012 CDL-REF(2012)003 Opinion No. 662 / 2012 Engl. only EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) ACT CCIII OF 2011 ON THE ELECTIONS OF MEMBERS OF PARLIAMENT OF HUNGARY This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. www.venice.coe.int CDL-REF(2012)003 - 2 - The Parliament - relying on Hungary’s legislative traditions based on popular representation; - guaranteeing that in Hungary the source of public power shall be the people, which shall pri- marily exercise its power through its elected representatives in elections which shall ensure the free expression of the will of voters; - ensuring the right of voters to universal and equal suffrage as well as to direct and secret bal- lot; - considering that political parties shall contribute to creating and expressing the will of the peo- ple; - recognising that the nationalities living in Hungary shall be constituent parts of the State and shall have the right ensured by the Fundamental Law to take part in the work of Parliament; - guaranteeing furthermore that Hungarian citizens living beyond the borders of Hungary shall be a part of the political community; in order to enforce the Fundamental Law, pursuant to Article XXIII, Subsections (1), (4) and (6), and to Article 2, Subsections (1) and (2) of the Fundamental Law, hereby passes the following Act on the substantive rules for the elections of Hungary’s Members of Parliament: 1. Interpretive provisions Section 1 For the purposes of this Act: Residence: the residence defined by the Act on the Registration of the Personal Data and Resi- dence of Citizens; in the case of citizens without residence, their current addresses. -

Északi-Bakony 06/02/2020 11:39 AM
bfnk konyv-ok_Layout 1 2013.06.18. 11:59 Page 152 bfnk konyv-ok_Layout 1 2013.06.18. 11:59 Page 153 északI-Bakony TájeGyséG A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet is a BfNPI nak, az újonnan megnyitott Pannon Csillagda működési területéhez tartozik. Központja a programjainak, a Tájház korhű használati tár- hegység szívében megbújó Bakonybélben talál- gyainak, valamint a templomnak és a hozzá ható. Mi is innét indítottuk túraleírásaink nagy kapcsolódó monostornak a megtekintése. részét, hiszen a hajdan félelmetes hírű Bakony- Hasonló, talán még gazdagabb időtöltést kí- erdő legszebb tájai a környéken néhány órás nál Zircen az Arborétum, a Bakonyi Természet- gyalogutakkal egyszerűen bejárhatók. Akár- tudományi Múzeum, a Műemlékkönyvtár, a merre indulunk, lépten-nyomon újabb és újabb ciszterci apátság, illetve Reguly Antal szülőhá- természeti csodák kerülnek elénk. zának felkeresése. Egy rövid kirándulás a város Északra a hegység egyik leghosszabb szurdo- szélén indul a Pintér-hegyi Parkerdő kényel- kában, a bővizű Gerence mentén jutunk el az mes sétaútjain. Odvaskő sziklaszirtjét és barlangját megcélzó A hegység másik, keletre tartó jelentős patak- túraútvonal kezdetéig. A délre fakadó Szent- ja, a Gaja igen látványos sziklaszurdokot vésett kút kegyhelyétől gyalogolhatunk át a Gerence magának a Bakonynána melletti Római fürdő- festői fekvésű Kerteskői-szurdokába. Kerékpár- nél. A Bakony legnagyobb vízfolyása, a Cuha ral keletre, a jó minőségű aszfaltúton, végig csodálatos völgyében vezet hazánk legszebb hangulatos erdei környezetben tekerhetünk vasútvonala. Túrajavaslatunk ennek Vinye fel a Kőris-hegy csúcsáig, miközben több ter- megállójából kalauzol bennünket a szurdok al- mészeti látnivalónál is megállunk. Egy másik só végéhez. bringás javaslat erdészeti murvás és aszfaltos A Bakony–Balaton Geoparkba észak felől autó- utakon – mély völgyeken és keskeny gerince- val érkezőket szinte mindig megállásra készte- ken át – körbekerüli a nyugatra magasodó ti Csesznek várának nagyszerű látványa. -

Tudatos Vásárló Kalauz
Tudatos Vásárlók Egyesülete TudatosVásárló.hu Magyarország internetes magazin Zöld Térképe Naponta friss hírek, Magyarország zöld cikkek, ajánlók és szemmel – adatbázis a tippek a környezetbarát fenntartható életmód és etikus életmód kulcsfontosságú témaköreiben. helyeivel. www.tudatosvasarlo.hu www.zoldterkep.hu Tudatos Vásárló Magazin E-szám adatbázis Részletesen és hitelesen Negyedévente az élelmiszer- megjeleno"#$%&#'()*" adalékanyagokról. fogyasztói magazin. www.tudatosvasarlo.hu/ www.tudatosvasarlo.hu/ eszam magazin Helyi Termék Cégmérce Fesztivál Márkasorrendek a Fesztiválsorozat termékek mögött és Tudatos Vásárló Csatlakozz álló cégek környezeti kalauzok a helyi és társadalmi termékek és megoldások teljesítménye alapján. *# * -#." népszeru hozzánk, www.cegmerce.hu www.helyitermekfesztival.hu legyél Te is tudatos TudatosVásárlók Közhasznú Egyesülete TudatosUtazó.hu vásárló! 1027, Budapest, Információs utasellátó Bem rkp. 30. II./19. tippekkel, tudnivalókkal, tel/fax: (+36) 1 225 8136 internetes tanácsadással. www.tve.hu www.tudatosutazo.hu www.tve.hu/tamogatas adószám: 18245770-1-43 HELYI ÉLELMISZEREK Mi a rossz abban, ha a Balatonon papírtányérról elfogyasztott hekk közel tízszer annyit utazott idén, mint mi magunk? Amint az egyik legeredetibb balatoni fogásnak vélt halunkat majszoljuk, fel sem merül bennünk, hogy a hekket esetleg Argentínában fogták ki a vízből. De említhetnénk a dél-afrikai körtét, a spanyol epret vagy a marokkói paprikát is. A globalizált gazdaságban a távolság nem akadály, a világlátott élelmiszerek mára a magyarországi szupermarketek polcait is elborítják. Még így is olcsóbb a kínai fokhagyma, mint a hazai – gondolhatnánk, ám a távolról jött árukért valójában Mi az az üvegházhatású gáz? lényegesen nagyobb árat fizetünk, mint amennyi zsebünkből a pénztárgépbe vándorol. Az élelmiszerek szállításakor a Az üvegházhatású gázok közé tartozik többek között a levegőbe kerülő szén-dioxid és egyéb gázok globális szén-dioxid (CO2), a metán (CH4) és a dinitrogén-oxid éghajlatváltozást okozó és egészségkárosító hatása mára (N2O). -

Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve, 2014. Január 1
Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2014. január 1. Gazetteer of Hungary 1st January, 2014 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2014 © Központi Statisztikai Hivatal, 2014 © Hungarian Central Statistical Office, 2014 ISSN 1217-2952 Felelős szerkesztő – Responsible editor: Waffenschmidt Jánosné főosztályvezető – head of department További információ – Contact person: Nagy Ferenc Andrásné szerkesztő – editor (tel: 345-6366, e-mail: [email protected]) Internet: http://www.ksh.hu [email protected] 345-6789 (telefon), 345-6788 (fax) Borítóterv – Cover design: Nyomdai kivitelezés – Printed by: Xerox Magyarország Kft. – Táskaszám: 2014.076 TARTALOM ÚTMUTATÓ A KÖTET HASZNÁLATÁHOZ ............................................................................................................... 5 KÓDJEGYZÉK ..................................................................................................................................................................... 11 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 1. A helységek száma a helység jogállása szerint ............................................................................................................................................................ 21 2. A főváros és a megyék területe, lakónépessége és a lakások száma ........................................................................................................................... 22 3. A települési önkormányzatok főbb adatai .................................................................................................................................................................. -

Ministry of Agriculture and Rural Development PROGRAMME
Ministry of Agriculture and Rural Development PROGRAMME-COMPLEMENT (PC) to the AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME (ARDOP) (2004-2006) Budapest June 2009 ARDOP PC modified by the ARDOP MC on 7 March 2006 and by written procedures on 18 August, 29 September 2006 and on 14 August 2007, revised according to the comments of the European Commission (ref.:AGRI 004597of 06.02.2007, AGRI 022644 of 05.09.07 and AGRI 029995 of 22.11 07.) 2 TABLE OF CONTENTS I. INTRODUCTION .............................................................................................................. 5 I.1 PROGRAMME COMPLEMENT....................................................................... 5 I.2 THE MANAGING AUTHORITY for ARDOP.................................................. 6 I.2.1 General description......................................................................................... 6 I.2.2 The MANAGING AUTHORITY in Hungary................................................ 6 I.2.3 Monitoring ...................................................................................................... 6 I.2.4 Financial Management and Control Arrangements ........................................ 6 I.2.5 Monitoring the capacities................................................................................ 6 I.3 THE PAYING AUTHORITY............................................................................. 6 I.4 THE INTERMEDIATE BODY .......................................................................... 6 I.5 THE FINAL BENEFICIARIES......................................................................... -
B L a U T E C H Humán- És Környezetvédelmi Szolgáltató Kft
B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: [email protected] A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által; Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére feljogosított szakértői szervezet Engedély száma: VMMK 19/0467 ZIRC KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A dokumentáció azonosító jele: VJ-2002091305 BAKONYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE A VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV ADATAI: Neve: Blautech Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Címe: 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Telefon száma: (88)-590-050 Telefax száma: (88)-590-059 Felelős vezető: Németh Zoltán ügyvezető Cégbejegyzés száma: 1909000038 Felügyeleti szerv: Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság E-mail cím: [email protected] Honlap: www.blautech.hu A VIZSGÁLATOT MEGRENDELTE: Neve: Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége, Területfejlesztési Társulása Címe: 8420 Zirc Rákóczi tér 15/D Levélcíme: 8420 Zirc Rákóczi tér 15/D Telefon: 88 414-093 FAX: 88 414-093 A VIZSGÁLAT HELYSZÍNE: Zirc kistréséghez tartozó települések területe A VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2002. április-2002. július A VIZSGÁLAT CÉLJA: Település környezetvédelmi program készítése Zirc kistérség Bakonybél, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fenyőfő, Jásd, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalú, Pénzesgyőr, Porva és Zirc települései közigazgatási terültére. A VIZSGÁLATBAN RÉSZTVEVŐK: A Megbízó felelős képviselői: Máhl Ferenc ügyvezető elnök A vizsgálatot vezette: Janó István környezetvédelmi igazgató A vizsgálatban közreműködött: Horváth József vezető környezetvédelmi szakértő Bárány Lajos környezetvédelmi mérnök A FELHASZNÁLT ÜZEMI ADATOK FORRÁSA: Helyszíni bejárások, vizsgálatok során gyűjtött adatokkal végzett műszaki számítások Környezetvédelmi hatóságok adatai Környezetvédelmi szolgáltatók adatai A DOKUMENTUM AZONOSÍTÁSA: Dokumentum fájl neve: 2002091305 Készült 3 hiteles példányban. Tartalmaz 137 számozott oldalt és mellékleteket Azonos a(z) példánnyal. -
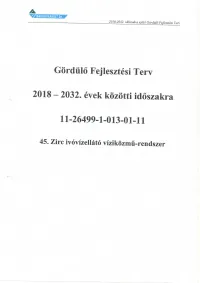
5.Napirend 1.Melleklete0817.Pdf
Gördülő Fejlesztési Terv Víziközmű-rendszer állapot bemutatása 5. számú melléklet Víziközmű-rendszer megnevezése: 45. Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátott települések: Zirc, Borzavár, Porva, Olaszfalu, Nagyesztergár, Dudar, Bakonynána, Csetény, Szápár, Tés, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Csesznek Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer vízbázisa: Zirc 1., 2. vízműkút, Reguly aknás forrás, Porva Pálihálás-pusztai forrásgaléria, Porva-forrásfoglalás, Olaszfalu ásott kút, Csetény K-3 vízműkút, Tés vízműkút, Csetény Cs-81 vízműkút. Vízkezelés: fertőtlenítés A vízelosztó hálózat KPE, KM PVC és 17,2 %-os arányban azbesztcement csövekből épült, a hálózat műszaki állapotának minősítése kielégítő, de egyes szakaszokon felújításra szorul, avult. Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer tározói: Zirc 250 m3-es medence, Zirc Tündérmajor 100 m3-es glóbusz, Borzavár 2x75 m3 medence, Olaszfalu 50 m3-es medence, Nagyesztergár 200 m3 glóbusz, Dudar 250 m3 medence, Dudar 2x100 m3 medence, Bakonynána 100 m3 medence, Csetény 2x150 m3 medence, Szápár 100 m3 medence, Tés 100 m3 glóbusz, Csesznek 200 m3 medence, Csesznek 50 m3 medence Vízbázis: Talajvizes vízkészletet termelt a Porva-forrásfoglalás és az Olaszfalu ásott kút, melyek vízminőségük, elégtelen hozamuk miatt üzemen kívül lettek helyezve. Folyamatosan üzemel a karsztos vízkészletet feltáró 6,8 m mély Reguly-aknás forrás, a 420,0 m mély Zirc 1. vízműkút, az 503,0 m mély Zirc 2. vízműkút, a Pálihálás-pusztai forrásgaléria, a 319,5 m mély Csetény Cs-81 és a 310,0 m mély Csetény K-3. Vízminőségük megfelelő, a termelt és szolgáltatott víz az eseti fertőtlenítésen túlmenően vízkezelést nem igényel. Kútállapotfelmérés, vizsgálati eredmény alapján kúttisztítás, kútjavítás szükséges a Zirc 1. és Zirc 2., Csetény K-3 és védhetőség esetén Olaszfalu ásott kútnál. -

Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve, 2018. Január 1
ISSN 1217-2952 MAGYARORSZÁG KÖZIGAZGATÁSI HELYNÉVKÖNYVE, 2018. JANUÁR 1. 9 771217 295008 2018 Gazetteer of Hungary, 1 January 2018 ÁR: 2700 FT R 1. Á SI HELYNÉVKÖNYVE, 2018. JANU Á January 2018 st TATISZTIKAI ÉVKÖNYV TATISZTIKAI S G KÖZIGAZGAT Á MAGYAR MAGYAR MAGYARORSZ 1 Gazetteer of Hungary, Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2018. január 1. Gazetteer of Hungary 1 January 2018 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2018 © Központi Statisztikai Hivatal, 2018 © Hungarian Central Statistical Office, 2018 ISSN 1217-2952 Felelős kiadó – Responsible publisher: Dr. Vukovich Gabriella elnök – president Felelős szerkesztő – Responsible editor: Bóday Pál főosztályvezető – head of department Borítófotó – Cover photo: Fotolia Nyomdai kivitelezés – Printed by: Xerox Magyarország Kft. – Táskaszám: 2018.069 TARTALOM ÚTMUTATÓ A KÖTET HASZNÁLATÁHOZ ....................................................................................................... 5 KÓDJEGYZÉK ...................................................................................................................................................... 11 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 1. A helységek száma a helység jogállása szerint ................................................................................................................................ 17 2. A főváros és a megyék területe, lakónépessége és a lakások száma ............................................................................................. 18 3. A települési önkormányzatok -

Florisztikai Adatok a Bakonyból És a Bakonyaljáról II. -..:::: Kitaibelia
id1758000 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com 187 KITAIBELIA IX. évf. 1. szám pp.: 187-206. Debrecen 2004 Florisztikai adatok a Bakon yból és a Bakonyaljáról II. BAUER Norbert H-8420 Zirc, Egry J. u. 8. E-mail: [email protected] Jelen közlemény BAUER (2001) florisztikai adatközlésének folytatásaként a Bakony-hegység és a Bakonyalja flórájának jobb megismeréséhez kíván hozzájárulni, a 2002, 2003 években folytatott florisztikai adatgyûjtés néhány eredményével. A dolgozatban közlésre kerül néhány a kutatott területrõl még nem jelzett taxon (pl. Leucojum aestivum, Montia fontana subsp. minor, a Bakonyaljáról, Hippuris vulgaris a Déli- Bakonyból, Limosella aquatica, Galinsoga quadriradiata a hegység több pontjáról), számos ritkább, ill. szórványos elterjedésû, növényföldrajzi szempontból jelentõs növény (Anemone sylvestris, Helleborus dumetorum, Prunus fruticosa, Ononis pusilla, Euphorbia angulata, Viola collina, Scrophularia vernalis, Corydalis intermedia, Primula × brevistyla, Silene bupleroides, Poa badensis, Agropyron pectiniforme stb.) néhány újabb adata. A felsorolt növények közt viszonylag szép számmal szerepelnek ritkább gyom, ill. gyom jellegû taxonok pl. Myosurus minimus, Vicia pannonica subsp. striata, Polycnemum majus, Euphorbia falcata, E. exigua, Teucrium botrys, Papaver argemone, Erysimum cheiracanthoides, Pseudognaphalium luteo-album, Herniaria hirsuta, Gagea arvensis, Carex hordeistichos, Aegilops cylindrica, Panicum capillare, Leersia oryzoides. Az enumerációban néhány viszonylag gyakoribb – de kevés publikált adattal rendelkezõ, vagy terjedõben lévõ, ill. védett – faj néhány újabb adatát is közöljük. Az adatok megadásakor a helységnevet a dûlõnév ill., ha ilyen nincs a lelõhely körülírása követi, egyes adatok esetében az állományra, termõhelyre vonatkozó megjegyzésekkel. A taxonok új (ill. esetenként megerõsített régi) adatainak felsorolását követõen zárójelben szerepelnek korábbi adatainak hivatkozásai. -
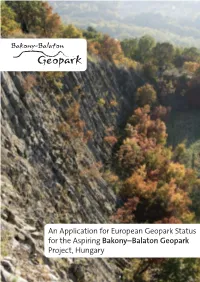
An Application for European Geopark Status for the Aspiring Bakony–Balaton Geopark Project, Hungary Table of Contents
An Application for European Geopark Status for the Aspiring Bakony–Balaton Geopark Project, Hungary Table of Contents A. Identification of the Area 1 A.1. Name of the proposed Geopark 1 A.2. Surface area, physical and human geography characteristics of the proposed Geopark 1 A.3. Organization in charge and management structure 3 A.4. Application contact person 3 B. Geological Heritage 4 Bakony–Balaton Geopark: land of the calmed-down volcanoes and dinosaurs (a preface in 150 words...) 4 B.1. Location 4 B.2. General geological description 4 B.3. Listing and description of geological sites, details on the interest of these sites 15 C. Geoconservation 35 C.1. Current or potential pressure on the proposed Geo park 35 C.2. Current status in terms of protection of geological sites 36 C.3. Data on the management and maintenance of these sites 36 C.4. Listing and description of non-geological sites and how they are integrated into the proposed Geopark 37 D. Economic Activity and Business Plan 44 D.1. Economic activity in the proposed Geopark 44 D.2. Existing and planned facilities for the proposed Geopark 44 D.3. Analysis of geotourism potential in the proposed Geopark 46 D.4. Overview and policies for the sustainable development of geotourism and economy, geoeducation and geoheritage 47 D.5. Policies for, and examples of, community empowerment (involvement and consultation) in the proposed Geopark 47 D.6. Policies for, and examples of, public and stakeholder awareness in the proposed Geopark 48 E. Interest and arguments for joining the EGN/GGN -

Az Északi Bakony (HUBF30001) Kiemelt Jelent Őség Ű Természetmeg Őrzési Terület És Különleges Madárvédelmi Terület Fenntartási Terve
Az Északi Bakony (HUBF30001) kiemelt jelent őség ű természetmeg őrzési terület és különleges madárvédelmi terület fenntartási terve Csopak 2020 Készítette : Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tel: 06-87-555-260 Fax: 06-87-555-261 E-mail: bfnp@bfnp-hu Web: https://www.bfnp.hu Acrida Természetvédelmi Kutató BT. 8300 Tapolca, Deák F. u. 7. Tel: 06-20-34-89-345 Fax: 06-88-785-023 E-mail: [email protected] Felel ős tervez ő Dr. Kenyeres Zoltán Vezet ő szakért ők Dr. Bauer Norbert Zábrák Károly Közrem űköd ő szakért ők Dr. Bódis Judit Fehér Csaba Endre Hüvös-Récsi Annamária Márkus András Mészáros András Mészáros József Dr. Nagy Lajos Papp Sándor Szinai Péter Dr. Tóth Sándor Vers József 2 Tartalomjegyzék I. Natura 2000 fenntartási terv .................................................................................................... 4 1. A terület azonosító adatai ....................................................................................................... 5 1.1. Név .................................................................................................................................. 5 1.2. Azonosító kód ................................................................................................................. 5 1.3. Kiterjedés ........................................................................................................................ 5 1.4 A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy él őhelyek ..................................................... 5 1.5. Érintett -

Zirc Kistérség Települési Önkormányzatainak
- 1 - ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA1 KIVONAT (25. számú módosításhoz) A zirci kistérség önkormányzatai kinyilvánítják, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§-ában foglalt felhatalmazás alapján társulási megállapodást kötnek az önkormányzati közszolgáltatások mind teljesebb körű közös ellátására, azok színvonalának emelése és gazdasági erőforrásaik felhasználás hatékonyságának növelése érdekében. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen megállapodás 5. pontjában felsorolt települési önkormányzatok 2005. október 14-én többcélú kistérségi társulást hoztak létre a kistérség területfejlesztési feladatainak összehangolt ellátására, valamint az önkormányzati közszolgáltatások folyamatosan bővítendő körű, fejlődő színvonalú biztosítására, amely célkitűzés felöleli a közös fejlesztési, szervezési és intézmény-fenntartási feladatokat. 2. A Társulás tagjai a jelen megállapodás aláírásával vállalják a Társulás keretében legalább három évre történő együttműködésüket. 3. A Társulás neve: Zirc Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) A Társulás rövidített neve: ZKTT 4. A Társulás székhelye: a.) 8420 ZIRC, Rákóczi tér 15/B. 5. A Társulás tagjai és azok székhelye: 6. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ SZÉKHELYE NEVE POLGÁRMESTER Bakonybél 8427 Bakonybél, Jókai u.2. Baky György Bakonynána 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31. Kropf Miklós Bakonyoszlop 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 26. Ifj. Wolf Ferenc Bakonyszentkirály 8430 Bakonyszentkirály,