Forum Supervision - KA
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Melanie Klein's Concept of Counter-Transference Taken From
7 Melanie Klein’s Concept of Counter-Transference Taken from Unpublished Material Esmeralda Macedo, Carlos Amaral Dias In this essay we discuss the concept of counter-transference based on some of Melanie Klein’s unpublished notes from the archives in the Wellcome Institute for the History of Medicine, in London. Hence, the discussion here incorporates material that has never been published be- fore1. Until 1950 the most commonly accepted conception of counter- -transference was that of Freud, who saw it as an obstacle that should be removed. When Paula Heimann’s ideas became widely known this mechanism started to be seen as an important aid to understanding the patient. Klein always rejected that perspective and remained close to Freud’s ideas. In the 1960s, the works of Bion and Money-Kyrle show that, along with the concept of projective identification, counter-transfe- rence was a valuable tool for understanding the patient in both its patho- logical and benign forms. What we show in this article is that in spite of not having conceptualized her ideas about the subject, Klein’s approach to it was very much in accordance with those authors with respect to the vicissitudes of the therapeutic relationship. 1 Researched by Emeralda Macedo for her PhD thesis prepared under the supervision of Professor Carlos Amaral Dias and Professor Rui Aragão Oliveira (Instituto Superior de Psicologia Aplicada/Universidade Nova de Lisboa, February 2007). Interações número 19. pp. 7-21. © do Autor 2010 8 Interações SOME PERSPECTIVES OF COUNTER-TRANSFERENCE One of the most important conceptions of counter-transference was Paula Heimann’s formulation, published in 1950. -

A Brief History of the British Psychoanalytical Society
A BRIEF HISTORY OF THE BRITISH PSYCHOANALYTICAL SOCIETY Ken Robinson When Ernest Jones set about establishing psychoanalysis in Britain, two intertwining tasks faced him: establishing the reputation of psychoanalysis as a respectable pursuit and defining an identity for it as a discipline that was distinct from but related to cognate disciplines. This latter concern with identity would remain central to the development of the British Society for decades to come, though its inflection would shift as the Society sought first to mark out British psychoanalysis as having its own character within the International Psychoanalytical Association, and then to find a way of holding together warring identities within the Society. Establishing Psychoanalysis: The London Society Ernest Jones’ diary for 1913 contains the simple entry for October 30: “Ψα meeting. Psycho-med. dinner” (Archives of the British Psychoanalytical Society, hereafter Archives). This was the first meeting of the London Psychoanalytical Society. In early August Jones had returned to London from ignominious exile in Canada after damaging accusations of inappropriate sexual conduct in relation to children. Having spent time in London and Europe the previous year, he now returned permanently, via Budapest where from June he had received analysis from Ferenczi. Once in London he wasted no time in beginning practice as a psychoanalyst, seeing his first patient on the 14th August (Diary 1913, Archives), though he would soon take a brief break to participate in what would turn out to be a troublesome Munich Congress in September (for Jones’s biography generally, see Maddox [2006]). Jones came back to a London that showed a growing interest in unconscious phenomena and abnormal psychology. -
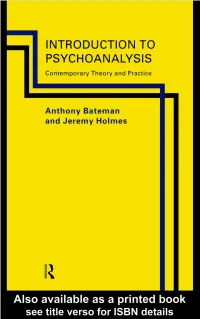
Introduction to Psychoanalysis
Introduction to Psychoanalysis The psychoanalytic movement has expanded and diversified in many directions over its one hundred year history. Introduction to Psychoanalysis: Contemporary Theory and Practice examines the contributions made by the various schools of thought, explaining the similarities and differences between Contemporary Freudian, Independent, Kleinian, Object Relations, Interpersonal, Self Psychological and Lacanian analysis. The authors address crucial questions about the role of psychoanalysis in psychiatry and look ahead to the future. The book is divided into two parts covering theory and practice. The first part considers theories of psychological development, transference and countertransference, dreams, defence mechanisms, and the various models of the mind. The second part is a practical introduction to psychoanalytic technique with specific chapters on psychoanalytic research and the application of psychoanalytic ideas and methods to treating psychiatric illness. Well referenced and illustrated throughout with vivid clinical examples, this will be an invaluable text for undergraduate and postgraduate courses in psychoanalysis and psychoanaltytic psychotherapy, and an excellent source of reference for students and professionals in psychiatry, psychology, social work, and mental health nursing. Anthony Bateman is Consultant Psychotherapist, St Ann’s Hospital, London and a member of the British Psychoanalytical Society. Jeremy Holmes is Consultant Psychotherapist and Psychiatrist, North Devon. Introduction to Psychoanalysis Contemporary theory and practice Anthony Bateman and Jeremy Holmes London and New York First published 1995 by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 29 West 35th Street, New York, NY 10001 Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2001. -

Conceptualizing Our Interpersonal Impressions
Conceptualizing our Interpersonal Impressions Conceptualizing our Interpersonal Impressions Mental Representations and Internal Objects By Gillian Steggles Conceptualizing our Interpersonal Impressions: Mental Representations and Internal Objects By Gillian Steggles This book first published 2015 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2015 by Gillian Steggles All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-7046-3 ISBN (13): 978-1-4438-7046-7 Dedicated, belatedly, to Melanie Klein and Anna Freud TABLE OF CONTENTS List of Figures.............................................................................................. x List of Tables .............................................................................................. xi Foreword ................................................................................................... xii Bob Hinshelwood Preface ....................................................................................................... xv Acknowledgements ................................................................................. xvii Introduction ................................................................................................ -

Understanding Psychotherapists' Experience of Ongoing Learning
Understanding Psychotherapists’ Experience of Ongoing Learning A Hermeneutic Phenomenology Study Kerry L. Thomas-Anttila A thesis submitted to Auckland University of Technology in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) 2017 Faculty of Health and Environmental Sciences Auckland University of Technology New Zealand Primary Supervisor: Professor Elizabeth Smythe Second Supervisor: Dr Deborah Spence i Abstract This study explores the phenomenon of psychotherapists’ experience of ongoing learning. Psychotherapy has a clinical case-based history and, therefore, a knowledge base that is founded on clinical work. Amongst psychotherapists themselves there is a tacit understanding that the ongoing learning of psychotherapy goes hand-in-hand with the practising of psychotherapy, including thinking about the work. This latter can often take the form of reading about, writing about, or discussing clinical case reports or studies. Such forms of learning are, however, regarded poorly in the mainstream research arena. Where does this place psychotherapists themselves? Is something amiss with how therapists are educated and continue to learn? This is the basis of a very lively debate in psychotherapy literature and the impetus for my exploring this phenomenon by way of speaking with psychotherapists about their own experiences of ongoing learning. The 12 participants were purposefully selected for their willingness to participate and their ability to articulate their learning experiences. Participants’ narratives were captured via audio-taped interviewing and “stories” of learning emerged. I have offered an interpretation of the therapists’ narratives, within the ontological framework of hermeneutic phenomenology and drawing from the writings of Heidegger [1889-1976], Gadamer [1900-2002], and Arendt [1906-1975]. -

The Memory of Feeling: Envy and Happiness
Pastoral Psychol DOI 10.1007/s11089-013-0555-3 The Memory of Feeling: Envy and Happiness Jaco J. Hamman # Springer Science+Business Media New York 2013 Abstract This essay explores how happiness is maintained as a memory of the first relationship and when that memory is disturbed, envy can set in. Envy is the angry feeling that another person possesses and enjoys something desirable—the envious impulse being to take it away or to spoil it. The thought of Melanie Klein and her 1957 work, Envy and Gratitude, guides the inquiry. Happiness in one person can offend when another experiences the happiness as goodness of life that is being withheld from them. Since all persons carry the memory of happiness, seeing the happiness of others reminds us of something once owned or experienced, but now lost. Envy becomes a defense against the painful memory of happiness once known. The biblical figure King Saul is identified as someone who experienced envy in the face of a young David’s happiness. Envy not only robs a person of happiness, it removes a sense of gratitude. Keywords David . Envy. Gratitude . Happiness . Melanie Klein . Saul Introduction In 100 Years of Happiness,CarlinandCapps(2012) write that Saint Augustine was concerned with the question of happiness. He came to the conclusion that “we all had happiness once upon a time. In other words, happiness is somewhere in our memories” (p. xvii). What happens if the memory of happiness in a person is awakened and possibly disturbed? This is the foundational question that drives this essay. If we all have memories of happiness, as Augustine, Capps, Carlin, and many others argue, then memories of happiness may be stirred—or more pertinently, disturbed—especially by the happiness one witnesses in someone else. -
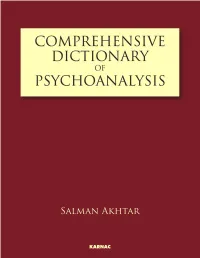
Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis
Akhtar prelims CORREX 7/16/09 5:30 PM Page i 1 2 3 4 5 6 7 8 COMPREHENSIVE DICTIONARY 9 10 OF PSYCHOANALYSIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 Akhtar prelims CORREX 7/16/09 5:30 PM Page ii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 71 Akhtar prelims CORREX 7/16/09 5:30 PM Page iii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COMPREHENSIVE DICTIONARY 1 2 3 OF PSYCHOANALYSIS 4 5 6 7 8 9 Salman Akhtar M.D. 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 Akhtar prelims CORREX 7/16/09 5:30 PM Page iv 1 2 3 4 5 6 7 8 First published in 2009 by 9 Karnac Books Ltd 10 118 Finchley Road, London NW3 5HT 1 2 3 4 5 Copyright © 2009 Salman Akhtar 6 7 8 9 The right of Salman Akhtar to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with §§ 77 201 and 78 of the Copyright Design and Patents Act 1988. -

Zwischenbericht 2017 (PDF)
Programm zur Förderung von Institutionspartnerschaften Projekt: Die Geschichte der Psychoanalyse in Polen im deutsch-polnisch- jüdischen Kulturkontext 1900-2015 Gesamtförderzeit: 01.07.2016 – 31.03.2019 Sachbericht zum Zwischennachweis: 01.01.2017 – 31.12.2017 Kooperationspartner in Deutschland: ProF Dr. habil. Ewa Kobylinska-Dehe, PAN International Psychoanalytic University, Berlin Kooperationspartner in Polen: ProF. Dr. habil. Pawel Dybel Pädagogische Universität, Krakau 1 I. Recherchen und Austausch Bis AnFang Mai 2017 haben sich die einzelnen Teilnehmer mit Ihren jeweili- gen Recherchen beschäftigt, deren erste Forschungsergebnissen auF der I. Tagung des Projekts „Zwischen HoFFnung und VerzweiFlung. Die Geschichte der Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-jüdischen Kulturkontext 1900-1939“ präsentiert wurden. Die Teilnehmer des Projekts, deren For- schungsgebieten und Fragestellungen sich überschnitten hielten einen in- tensiven Kontakt zueinander (Austausch, Besorgung der Literatur, Bespre- chungen per Skype und TelekonFerenzen). Die beiden Leiter blieben im wissenschaftlichen und organisatorischen Austausch mit dem gesamten Team. SorgFältig wurde die I. Tagung vorbereitet (Zusammenstellung der ReFeren- ten, Bereitstellung der Übersetzungen in Deutsch und in Polnisch, Presse- arbeit) (s. Anlage 1). II. Arbeitstreffen und Klausurtagung des gesamten deutsch-polnischen Kooperationsteams an der Pädagogischen Universität, Kraków, den 13.05. 2017 Alle waren anwesend. Die Leitung haben beide Kooperationspartner: Ewa Kobylinska-Dehe und Paweł Dybel übernommen. Wir haben eine neue Kollegin im Projekt, Frau ProF. Dr. Katarzyna Prot- Klinger begrüßt. Aus der ReFlexion über den bisherigen VerlauF des Projek- tes hat sich die Notwendigkeit ergeben, eine Klinikerin in das Projekt ein- zubinden. Im zweiten Teil des Projektes „Krieg, Holocaust und die Psychoa- nalyse” beschäftigen wir uns mit den Bewältigungsmechanismen und in- dividuellen als auch kollektiven TrauerFormen. -

Some Thoughts from a Psychoanalytic Psychotherapist
A personal reflection on countertransference 50 Free Associations: Psychoanalysis and Culture, Media, Groups, Politics Number 68, November 2015 ISSN: 2047-0622 URL: www.freeassociations.org.uk ALIVE MOMENTS: A PERSONAL REFLECTION ON WHAT COUNTERTRANSFERENCE MEANS Robert Hinshelwood Abstract: A reflective piece on Betty Joseph and the notion of countertransference. For a few years, shortly after I qualified as a psychoanalyst, I attended the Workshop that Betty Joseph ran more or less throughout her career. I did not make much of a contribution to the discussion, as I recall, being perhaps too young and experienced in the business at the time. So I got more from it than I gave, nevertheless what I did give, over the years, has been a commitment to her central idea. I remember on one occasion, maybe around 1980, she said she had been asked about publishing her collected papers, and she had replied (she said), “You mean my collected paper!”. In fact her collected papers were published in 1989, as a kind of musical variation on a theme. Her 'one paper' was in 1975, 'The patient who is hard to reach'. It was just be before I had qualified. It addressed a particular form of resistance. All patients resist their analysis, we all have an unconscious to protect, to the ultimate. As analysts therefore we all flounder in a situation where we assume that our patient's come for the insights we can offer, whilst the patient (at least his unconscious) comes with the intention to find help in supporting his unconscious defensiveness. Being at cross-purposes like this with each other is common enough. -

Information Issued by the Association of Jewish Refugees in Great Britain
VOL. XX No. 3 March, 1965 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN • FAIRFAX MANSIONS. FINCHLEY RO. (corner Fairfax Rd.), Lendm. N.W.I 0//ic* and Ctnuilting Houn: TdapheiH ; MAIda v*l« S096/7 (Gmaral olAct and Wtllart tor tha Agad). Monday to Tkurtday 10a.m.—Ipjn. }—6pjn. MAIda Val* 4449 (Employmant Agancy, annuallr llcanicd br tha L.C.C.. and Social Services Dept,) Friday IOa.m.-~l p.m. so far about 150 people had expressed their ACHIEVEMENTS AND NEW PLANS interest in the scheme. The idea was that every applicant should contribute proportion ally to the investment costs, and that the AJR Board Meeting current maintenance cost would also have to be defrayed exclusively by the residents themselves. Arrangements were also envi More than 60 people from London and the The AJR Social Services Department had saged for persons who, without wishing to be Provinces attended the meeting of the AJR to deal with a variety of problems raised by a admitted now, were prepared to contribute Jioard on January 31, when past activities and great number of callers, including employ towards the investment costs with a view to plans for the future were reported and dis ment, accommodation, help in cases of sick being admitted when the need arose. The cussed. ness and psychiatric advice. shape of a company to be founded was at pre The Meeting was opened by Mr, A, S, AJR Information was an indispensable sent being considered by the Sub-Committee in Oresel (Chainnan of the AJR) who paid source of information and also a link between consultation with legal experts. -

Klein in Scotland I & II
Melanie Klein Trust Klein in Scotland I & II By Dr John Shemilt, Member, British Psychoanalytic Society and Scottish Association of Psychoanalytic Psychotherapists Presented at: Before and Beyond Words: Exploring Melanie Klein’s Work and Influence Organised by the Royal College of Psychiatrists in Scotland Medical Psychotherapy Faculty in conjunction with the Melanie Klein Trust, 24-25 November 2017, Pitlochry Festival Theatre ---------------------------------------------- Klein in Scotland I Today and tomorrow I am going to give some personal reflections on the place of Melanie Klein’s work in Pitlochry, where it fits in the evolution of her clinical thinking, and some of the possibly less well known ways in which Klein, Scotland and Scottish psychoanalysis are interwoven. 30 years ago in 1987 Hanna Segal came to Pitlochry. On Saturday 2nd of May we gathered for a ceremony at the Girl Guide Hut on Well Brae, one of the lanes that ascend to the north east of the town. Hanna Segal, representing the Melanie Klein Trust and the British Psychoanalytical Society, unveiled a plaque commemorating Melanie Klein’s use of the Girl Guide Hut as a playroom. This is where she analysed her ten-year-old patient “Richard” during the war years 1940 and 1941, described session by session in the Narrative of a Child Analysis (Klein, 1961). From the 1970’s until the early 2000’s the Pitlochry residential conference met twice a year, in spring and autumn organised by the Scottish Psychotherapy 1 Melanie Klein Trust Section of the Royal College. People came from a wide range of psychiatric, psychotherapy and psychoanalytic work, in both child and adult settings. -

The Play of Interpretation and Resistance in Melanie Klein's
Complicating Disorder: The Play of Interpretation and Resistance in Melanie Klein’s Narrative of a Child Analysis Hilary Clark, University of Saskatchewan, What is disorder? The prefix “dis-” conducts research in psychoanalysis and the indicates that disorder is the reversal of, or, literature of depression and trauma. She has more strongly, negation or absence of, order, been working on a SSHRC-funded project on when order is understood as the regular and issues of interpretation and symbolization in harmonious functioning of things (OED). The British child psychoanalysis. Recent work order/disorder binary—like other binaries includes an edited volume, Depression and such as mind/body and reason/passion—has Narrative: Telling the Dark, and a chapter on structured thinking, at least in the West, about shame, death, and masks in J. Kauffman, disease and “madness,” seeing them as ed., The Shame of Death, Grief, and Trauma. dangerous and anarchic, as the absence of health and sanity. Feminist critique has Abstract deconstructed such binaries foundational to This essay explores the challenge to the Western medical and psychiatric discourses order/disorder binary offered by the dynamics in order to expose their operation in of the psychoanalytic session, specifically reinforcing normative therapeutic practices one of Melanie Klein’s child analyses. It and perpetuating the power relations—the argues that the perception of psychoanalysis systemic inequalities of gender, sexuality, as normalizing is considerably complicated by race, and class—that characterize these the play of interpretation and resistance practices. This article investigates the between analyst and child. meaning of disorder—the vicissitudes of the order/disorder binary—in the context of Résumé psychoanalysis as a practice.