Der Späte Strauss Und Seine Frühen Lieder
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Summer, 2001, Tanglewood
SEMI OIAWA MUSIC DIRECTOR BERNARD HAITINK PRINCIPAL GUEST CONDUCTOR • i DALE CHIHULY INSTALLATIONS AND SCULPTURE / "^ik \ *t HOLSTEN GALLERIES CONTEMPORARY GLASS SCULPTURE ELM STREET, STOCKBRIDGE, MA 01262 . ( 41 3.298.3044 www. holstenga I leries * Save up to 70% off retail everyday! Allen-Edmoi. Nick Hilton C Baccarat Brooks Brothers msSPiSNEff3svS^:-A Coach ' 1 'Jv Cole-Haan v2^o im&. Crabtree & Evelyn OB^ Dansk Dockers Outlet by Designs Escada Garnet Hill Giorgio Armani .*, . >; General Store Godiva Chocolatier Hickey-Freeman/ "' ft & */ Bobby Jones '.-[ J. Crew At Historic Manch Johnston & Murphy Jones New York Levi's Outlet by Designs Manchester Lion's Share Bakery Maidenform Designer Outlets Mikasa Movado Visit us online at stervermo OshKosh B'Gosh Overland iMrt Peruvian Connection Polo/Ralph Lauren Seiko The Company Store Timberland Tumi/Kipling Versace Company Store Yves Delorme JUh** ! for Palais Royal Phone (800) 955 SHOP WS »'" A *Wtev : s-:s. 54 <M 5 "J* "^^SShfcjiy ORIGINS GAUCftV formerly TRIBAL ARTS GALLERY, NYC Ceremonial and modern sculpture for new and advanced collectors Open 7 Days 36 Main St. POB 905 413-298-0002 Stockbridge, MA 01262 Seiji Ozawa, Music Director Ray and Maria Stata Music Directorship Bernard Haitink, Principal Guest Conductor One Hundred and Twentieth Season, 2000-2001 SYMPHONY HALL CENTENNIAL SEASON Trustees of the Boston Symphony Orchestra, Inc. Peter A. Brooke, Chairman Dr. Nicholas T. Zervas, President Julian Cohen, Vice-Chairman Harvey Chet Krentzman, Vice-Chairman Deborah B. Davis, Vice-Chairman Vincent M. O'Reilly, Treasurer Nina L. Doggett, Vice-Chairman Ray Stata, Vice-Chairman Harlan E. Anderson John F. Cogan, Jr. Edna S. -

Richard Strauss
Richard Strauss Meister der Inszenierung Bearbeitet von Daniel Ender 1. Auflage 2014. Buch. 349 S. Hardcover ISBN 978 3 205 79550 6 Format (B x L): 13,5 x 21 cm Weitere Fachgebiete > Musik, Darstellende Künste, Film > Musikwissenschaft Allgemein > Einzelne Komponisten und Musiker Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Daniel Ender Richard Strauss Meister der Inszenierung BÖHLAU VERLAG WIEN · KÖLN · WEIMAR Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlagabbildung: Richard Strauss, 1929 (© ullstein bild – Laszlo Willinger) © 2014 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG, Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Umschlaggestaltung: Michael Haderer, Wien Layout: Bettina Waringer, Wien Korrektorat: Katharina Krones, Wien Druck und Bindung: CPI Moravia Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier ISBN 978-3-205-79550-6 Inhalt Ein öffentliches Leben. Zur Einleitung Ein Kind seiner Zeit . 9 Die inszenierte Biographie . 18 Selbst- und Fremdbilder . 23 1. Vom Epigonen zum Genie „Ein sogenannter Charakter“. Umwelt und Familie. 33 „Nicht von hervorstechender Originalität“. Der Weg in die Öffentlichkeit . .42 „Zum Zukunftsmusiker gestempelt“. -

THROUGH LIFE and LOVE Richard Strauss
THROUGH LIFE AND LOVE Richard Strauss Louise Alder soprano Joseph Middleton piano Richard Strauss (1864-1949) THROUGH LIFE AND LOVE Youth: Das Mädchen 1 Nichts 1.40 Motherhood: Mutterschaft 2 Leises Lied 3.13 16 Muttertänderlei 2.27 3 Ständchen 2.42 17 Meinem Kinde 2.52 4 Schlagende Herzen 2.29 5 Heimliche Aufforderung 3.16 Loss: Verlust 18 Die Nacht 3.02 Longing: Sehnsucht 19 Befreit 4.54 6 Sehnsucht 4.27 20 Ruhe, meine Seele! 3.54 7 Waldseligkeit 2.54 8 Ach was Kummer, Qual und Schmerzen 2.04 Release: Befreiung 9 Breit’ über mein Haupt 1.47 21 Zueignung 1.49 Passions: Leidenschaft 22 Weihnachtsgefühl 2.26 10 Wie sollten wir geheim sie halten 1.54 23 Allerseelen 3.22 11 Das Rosenband 3.15 12 Ich schwebe 2.03 Total time 64.48 Partnership: Liebe Louise Alder soprano 13 Nachtgang 3.01 Joseph Middleton piano 14 Einerlei 2.53 15 Rote Rosen 2.19 2 Singing Strauss Coming from a household filled with lush baroque music as a child, I found Strauss a little later in my musical journey and vividly remember how hard I fell in love with a recording of Elisabeth Schwarzkopf singing Vier Letze Lieder, aged about 16. I couldn’t believe from the beginning of the first song it could possibly get any more ecstatic and full of emotion, and yet it did. It was a short step from there to Strauss opera for me, and with the birth of YouTube I sat until the early hours of many a morning in my tiny room at Edinburgh University, listening to, watching and obsessing over Der Rosenkavalier’s final trio and presentation of the rose. -

Christine Brewer, Soprano and Craig Terry, Piano
Old Dominion University 2018-2019 F. Ludwig Diehn Concert Series Christine Brewer, soprano Craig Terry, piano Concert: October 15, 7:30 p.m. Master Class: October 16, 12:30 p.m. Wilson G. Chandler Recital Hall F. Ludwig Diehn Center for the Performing Arts arts@odu Program Dich, teure Halle Richard Wagner (1813 – 1883) from Tannhäuser Wesendonck Lieder Richard Wagner Der Engel Stehe Still Im Treibhaus Schmerzen Träume September Richard Strauss (1864 – 1949) from Vier Letzte Lieder Ich liebe dich Allerseelen Breit über mein Haupt Zueignung INTERMISSION With a Song in My Heart Richard Rodgers (1902 – 1979) from Spring is Here Sing to Me, Sing Sidney Homer (1864 – 1953) Review Celius Dougherty (1902 – 1986) Hickory Hill Paul Sargent (1910 – 1987) Come Rain or Come Shine Harold Arlen (1905 – 1986) I Had Myself a True Love from St. Louis Woman Happiness is Just a Thing Called Joe Harold Arlen from Cabin in the Sky When I Have Sung My Songs Ernest Charles (1895 – 1984) Love Went A-Riding Frank Bridge (1879 – 1941) An endowment established at the Hampton Roads Community Foundation, made possible by a generous gift from F. Ludwig Diehn, funds this program. Translations Dich, teure Halle – Tannhäuser Be Still! – Stehe Still! by Richard Wagner Hurrying, scurrying wheel of time Marking out eternity; You, dear hall, I greet again... Glowing spheres in distant space I gladly greet you, beloved room! Circling us with gravity; All sempiternal generation, cease! In you, I still hear his songs Enough of that – let me know peace! Which waken me from my gloomy dream When he departed from you Desist, now, creative powers; How desolate you appeared to me. -

AMS-CC Spring 2011 Final Program
AMERICAN MUSICOLOGICAL SOCIETY CAPITAL CHAPTER SPRING MEETING SATURDAY, APRIL 2, 2011 LIBRARY OF CONGRESS, WHITTALL PAVILLION, WASHINGTON, DC PROGRAM 9:00 am Coffee and Tea Session I 9:30 am Laura Youens (The George Washington University): “Franz Liszt and an African Explorer” 10:00 am Therese Ellsworth (Washington, DC): “Victorian Pianists and the Emergence of International Virtuosos: The Worldwide Tour of Arabella Goddard” Session II: Lowens Award Competition 10:30 am Robert Lintott (University of Maryland, College Park): “The Manipulation of Time in Act II of John Adams’ Doctor Atomic.” 11:00 am Christopher Bowen (The Catholic University of America): “Fusing the Romantic and the Modernist: Richard Strauss’s Songs” 11:30 am Angeline Smith (The Catholic University of America): “Wohin? Toward Rediscovering Forgotten Attributes of Schubert’s Die schöne Müllerin Through Well-Temperament Analysis” 12:00-1:30 Lunch Session III 1:30 pm Vanessa L. Rogers (Rhodes College): “The Salon of Violet Gordon Woodhouse and the Cult for Baroque Music in Early Twentieth-century England” 2:00 pm Kirstin Ek (University of Virginia): “The Common Man Meets the Matinee Idol: Harry Belafonte, Folk Identity, and the 1950s Mass Media” 2:30 pm Matt McAllister (The Florida State University and Valencia Community College): “A Spectacle Worth Attending To”: The Ironic Use of Preexisting Art Music in Three Films Adapted from Stephen King Session IV: 3:15 pm Ilias Chrissochoidis (Kluge Center, The Library of Congress): “Dramatic Pairing in Fidelio: A Structuralist Approach” 3:45 pm Paul-André Bempéchat (Center for European Studies, Harvard University): “The Location of Mendelssohn’s Culture: Religious Counterpoint, Confusion and Synthesis in the ‘Reformation’ Symphony” 4:15 pm Business Meeting ABSTRACTS (in program order) Laura Youens (The George Washington University): “Franz Liszt and an African Explorer” I was fortunate enough to inherit three letters and a music manuscript by Franz Liszt. -

Aber Der Richtige
Richard Strauss Aber der Richtige... Violin Concerto Miniatures Arabella Steinbacher WDR Symphony Orchestra Lawrence Foster Maybe it is because of my name, which my parents gave me as great Strauss lovers, that his music touches me so much. Born into a world full of singing, as a child I used to sit under the grand piano in my "music cave" while my father rehearsed with singers. The famous duet from Arabella, which my parents engraved in our banisters, has accompanied me since I can remember. This duet was finally the impetus to record an album with only works by Richard Strauss. Of course, even if the sung lyrics are missing, I have dared to sing these songs on my violin and hope that singers will forgive me. I hope you enjoy traveling through this Romantic sound world. Yours, Richard Strauss (1864-1949) Violin Concerto in D minor op. 8 (1882) 1 Allegro 15. 10 2 Lento, ma non troppo 6. 09 3 Rondo 8. 30 4 Romanze (Cello-Romanze, for violin) (1883) 9. 36 5 Little Scherzino op 3. No 4 (1881) * 4. 12 6 Zueignung op 10. No. 1 (1885) 1. 34 7 Traum durch die Dämmerung op. 29 No. 1 (1895) 2. 46 8 Cäcilie op. 27 No. 2 (1894) 2. 27 9 Wiegenlied op 41. No. 1 (1900) 4. 30 10 From “Arabella” (1933): “Aber der Richtige...“ * 5. 09 * Arranged by Peter von Wienhardt Total playing time: 60. 35 Arabella Steinbacher, violin WDR Symphony Orchestra Conducted by Lawrence Foster But the right one for me Arabella Steinbacher. -
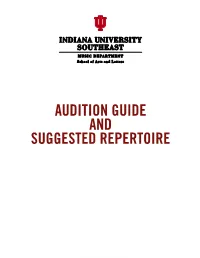
Audition Repertoire, Please Contact the Music Department at 812.941.2655 Or by E-Mail at AUDITION REQUIREMENTS for VARIOUS DEGREE CONCENTRATIONS
1 AUDITION GUIDE AND SUGGESTED REPERTOIRE 1 2 TABLE OF CONTENTS AUDITION REQUIREMENTS AND GUIDE . 3 SUGGESTED REPERTOIRE Piano/Keyboard . 5 STRINGS Violin . 6 Viola . 7 Cello . 8 String Bass . 10 WOODWINDS Flute . 12 Oboe . 13 Bassoon . 14 Clarinet . 15 Alto Saxophone . 16 Tenor Saxophone . 17 BRASS Trumpet/Cornet . 18 Horn . 19 Trombone . 20 Euphonium/Baritone . 21 Tuba/Sousaphone . 21 PERCUSSION Drum Set . 23 Xylophone-Marimba-Vibraphone . 23 Snare Drum . 24 Timpani . 26 Multiple Percussion . 26 Multi-Tenor . 27 VOICE Female Voice . 28 Male Voice . 30 Guitar . 33 2 3 The repertoire lists which follow should be used as a guide when choosing audition selections. There are no required selections. However, the following lists illustrate Students wishing to pursue the Instrumental or Vocal Performancethe genres, styles, degrees and difficulty are strongly levels encouraged of music that to adhereis typically closely expected to the of repertoire a student suggestionspursuing a music in this degree. list. Students pursuing the Sound Engineering, Music Business and Music Composition degrees may select repertoire that is slightly less demanding, but should select compositions that are similar to the selections on this list. If you have [email protected] questions about. this list or whether or not a specific piece is acceptable audition repertoire, please contact the Music Department at 812.941.2655 or by e-mail at AUDITION REQUIREMENTS FOR VARIOUS DEGREE CONCENTRATIONS All students applying for admission to the Music Department must complete a performance audition regardless of the student’s intended degree concentration. However, the performance standards and appropriaterequirements audition do vary repertoire.depending on which concentration the student intends to pursue. -

Sfkieherd Ofmusic
FACULTY AND GUEST ARTIST RECITAL THOMAS JABER AND FRIENDS: 20th ANNIVERSARY CONCERT Friday, January 30, 2009 8:00 p.m. Lillian H. Duncan Recital Hall ( sfkieherd RICE UNIVERSITY Sc~ol ofMusic rI PROGRAM Trio Sonata in A Minor Georg Philipp Telemann Andante (1681-1767) Allegro Adagio Allegro Janet Rarick, oboe Benjamin Kamins, bassoon Meditation from "Thais" Jules Massenet (1842-1912) Kenneth Goldsmith, violin Piece en forme de Habanera Maurice Ravel (1875-1937) Benjamin Kamins, bassoon I Mon cmur s'ouvre a ta voix Camille Saint-Saens 1 from Samson et Dalila (1835-1921) I Andrea Jaber, mezzo-soprano \ Siciliano in G Minor Johann Sebastian Bach (1685-1750) Leone Buyse, flute Das Fischermadchen Franz Schubert (1 1/97-1828) arr. Theobald Boehm Leone Buyse, alto flute \ 1hr Bildnis Clara Schumann (1819-1896) Allerseelen Richard Strauss Traum durch die Diimmerung (1864-1949) Nacht Morgen Zueignung Sein' wir wieder gut Richard Strauss from Ariadne auf Naxos Susanne Mentzer, mezzo-soprano Alleluia, Amen Randall Thompson from Place of the Blest (1899-1984) Vocal ensemble of undergraduate voice majors: Lauren Snouffer, Abbey Curzon, Julie Marx, Maria Failla, Rebecca Henry, Erica Schoelkopf, Erika Rodden, Sara Lemesh, Julia Holden, Rachel Womble, Quinn Shadko, Rebecca Henderson, Shelley Cantrick, Ryan Stickney La Ricordanza Vincenzo Bellini (1801-1835) Aaron Blake, tenor Fantaisie on Themes Eugene Jancourt from Bellini's "Norma" (1815-1901) Leone Buyse,flute Benjamin Kamins, bassoon Vocalise Sergei Rachmaninoff (1873-1943) Benjamin Kamins, bassoon In the Silence of the Night Sergei Rachmaninoff Spring Waters Andrea Jaber, mezzo-soprano Long Ago and Far Away Jerome Kern Smoke Gets In Your Eyes (1885-1945) All The Things You Are Thomas Jaber, piano Thank you for being with us this evening .. -

Allerseelen Cover
LIEDER ALIVE! LIEDERABEND SERIES 2012/13 Marcelle Dronkers, soprano Heidi Moss, soprano Kindra Scharich, mezzo-soprano Bryan Baker, piano The Music Salon at Salle Pianos Sunday, November 4, 2012 at 2 p.m. LIEDER ALIVE! MASTER WORKSHOP AND CONCERT SERIES ! MASTER ARTISTS LIEDER ALIVE! would like to thank the following for their priceless support: Thomas Hampson 2008 Marilyn Horne 2009 Mrs. Barbro Osher and The Pro Suecia Foundation June Anderson 2011 Håkan Hagegård 2012 Nancy Quinn, Tom Driscoll and Quinn Associates AFFILIATED MASTER ARTIST Salle Pianos and the Music Salon team Christa Ludwig Cathie Anderson Lighting CONTRIBUTING ARTISTS Heidi Melton, soprano Our invaluable Master Artists, Contributing Artists and Advisory Board Ji Young Yang, soprano Kindra Scharich, mezzo-soprano Katherine Tier, mezzo-soprano About LIEDER ALIVE! Eleazar Rodriquez, tenor Kirk Eichelberger, bass LIEDER ALIVE! was founded in 2007 by Maxine Bernstein to re-invigorate the teaching and performance of German Lieder, songs mainly from the Romantic Era of music composed for a ADVISORY BOARD solo singer and piano, and frequently set to great poetry. David Bernstein, Honorary Chair Our “graduate level” program brings outstanding master artists together with highly accomplished emerging and established professionals. The program takes place at the state-of- Alison Pybus, Executive Chair the-art San Francisco Conservatory of Music in the heart of San Francisco’s cultural district. Vice President, IMG Artists Master Workshops range from two to ten days, and are open to the public. Thomas Hampson inaugurated the program in October 2008 with a Mostly Mahler intensive Master Workshop; as John Parr Janos Gereben wrote in San Francisco Classical Voice, this event “went beyond all Collaborative Pianist, Master Coach expectations.” The following year, LIEDER ALIVE! welcomed mezzo-soprano Marilyn Horne San Francisco Opera Center Assistant to Music Director and to San Francisco for a three-day program teaching Romantic German Lieder. -

The Lieder of Richard Strauss
Central Washington University ScholarWorks@CWU All Master's Theses Master's Theses 1969 The Lieder of Richard Strauss Gary Dwight Welch Central Washington University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.cwu.edu/etd Part of the Musicology Commons Recommended Citation Welch, Gary Dwight, "The Lieder of Richard Strauss" (1969). All Master's Theses. 1244. https://digitalcommons.cwu.edu/etd/1244 This Thesis is brought to you for free and open access by the Master's Theses at ScholarWorks@CWU. It has been accepted for inclusion in All Master's Theses by an authorized administrator of ScholarWorks@CWU. For more information, please contact [email protected]. THE LIEDER OF RICHARD STRAUSS A Covering Paper Presented to the Graduate Faculty Central Washington State College In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts by Gary Dwight Welch July, 1969 ~iltu!G•ll N\ '3mqswua ~00}1103 ~·is U0\1tUNRM J'li108J AJVJ<{n ~ 1111~s ,S" h (YJ I~ '/~~S' 01 APPROVED FOR THE GRADUATE FACULTY ________________________________ John DeMerchant, COMMITTEE CHAIRMAN _________________________________ Wayne S. Hertz _________________________________ Joseph S. Haruda CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC presents in GARY D. WELCH, Baritone VIVIENNE ROWLEY JOHN DeMERCHANT, pianists PROGRAM Ru ggiero Leoncavallo ........ .... " Prologue" to Pagliacci II Richard Strauss Allerseelen Traum durch die Dammerung Stiindchen Die Nacht Cacilie INTERMISSION Ill Nicholas Flagella ............. .. ...... ........ .............. .. ........ ... ..... .. .The Land The Eagle The Owl The Snowdrop The Throstle Flower in the Cranny IV Giuseppe Verdi ..... .... ... ......... ...... .. .................. ... ... E'Sogno? f rom Falstaff Sidney Homer.. ... ...... ................. ..... .... ....... ... .. .. ........ .. .The Pauper's Drive Jean Sibelius ... ........ .... ..... .. ................. ..... ... ....... .. .......... Come Away Death Howard Hanson ..... .. .. .. .... .. .aOh , 'Tis n Earth Defiled from Merry Mount Myron Jacobson . -

Gary Hickling Collection on Lotte Lehmann ARS.0002
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt0g5022vw Online items available Guide to the Gary Hickling Collection on Lotte Lehmann ARS.0002 Andrea Castillo Stanford Archive of Recorded Sound Stanford University Libraries Braun Music Center 541 Lasuen Mall Stanford, CA 94305-3076 Phone: (650) 723-9312 Fax: (650) 725-1145 Email: [email protected] URL: http://www-sul.stanford.edu/depts/ars/ © 2006 The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. All rights reserved. Guide to the Gary Hickling 1 Collection on Lotte Lehmann ARS.0002 Guide to the Gary Hickling Collection on Lotte Lehmann Collection number: Stanford Archive of Recorded Sound Stanford University Libraries Stanford, California Processed by: Andrea Castillo Date Completed: October 2006 Encoded by: Ray Heigemeir © 2006 The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. All rights reserved. Descriptive Summary Title: Gary Hickling Collection on Lotte Lehmann Dates: 1926- 1995 Creator: Gary Hickling Collection Size: 6 linear ft. (15 boxes) Repository: Stanford Archive of Recorded Sound Stanford University Libraries Stanford, California 94305-3076 Abstract: Includes correspondence and research notes related to Hickling's discography of Lehmann performances; documemts and articles; and various sound recordings. Languages: Languages represented in the collection: English Access Collection is open for research. Listening appointments may require 24 hours notice. Contact the Archive Operations Manager. Publication Rights Property rights reside with repository. Publication and reproduction rights reside with the creators or their heirs. To obtain permission to publish or reproduce, please contact the Head Librarian of the Archive of Recorded Sound. Preferred Citation Gary Hickling Collection on Lotte Lehmann, Courtesy of the Stanford Archive of Recorded Sound, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. -

47Th SEASON PROGRAM NOTES Week 2 July 21–27, 2019
th SEASON PROGRAM NOTES 47 Week 2 July 21–27, 2019 Sunday, July 21, 6 p.m. The marking for the first movement is of study at the University of California, San Monday, July 22, 6 p.m. unusual: Allegramente is an indication Diego, in the mid-1980s that brought a new more of character than of speed. (It means and important addition to his compositional ZOLTÁN KODÁLY (1882–1967) “brightly, gaily.”) The movement opens palette: computers. Serenade for Two Violins & Viola, Op. 12 immediately with the first theme—a sizzling While studying with Roger Reynolds, Vinko (1919–20) duet for the violins—followed by a second Globokar, and Joji Yuasa, Wallin became subject in the viola that appears to be the interested in mathematical and scientific This Serenade is for the extremely unusual song of the suitor. These two ideas are perspectives. He also gained further exposure combination of two violins and a viola, and then treated in fairly strict sonata form. to the works of Xenakis, Stockhausen, and Kodály may well have had in mind Dvorˇ ák’s The second movement offers a series of Berio. The first product of this new creative Terzetto, Op. 74—the one established work dialogues between the lovers. The viola mix was his Timpani Concerto, composed for these forces. Kodály appears to have been opens with the plaintive song of the man, between 1986 and 1988. attracted to this combination: in addition and this theme is reminiscent of Bartók’s Wallin wrote Stonewave in 1990, on to the Serenade, he wrote a trio in E-flat parlando style, which mimics the patterns commission from the Flanders Festival, major for two violins and viola when he was of spoken language.