Blatt 88 Achenkirch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schützenkönig
Bataillonsschießen 2015 Schützenkönig Rg Name Wert 1 Kirchmair Josef Hinterthiersee 158,0 2 Trainer Christian Hinterthiersee 577,0 3 Moser Andreas Brandenberg 611,0 4 Schachner Simone Wörgl 866,0 5 Thaler Sebastian Schwoich 1741,0 6 Hotter Roland Langkampfen 2107,0 7 Thaler Alois Schwoich 2108,0 8 Burgstaller Gregor 3000,0 9 Embacher Bernhard Langkampfen 3000,0 10 Hintner Patrik Brandenberg 3000,0 11 Hohlrieder Johann Wildschönau 3000,0 12 Jaworek Stanis Wörgl 3000,0 13 Lechner Maria Kundl 3000,0 14 Mairhofer Anton Landl 3000,0 15 Marksteiner Stefan Kramsach 3000,0 16 Ott Kilian Wildschönau 3000,0 17 Payr Stefan Schwoich 3000,0 18 Praschberger Thomas Niederndorf 3000,0 19 Sauermoser Georg Kundl 3000,0 20 Seisl Josef Wildschönau 3000,0 21 Thaler Georg Wildschönau 3000,0 22 Unterberger Anton Langkampfen 3000,0 23 Achrainer Martina Wörgl 4000,0 24 Ampferer Manuel Brandenberg 4000,0 25 Auer Josef Brandenberg 4000,0 26 Egger Hermann 4000,0 27 Eggersberger Daniel Kufstein 4000,0 28 Freithofer Florian Bad Häring 4000,0 29 Gföller Andreas Wildschönau 4000,0 30 Gföller Hannes Wildschönau 4000,0 31 Greiderer Karl Niederndorf 4000,0 32 Gruber Josef Breitenbach 4000,0 33 Gschwentner Harald Schwoich 4000,0 34 Gschwentner Martin Schwoich 4000,0 35 Gschwentner Walter Breitenbach 4000,0 36 Gwercher Michael Brandenberg 4000,0 37 Holzknecht Daniel Kramsach 4000,0 38 Juffinger Peter Hinterthiersee 4000,0 39 Kirchmair Franz Hinterthiersee 4000,0 40 Klemt Anna Bad Häring 4000,0 Wörgl, am 09.09.2015 Wettkampfdatum: 05.09.2015 Seite 1 Mit FinePrint gedruckt - bitte bei www.context-gmbh.de registrieren. -
Alpbachtal Seenland Card
www.alpbachtal.at Card Leistungen Winter 10/11 (Seite 2-9) Services Winter 10/11 (page 10-17) Service Hiver 10/11 Alpbachtal Seenland Dein Urlaub ist nun noch mehrCard wert! (Page 18-25) Diensten winter 10/11 (pag. 26-31) Gültigkeit/validity: Alpbachtal 1.11.10 – 30.4.11 S e e n l a n d Card …und dein Urlaub ist mehr wert! 1 Die Leistungen im Überblick: » Skipass-Vorteilspreis Alpbachtal (ab 3-Tages-Skipass) gem. Preisliste. » Ski-Vorteilswochen für Familien in der Nebensaison im Skigebiet Alpbachtal* » Gratis Liftfahren für Kinder bis 15 Jahre an den Übungsliften Kramsach Lieber Alpbachtal Seenland Gast, » Gratis Liftfahren für Kinder bis 15 Jahre am Schlepplift Brandenberg » Alpbacher Hallenbad (ohne Sauna) » Regiobus Mittleres Unterinntal (VVT) wir freuen uns, dir deine persönliche Alpbachtal » Schneeschuhwandern in Alpbach » Schneeschuhwandern am Reitherkogel Seenland Card zu überreichen. Mit dieser Karte genießt » Schneeschuhwandern in Brandenberg du kostenlose Inklusiv- und Bonusleistungen, die deinen » Geführte Langlauftour in Breitenbach » Luftgewehrschießen in Breitenbach Urlaub Tag für Tag erlebnisreicher machen. Du sparst » Gäste-Biathlon in Brandenberg » Eislaufen & Schlittschuhverleih in Reith i. A. nachweislich bares Geld! » Eislaufen & Schlittschuhverleih in Kramsach » Eisstockschießen in Brandenberg & Kramsach » Gratis Rodelverleih in Münster Spannend-erholsame Urlaubstage wünschen dir » Fackelwanderung in Alpbach, Reith i. A., Kramsach und Münster dein Gastgeber & Alpbachtal Seenland Tourismus » 1 Tag Juppi Kid´s Club -

Bikekarte Achensee 2011
Ausgangspunkt in Achenkirch Ausgangspunkt in Pertisau Ausgangspunkt in Steinberg am Rofan Route 469: Achenwald - Blaubergalm Route 462: Singletrail Plumsjoch Route 465: Rund um den Guffert Vom Almgasthof Huber führt die Route zunächst auf der Via Bavarica Der Ausgangspunkt für diese Route befindet sich bei der Gern Alm (Route Vom Parkplatz am Köglboden (zwischen Achenkirch und Steinberg am Tyrolensis Richtung Achenwald. Man bleibt nach der AVANTI-Tankstelle 463). Von der Gern Alm führt nach wenigen Metern ein sehr steiler Schot- Rofan) führt die Route auf der Forststraße entlang des Filzmoosbaches bis und den letzten Häusern der Beschilderung folgend auf der Forststraße, terweg mit scharfen Kurven zum Plumssattel. zur Gufferthütte (Route 464). Von dort fährt man auf dem Bike Trail Tirol ohne nach ca. 2 Kilometer der linken Abzweigung Richtung Achenwald zu der Beschilderung „Kaiserhaus/Pinegg“ folgend zum Kaiserhaus. Über die folgen. Bei der nächsten Abzweigung kurz vor der Klammbachalm folgt 1700 Gang (Schotterstraße) führt die Route über Steinberg am Rofan zurück man rechts der Beschilderung und fährt stetig steigend Richtung Blau- 1550 zum Ausgangspunkt. bergalm. Auf selben Wegen geht es wieder retour. 1400 1250 1650 1700 1100 1500 1350 1550 950 1200 1400 800 0 1 2 2,9 1050 1250 900 1100 2,9 km 490 m 50 Minuten 1.160 m 1.650 m 750 Rad- und Mountainbikekarte 950 600 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41 800 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16,8 Route 467: Krautried Panoramaweg 41 km 980 m 3.5 Stunden 960 m 960 m 16,8 km 650 m 2.5 Stunden 900 m 1.540 m Vom Parkplatz beim Gasthof Hubertus führt die Route (Wassereinlauf) über Krautried (Aussichtspunkt) hinunter über die Perchertalstraße zur Ausgangspunkt in Hinterriss/Eng Ausgangspunkt in Maurach Pertisauer Rodlhütte und über den Senderweg zurück zum Ausgangs- punkt. -

Bezirksfeuerwehrkommando Kufstein | 6330 Kufstein Telefon: +43 (664) 4225030 | Telefon: +43 (5372) 63001 | Fax: +43 (5372) 63002
Bezirksfeuerwehrkommando Kufstein | 6330 Kufstein Telefon: +43 (664) 4225030 | Telefon: +43 (5372) 63001 | Fax: +43 (5372) 63002 vorläufige Ergebnisliste (Stand: 26.07.2014 15:27) 34. Bezirks-Nassleistungsbewerb Bezirk Kufstein 25.07.2014 - 26.07.2014 BFKDO Kufstein Rang Gruppenname Instanz AFKDO Nr. Gesamt Bezirk A - ohne Alterspunkte / BNLB Bezirk 1 Niederndorf Niederndorf Niederndorf 11 459,45 2 Aschau I Aschau Rattenberg 58 454,32 3 Brandenberg I Brandenberg Rattenberg 40 451,84 4 Reith i. A. II Reith i. A. Rattenberg 70 445,62 5 Brixlegg Brixlegg Rattenberg 62 444,78 6 Reith i. A. LZ-Naschberg Reith i. A. Rattenberg 72 441,94 7 Breitenbach 2 Breitenbach Wörgl 37 439,75 8 Rettenschöss 1.2 Rettenschöss Niederndorf 21 437,52 9 Rettenschöss 1.1 Rettenschöss Niederndorf 19 436,28 10 St.Gertraudi St.Gertraudi Rattenberg 45 426,14 11 Niederbreitenbach 1 Niederbreitenbach Langkampfen 28 422,86 12 Vorderthiersee 2 Vorderthiersee Kufstein / Thiersee 4 422,83 13 Niederndorferberg 1 Niederndorferberg Niederndorf 12 416,23 14 Niederndorferberg 2 Niederndorferberg Niederndorf 14 415,50 15 Alpbach Alpbach Rattenberg 33 412,14 16 Wörgl 3 Wörgl Wörgl 34 409,65 17 Söll 1 Söll Kirchbichl 8 408,97 18 Walchsee II Walchsee Niederndorf 53 403,26 19 Unterlangkampfen Unterlangkampfen Langkampfen 7 402,44 20 Scheffau Scheffau Kirchbichl 52 400,76 21 SANDOZ Kundl 2 SANDOZ Kundl Wörgl 22 400,16 22 Bad Häring Bad Häring Kirchbichl 23 398,64 23 Buchberg II Buchberg Niederndorf 15 396,89 24 Rattenberg2 Rattenberg Rattenberg 1 396,88 25 Schwoich 2 Schwoich Kufstein / Thiersee 39 392,16 26 Ebbs II Ebbs Niederndorf 31 391,36 27 Brandenberg IV Brandenberg Rattenberg 46 379,43 28 Kramsach Kramsach Rattenberg 26 372,63 29 Ebbs I Ebbs Niederndorf 29 369,17 30 Ellmau Ellmau Kirchbichl 24 358,40 31 Angath Angath Langkampfen 16 357,38 Bezirk B - mit Alterspunkte / BNLB Bezirk 1 Niederau Niederau Wörgl 61 459,22 2 Reith i. -

Untersuchungsergebnisse (Sortiert Nach Bezirken & Jägern)
lfd. Nr. Einsender Jäger BH Gemeinde Jagdgebiet/Revier erlegt am: Alter (j/a) Geschlecht Gewicht (kg) E. multilocularis 17 HGM Vogl Sepp Baumann Gottfried Imst Tarrenz GJ Tarrenz-Süd 11.11.2014 j m 6,4 pos. 18 HGM Vogl Sepp Baumann Franz Imst Imst GJ Angeletal-Alpei 13.11.2014 a w 6,6 neg. 341 HGM Vogl Sepp Baumann Gottfried Imst Tarrenz Tarrenz-Süd 06.02.2015 j w 5,6 pos. 408 HGM Vogl Sepp Baumann Gottfried Imst Imst Angerletal-Alpei 08.03.2015 j w 4,2 neg. 409 HGM Vogl Sepp Baumann Gottfried Imst Imst Angerletal-Alpei 09.03.2015 a w 4,8 neg. 430 HGM Vogl Sepp Baumann Gottfried Imst Tarrenz Tarrenz-Süd 07.11.2015 j m 4,8 neg. 431 HGM Vogl Sepp Baumann Gottfried Imst Imst Angerletal-Alpei 28.10.2015 j w 4,7 neg. 432 HGM Vogl Sepp Baumann Gottfried Imst Imst Angerletal-Alpei 23.11.2015 j w 5,5 pos. 433 HGM Vogl Sepp Baumann Gottfried Imst Tarrenz Tarrenz-Süd 24.11.2015 j m 5,8 pos. 437 HGM Vogl Sepp Baumann Gottfried Imst Tarrenz Tarrenz-Süd 09.12.2015 a w 4,2 neg. 25 Brunner Karl Brunner Karl Imst Längenfeld EJ Unterlängenfeld 17.11.2014 j m 4,0 neg. 343 Fallesauer Markus Fallesauer Markus Imst Nassereith Nassreith II 10.02.2015 j w 4,7 neg. 125 HGM Falkner Gerhard Frischmann Engelhard Imst Umhausen EJ Umhausen-Neder 06.01.2015 j m 5,2 neg. 41 Gabl Mario Gabl Mario Imst St. -

INNSBRUCK NEUTRAL ZONE Distanz Km Timing Höhe Platz NACH NOTIZEN Straße Dist
Stage 5 / 5 a Tappa / Etappe 5 Friday 20 April / Venerdi 20 Aprile / Freitag 20 April RATTENBERG - INNSBRUCK NEUTRAL ZONE Distanz km Timing Höhe Platz NACH NOTIZEN STRAßE Dist. Zur. Ver. 24 km/h 26 km/h 28 km/h TRATTO DI TRASFERIMENTO RATTENBERG - INIZIO TRASFERIMENTO Da Sparkassen-Platz Siedlung 0,0 1,3 10 : 40 10 : 40 10 : 40 Tenere la destra Siedlung 0,5 0,5 0,8 10 : 41 10 : 41 10 : 41 Incrocio A sinistra Dir. Kufstein B 171 Tiroler Strasse 0,1 0,6 0,7 10 : 41 10 : 41 10 : 41 Partenza - km ZERO B 171 Tiroler Strasse 0,7 1,3 0,0 10 : 43 10 : 43 10 : 42 RATTENBERG - INNSBRUCK km 164,2 Distanz km Timing Höhe Platz NACH NOTIZEN STRAßE Dist. Zur. Ver. 37 km/h 39 km/h 41 km/h 521 RATTENBERG KM "0" B 171 - Tiroler Straße 0,0 164,2 10 : 45 10 : 45 10 : 45 Kundl Sinistra Dir. Breitenbach am Inn L 48 - Biochemiestraße 6,7 6,7 157,5 10 : 55 10 : 55 10 : 54 Kundl Diritto L 48 - Doktor Hans Backmann St. 0,6 7,3 156,9 10 : 56 10 : 56 10 : 55 Kundl Rotatoria - sx Dir. Breitenbach am Inn L 48 - Breitenbach Landesstraße 0,6 7,9 156,3 10 : 57 10 : 57 10 : 56 510 Breitenbach am Inn Rotatoria - dx Dir. Mariastein, Angerberg L 211 - Dorf 0,7 8,6 155,6 10 : 58 10 : 58 10 : 57 Breitenbach am Inn Destra Dir. Mariastein, Angerberg L 211 0,6 9,2 155,0 10 : 59 10 : 59 10 : 58 Strass L 211 0,3 9,5 154,7 11 : 00 10 : 59 10 : 58 Kleinsoll L 211 1,4 10,9 153,3 11 : 02 11 : 01 11 : 00 Glatzham L 211 2,0 12,9 151,3 11 : 05 11 : 04 11 : 03 660 Angerberg L 213 2,2 15,1 149,1 11 : 09 11 : 08 11 : 07 502 Angath L 213 - Angerberger Straße 3,0 18,1 146,1 11 : 14 11 : 12 11 : 11 Ponte fiume Inn L 213 - Europastraße 0,5 18,6 145,6 11 : 15 11 : 13 11 : 12 Incrocio Sinistra Dir. -
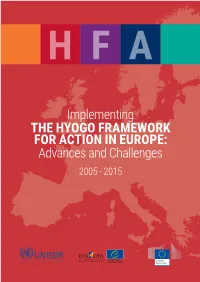
Implementing the Hyogo Framework for Action in Europe: Advances and Challenges 2005 - 2015 H F A
H F A Implementing THE HYOGO FRAMEWORK FOR ACTION IN EUROPE: Advances and Challenges 2005 - 2015 H F A Implementing THE HYOGO FRAMEWORK FOR ACTION IN EUROPE: Advances and Challenges 2005 - 2015 Table of Contents 1. HFA Expected Outcomes..............................................................................................................9 2. Main Achievements of the HFA..................................................................................................10 2.1. Strategic Goal Area 1..........................................................................................................................................10 2.2. Strategic Goal Area 2..........................................................................................................................................15 2.3. Strategic Goal Area 3..........................................................................................................................................19 3. Drivers of Progress........................................................................................................................21 3.1. Multi-Hazard Approach......................................................................................................................................22 3.2. Gender Approach...............................................................................................................................................24 3.3. Capacities Approach...........................................................................................................................................25 -

Bezirk Kufstein Rundenwettkampfkalender 2010 / 2011 Vorrunde Luftgewehr Geändert Am 23.10.2010 (Klasse 2 Und 3) Runde 1 10
Bezirk Kufstein Rundenwettkampfkalender 2010 / 2011 Vorrunde Luftgewehr geändert am 23.10.2010 (Klasse 2 und 3) Runde 1 10. November 2010 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Bruckhäusl 1-Söll 1 N-Dorf 1-Walchsee 1 Wörgl 1-Langkampf. 1 Thierberg 1-Scheffau 2 Wildschö. 1-Wildschö. 2 Erl 2-Ebbs 3 Kufstein 1-Breitenbach 1 Münster 5-Söll 4 Bruckhäusl 2-Scheffau 1 Thiersee 1-Bruckhäusl 3 Münster 3-Bruckhäusl 4 Bruckhäusl 5-N-Dorf 2 Erl 1-N-Dorf 3 Söll 3 - Brandenberg 1 Kundl 1-Breitenbach 2 Thierberg 2-Münster 6 Angerberg 1-Münster 1 Ebbs 1-Münster 2 Söll 2-Ebbs 2 Thiersee 2-Angerberg 2 Kirchbichl 1-Kramsach 1 Münster 4-Angerberg 3 Angerberg 4-Frei Frei-Langkampf. 2 Runde 2 17. November 2010 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Söll 1-Münster 1 Münster 2 - Walchsee 1 Langkampf. 1-Ebbs 2 Scheffau 2-Angerberg 2 Wildschö. 2-Kramsach 1 Ebbs 3-Angerberg 3 Breitenbach 1-Frei Langkampf. 2 - Söll 4 Angerberg 1 - Scheffau 1 Bruckhäusl 3-Ebbs 1 Bruckhäusl 4 - Söll 2 N-Dorf 2-Thiersee 2 Kirchbichl 1 - N-Dorf 3 Söll 3-Münster 4 Angerberg 4– Breitenbach 2 Münster 6-Frei Bruckhäusl 1-Bruckhäusl 2 N-Dorf 1-Thiersee 1 Wörgl 1-Münster 3 Thierberg 1-Bruckhäusl 5 Wildschö. 1-Erl 1 Erl 2-Brandenberg 1 Kufstein 1-Kundl 1 Münster 5-Thierberg 2 Runde 3 24. November 2010 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Bruckhäusl 2-Söll 1 Thiersee 1-Walchsee 1 Münster 3-Langkampf. -

Jetzt Downloaden! Bike-Panoramakarte
e s e e o e () e n g g Geißkopf di c n r 1176 e Brunstlahnerk. 1240 b 1128 1206 Bo ck w a n d S F k g Jagdhütte 1082 1131 1306 e 1522 s a Rieselsberg Bodigbergalm Gr. Nock r Steinerka e Scheiterlohalm 1351 1322 c Bayrwald-Alm 1574 Reichenböden-Jagdhütte h Mittereck Sattel H. Zwiesler i (verf.) n Guggenauer Köpfl 1343 Schanzl Lahngarten 1531 n d e r. R tba Kirchwand Große- (verf.) 1238 w b G e i ch Reichsteinalm 1376 a Kleine- Bayralm r 1127 Wolfschlucht Blauberge g Hölleialm 307 H n Langleger n r 110 5 1613 Wolfschlucht a d e e b ö Häuslalm (verf.) d Stacheleck Schildenstein 1583 Karspitz r n e ie Wilder h r h e n Brandkopf r Platteneck Blaubergkopf ac e i c M ch Verhaltensregeln n 1800 yrb r e archba e e 1458 1787 Ba b R m b g t 1863 Bayerische e 1258 s 1618 Predigtstuhl r 116 5 a r ch g r e rgs neid Halserspitze Wildalm Lochberg Achselkopf r G 1562 be g Ameiskopf Plattenalm lau Haida- n Röthenbachalm Reitbergalm B 1787 1617 Rad- und Mountainbiken ist am Achensee nur auf jene in der e e 1302 Schoberstatt Schattlahnerkopf Bairachalm Rinnerschwendter- Marchbachalm (verf.) (verf.) 1450 1441 l d Achselkopf 1315 1540 Wichtlplatte 1629 Neue he 869 Bairachalm i h 1700 Schönleitenalm 1478 Sindelsdorfer Alm ac Bikekarte angeführten Routen (offiziell genehmigte MTB-Rou- W Unt. c In der Gröb Blaubergalm Klause air Schronbachalm S 118 6 Schönleitenalm B 814 Brünstkopf 29 Schwendler- Erzherzog- F ten vom Bundesland Tirol) möglich. -

In and Around Innsbruck Is Vast Von Innsbruck Aufs Miemingertotal Plateau Length Und of Tour: Retour 80 Km Bike Point Radsport, Gumppstraße 20, Tel
THE KARWENDEL TOUR: 3 TOUR FACTS EMERGENCY REPAIRS LOCAL TOUR ADVICE AROUND THE NATURE PARK Start and finish: Innsbruck Up the mountain, through the valley, along some lakes: the tour through Elevation gain: 550 m It only takes a few minutes by road bike to get out of the city. For a Is your bike broken? Don’t worry, these eleven specialists provide help: the Karwendel mountain range is a perfect example of variety of cycling Alpin Bike, Planötzenhofstraße 16, tel. +43 664 / 13 43 230 convenient and traffic-free escape, choose one of the many broad cycle Highest point: 869 m experiences in the Alps. The trip starts with a flat entry in Innsbruck and tracks. The choice of tours available in and around Innsbruck is vast Von Innsbruck aufs MiemingerTotal Plateau length und of tour: retour 80 km Bike Point Radsport, Gumppstraße 20, tel. +43 512 / 36 12 75 R O A D continues with a tough mountain climb from Telfs to Leutasch. From and diverse, offering unique views of the city, the countryside, and the Bikes and More, Herzog-Siegmund-Ufer 7, tel. +43 512 / 34 60 10 there, several climbs and descents along the Isar river will lead you Level of difficulty: beginner alpine scenery. It provides everyone, from hobby cyclists to professional BKD, Burgenlandstraße 29, tel. +43 512 / 34 32 26 through the Karwendel mountains to the Achensee Lake. Your return to Elevation profile: athletes, with an opportunity to take on challenges appropriate to their Innsbruck will take you through the Inntal Valley. 900 Die Börse, Leopoldstraße 4, tel. -

Panorama 5/03
Klein aber Zwischen den bekannten Nachbarn Karwendel und Wilder Kaiser,südlich Foto: Werner Lang Werner Foto: der bayerisch-tirolerischen Grenze, liegt das Rofan und bietet lohnende Touren für Wanderer, Kletterer und Biker in einem vielseitigen Bergparadies. VON WERNER LANG 28 ROFAN UNTERWEGS randenberger Alpen lautet der Oberbe- sind. Am Rand des Hochplateaus im südlichen griff für die Berggruppe, der lange nicht Teil des Rofan stürzen ost- und nordseitig ein- Bso bekannt ist wie die Bezeichnung, die drucksvolle, oft mit gewaltigen Überhängen sich seit den zwanziger Jahren des letzten Jahr- und Dächern gespickte Wandfluchten bis zu hunderts für den Teil westlich der Brandenber- 400 Meter Höhe zu den Schuttkaren und Alm- ger Ache eingebürgert hat – Rofangebirge. böden ab, während die Normalwege zumeist Am westlichen Ausläufer der früher auch über mehr oder weniger steile Wiesen empor- „Sonnwendgebirge“ benannten Berggruppe ziehen. An diesen beeindruckenden Kalk- liegt der größte See Tirols, der Achensee, mit wänden mit den eingelagerten eigenartig-bun- den Orten Achenkirch und Maurach. Die süd- ten Felsbändern, Rampen und Grasbändern liche Begrenzung bildet wurde Alpingeschichte ge- das Unterinntal zwischen schrieben. Jenbach und Kramsach. An diesen Kalkwänden Durch den Bau der Schneidjoch und Guffert Rofan-Kabinenseilbahn im Norden werden eben- wurde Alpingeschichte (seit 1960) von Maurach falls dem Rofan zugerech- geschrieben zur Erfurter Hütte und net. Und auch Steinberg des Sonnwendjoch-Sessel- darf nicht unerwähnt blei- liftes (seit 1968, zwei Sek- ben, in einem großen Kessel gelegen und be- tionen) von Kramsach zur Roßkogelhütte sind liebter Ausgangspunkt besonders für Wande- Tagestouren im Kerngebiet zwischen Hochiss rungen und Klettertouren auf den Guffert, auf und Vorderem Sonnwendjoch wesentlich einfa- den Unutz, ins südliche Kerngebiet des Rofan cher geworden. -

D1 27.06.2009 Bezik (KU) Aschaz/Brandenberg Exel.Xlsx
Ergebnisliste Bezirksbewerb Kufstein Bewerb am 26./27.06.2009 in Aschau/Brandenberg Bezirk A ohne Alterspunkte Rang Feuerwehr Bezirk / Land AP Zeit Fehler Punkte 1 Reith im Alpbachtal 1 Kufstein 0 44.9 0 455.1 2 Reith im A. LZ-Naschberg Kufstein 0 52.3 0 447.7 3 St.GertrauDi 1 Kufstein 0 52.9 0 447.1 4 Aschau/BranDenberg 3 Kufstein 0 57.8 0 442.2 5 Breitenbach 1 Kufstein 0 62.0 0 438.0 6 Reith im Alpbachtal 2 Kufstein 0 53.5 10 436.5 7 Brixlegg 1 Kufstein 0 63.6 0 436.4 8 Aschau/BranDenberg 2 Kufstein 0 69.6 10 420.5 9 Ebbs 1 Kufstein 0 66.3 15 418.7 10 Söll 1 Kufstein 0 82.0 0 418.0 11 BTF SanDoz KunDl 2 Kufstein 0 78.1 5 416.9 12 Reith im Alpbachtal 3 Kufstein 0 55.1 30 414.9 13 Brandenberg 1 Kufstein 0 58.7 30 411.3 14 Schwoich 1 Kufstein 0 90.5 0 409.5 15 Scheffau 1 Kufstein 0 81.1 10 409.0 16 Rattenberg 1 Kufstein 0 91.1 0 408.9 17 Wörgl 3 Kufstein 0 81.6 10 408.4 18 VorDerthiersee 2 Kufstein 0 87.1 5 407.9 19 Wörgl 2 Kufstein 0 84.0 10 406.0 20 BaD Häring 1 Kufstein 0 93.0 5 402.0 21 Ebbs 3 Kufstein 0 80.1 20 399.9 22 Söll 2 Kufstein 0 86.4 15 398.6 23 Angath 1 Kufstein 0 103.2 0 396.8 24 BaD Häring 2 Kufstein 0 90.1 20 389.9 25 MitterlanD 2 Kufstein 0 102.8 10 387.2 26 Brandenberg 4 Kufstein 0 90.2 25 384.8 27 Angath 2 Kufstein 0 97.0 20 383.0 28 Landl 1 Kufstein 0 87.5 30 382.6 29 KunDl 2 Kufstein 0 97.7 20 382.3 30 NieDerbreitenbach 1 Kufstein 0 96.6 25 378.4 31 NiedernDorf 1 Kufstein 0 92.3 30 377.7 32 Münster 3 Kufstein 0 95.8 35 369.2 33 Alpbach 3 Kufstein 0 112.8 20 367.2 34 RaDfelD 1 Kufstein 0 104.8 30 365.2 35 Bruckhäusl