Saarlorlux Et En Europe Vincent Goulet, Christoph Vatter
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

REPORT from the 1St Policynet Study Visit to the Grande Region
“Regional Support for Inclusive Education” REPORT from the 1st PolicyNet Study Visit to the Grande Region “Region to region – exchange of educational experience” Background The project “Regional Support for Inclusive Education”promotes the concept of inclusive education in South East Europe (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia, "the former Yugoslav Republic of Macedonia" and Kosovo1) as a reform principle that respects and caters for diversity amongst all learners, with a specific focus on those who are at a higher risk of marginalisation and exclusion. The Project supports and facilitates a multi-level, cross-sectorial regional network (Inclusive PolicyNet) with a constant composition, representing a broad range of stakeholders (policymakers - from education, social protection and healthcare sectors, from the central and local level; practitioners – school principals, members of school boards, representatives of education inspectorates, researchers and teacher educators, civil society representatives, parents) to exchange experience and discuss inclusive education issues, as well as common challenges and promising policy approaches or examples of good practice from the European Union and the region. Within the project, The “Inclusive PolicyNet” will produce concrete policy recommendations at each education level (Primary Education, General Secondary Education and Vocational Education and Training). As capacity building and policy learning activity the study visit to Greater Region was organized for seven (7) Inclusive PolicyNet members. The Greater Region is the area of Saarland, Lorraine, Luxembourg, Rhineland-Palatinate, Wallonia and the rest of the French Community of Belgium, and the German-speaking Community of Belgium. This region has a similar heritage but also rich diversity and was therefore an excellent partner for mutual learning and exchange of experience with similar yet diverse South East Europe. -

The European Committee of the Regions and the Luxembourg Presidency of the European Union
EUROPEAN UNION Committee of the Regions © Fabrizio Maltese / ONT The European Committee of the Regions and the Luxembourg Presidency of the European Union 01 Foreword by the president of the European Committee of the Regions 3 02 Foreword by the prime minister of the Grand Duchy of Luxembourg 5 03 Role of the European Committee of the Regions 7 04 The Luxembourg delegation to the European Committee of the Regions 10 Members of the Luxembourg delegation 10 Interview with the president of the Luxembourg delegation 12 Viewpoints of the delegation members 14 05 Cross-border cooperation 22 Joint interview with Corinne Cahen, Minister for the Greater Region, and François Bausch, Minister for Sustainable Development and Infrastructure 22 Examples of successful cross-border cooperation in the Greater Region 26 EuRegio: speaking for municipalities in the Greater Region 41 06 Festivals and traditions 42 07 Calendar of events 46 08 Contacts 47 EUROPEAN UNION Committee of the Regions © Fabrizio Maltese / ONT Foreword by the president of the 01 European Committee of the Regions Economic and Monetary Union,, negotiations on TTIP and preparations for the COP21 conference on climate change in Paris. In this context, I would like to mention some examples of policies where the CoR’s work can provide real added value. The European Committee of the Regions wholeheartedly supports Commission president Jean-Claude Junker’s EUR 315 billion Investment Plan for Europe. This is an excellent programme intended to mobilise public and private investment to stimulate the economic growth that is very The dynamic of the European Union has changed: much needed in Europe. -
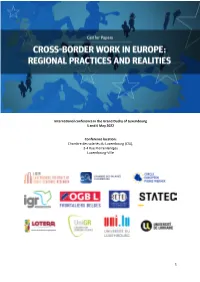
Call for Papers
International conference in the Grand Duchy of Luxembourg 5 and 6 May 2022 Conference location: Chambre des salariés du Luxembourg (CSL), 2-4 Rue Pierre Hentges Luxembourg-Ville 1 Topic of the conference Living in one country and working in another is a daily reality for thousands of people in Europe. Taking into account the EU-28 countries and the European Free Trade Association (EFTA) countries, the total number of frontier workers in Europe was 1.9 million in 2017 (European Commission, 2018). The growth of flows of cross-border work, as well as its socio-economic, political and legal dimensions, are increasingly relevant to further analysis. It is a subject at the center of much analysis in different disciplines in the social sciences, humanities and environmental studies. Cross-border work has developed between European countries long before the foundation of the European Economic Community established by the Treaty of Rome (Lentacker, 1973; Ricq, 1981). Cross-border work has become an important economic, social and human phenomenon within border territories in Europe (Van Houtum, 2000; Haas and Osland, 2014; Rietveld, 2012), the characteristics of which will be questioned during the conference. The main countries of residence of cross-border commuters are France (405,000 or 21% of the total number of cross-border commuters), Germany (249,000 or 13%) and Poland (202,000 or 11%) (European Commission, 2018). The main countries of employment are Germany (391,000), Switzerland (387,000), Luxembourg (186,000) and Austria (175,000) in 2017. As shown by studies on the Greater Region (Saar-Lorraine-Luxembourg-Wallonia-Rhineland- Palatinate), one of the most important areas of cooperation in Europe (Wille, 2012; Belkacem/Pigeron-Piroth, 2012; Wille, 2016; Wille/Nienaber 2020), the geographical situation on the border, the regulatory standardisation of cross-border work, the connection of spaces by traffic infrastructures, etc. -

Organising Transregional Child Protection Within the Greater Region of France, Germany, Belgium and Luxembourg
Social Work & Society ▪▪▪ C. Schröder & U. Zöller: Organising Transregional Child Protection within the Greater Region of France, Germany, Belgium and Luxembourg Organising Transregional Child Protection within the Greater Region of France, Germany, Belgium and Luxembourg Christian Schröder, htw saar Ulrike Zöller, htw saar 1 Introduction In the Interreg research project, EUR&QUA (2016-2020), we observed the transregional organisation of child protection in the Greater Region. By referring to the concept of transregional organisation of child protection, we emphasise our perspective in researching the constituting role of boundary-crossing interactions as a characteristic of the modern world. The Greater Region provides a specific example for this. The Greater Region (formerly the SaarLorLux Region) extends over the borders of four nations (the German states of Saarland and Rhineland-Palatinate, the French region of Lorraine, the Grand Duchy of Luxembourg and the Belgian region of Wallonia as well as the German-speaking community in East Belgium). It can be characterised as a European cooperation area (Schriftenreihe der Großregion, 2018, p. 9). Crossing borders in the Greater Region is part of everyday life for the adults living here. It is interesting to note that children in the Greater Region also cross borders in the context of child and youth welfare. However, the effects of this particular type of border crossing on children, their parents, their siblings and the child and youth welfare organisations are still largely unknown. The nation state forms the quasi natural point of reference in social work. This methodological nationalism (Beck, 2010) has been increasingly questioned in social work against the background of phenomena that cross nation-state borders (Bähr et al., 2014; Schwarzer et al., 2016). -

196 Residencies in France
CONTEMPORARYGUIDES TO CAPTURES VILLE D'ÉLANCOURT – ESPACE CULTUREL FERME DU MOUSSON ART AMALGAME LE POINT DU JOUR – CENTRE DENA FOUNDATION D’ART LE GRAND CAFÉ ÉCOLE MUNICIPALE LYCÉE AGRICOLE LA MÉTIVE D’ARTS PLASTIQUES FRAC CORSE DÉPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON FRAC ALSACE DE LA PEYROUSE WHARF - MAISON DE LA FAÏENCE ASTÉRIDES SHAKERS – LIEUX D'EFFERVESCENCE MODE D’EMPLOI CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LA GALERIE DU THÉÂTRE DE BASSE-NORMANDIE ÉCOLE D’ARTS LA PASSERELLE DE RUEIL-MALMAISON MAISON JEAN CHEVOLLEAU SCÈNE NATIONALE AADN LABOMEDIA ASSOCIATION FRAC LORRAINE LA MALTERIE FRAC FRANCHE-COMTÉ ESPACE CULTUREL ARTCONNEXION FRANÇOIS MITTERRAND CENTRE D’ART ECOLE SUPÉRIEURE CONTEMPORAIN D’ART DE DIJON LES ATELIERS DE L'IMAGE / ÉCOLE MUNICIPALE DE PONTMAIN ÉCOLE D’ART LA TRAVERSE LE POINT ÉPHÉMÈRE DES BEAUX-ARTS / GALERIE DU BEAUVAISIS EDOUARD MANET ATELIERS – RUE FESH TRIANGLE APPLEBOOM LA POMMERIE LIEU D’ART CONTEMPORAIN CRAFT CENTRE CULTUREL PEUPLE ET CULTURE LES SILOS, ATELIER CALDER CENTRE DE RECHERCHE COLOMBIER SUR LES ARTS DU FEU ASSOCIATION MAISON DU LIVRE ARTISTE RENCONTRE ET DE LA TERRE LA FRATERNELLE ET DE L’AFFICHE TERRITOIRE SCOLAIRE FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE CHAMALOT – KADIST ART FOUNDATION RÉSIDENCE D’ARTISTES LUX SCÈNE NATIONALE DE VALENCE THE CAMARGO FOUNDATION EPL DE L’AUBE, LYCÉE AGRICOLE (LEGTA) SUR LE SENTIER CHARLES BALTET DES LAUZES 196 VOYONS VOIR MUSÉE DE L’ABBAYE THÉÂTRE DE LA CITÉ DE SAINT CLAUDE INTERNATIONALE ARTOTHÈQUE DE L’AISNE MAINS D’ŒUVRES LE CAP (CENTRE D’ARTS EN ATTENDANT LES CERISES PLASTIQUES) PRODUCTIONS -

Véloroute Saar-Lor-Lux 8Ème Étape Vic-Sur-Seille Metz
Véloroute Saar-Lor-lux 8ème étape Vic-sur-Seille Metz 8ème étape sur les berges de la Seille de www.luxvelo.lu de Vic-sur-Seille à Metz par Nomeny et Marly 70 km Quattropole à vélo Véloroute Saarlorlux 8ème étape 70 km En savoir plus de Vic-sur-Seille à Metz Luxembourg-Trêves-Sarrebrück-Metz 500 km en 10 étapes 76% sur Voie Verte ou piste www.luxvelo.lu Page !X!2 Véloroute Saarlorlux Informations générales 8ème étape 70 km de Vic-sur-Seille à Metz Départ : Vic-sur-Seille (48,78272- 6,53066) Arrivée : Metz (49,10805-6,18546) Distance : 70 km Difficulté : voir profil gpx ci-contre Sécurité : attention, on est sur la route Metz de Vic-sur-Seille à Pommerieux. Voie Verte ensuite. Signalétique : inexistante Villes et villages traversés: Vic-sur-Seille (km 0), Salonnes (km 3,0), Chambrey (km 6,0), Pettoncourt (km 11,0), Attilloncourt (km 13,0), Bioncourt (km 14,5), Brin-sur-Seille (km 16,0), Bey-sur-Seille (km 17,0), Lanfroicourt (km 20,0), Armaucourt (km 22,5), Arraye et Han (km 25,5), Jeandelaincourt (km 30,0), Nomeny (km 36,0), Rouves (km 38,5), Eply (km 42,0), Cheminot (km 47,0), Nomeny Sillegny (km 52,0), Coin-sur-Seille (km 54,5), Pournois-la-Chétive (km 55,5), Coin-les-Cuvry (km 58,0), Cuvry (km 59,5), Marly (km 62,0), Metz-Magny (km 65,0), Metz Pompidou (km 70,0). Télécharger la trace gpx Vic-sur-Seille Télécharger la carte www.luxvelo.lu Page !X!3 Vic-sur-Seille (km 0) Véloroute Saarlorlux 8ème étape 70 km de Vic-sur-Seille à Metz En savoir plus Place Jeanne d’Arc Château des Evêques de Metz En savoir plus Musée Georges de la Tour -
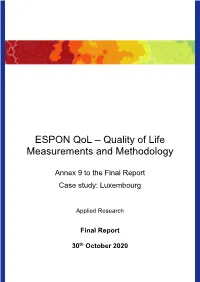
ESPON Qol – Quality of Life Measurements and Methodology
ESPON QoL – Quality of Life Measurements and Methodology Annex 9 to the Final Report Case study: Luxembourg Applied Research Final Report 30th October 2020 Final Report This applied research activity is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. This delivery does not necessarily reflect the opinion of the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Project team Carlo Sessa, Giorgia Galvini, Institute of Studies for the Integration of Systems – ISINNOVA (Italy) Oriol Bioscal, Harold del Castillo, MCRIT (Spain) Herta Tödtling-Schönhofer, Alina Schönhofer, Metis (Austria) Daniel Rauhut, Teemu Makkonen, University of Eastern Finland – UEF (Finland) Maarten Kroesen, TUDelft (Netherlands) Author of the case study Dr Thomas Stumm, EureConsult (Luxembourg) Project Support Team Sabine Stölb LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Département de l’aménagement du territoire Janja Pečar REPUBLIKA SLOVENIJA URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Anna Lea Gestsdóttir Byggðastofnun Icelandic Regional Development Institute ESPON EGTC: Project Expert: Sandra Di Biaggio Financial Expert: Caroline Clause Information on ESPON and its projects can be found on www.espon.eu. The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. © ESPON, 2020 Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON EGTC in Luxembourg. -

Großregion Saarlorlux
Großregion SaarLorLux Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit deutscher Beteiligung Erfahrungsaustausch 2012: 17. –18. September 2012, Berlin Dr. Martin Niedermeyer Saarland, Ministerium für Finanzen und Europa Abteilung E – Europa, Interregionale Zusammenarbeit Leiter des Referates E/4 – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit SaarLorLux Chancen und Perspektiven der grenzüberschreitender Kooperation in der Großregion SaarLorLux Trombinoskop governance Fallbeispiele Europa-Denkmal in Schengen (Luxemburg) 17.9.2012 Seite/Page 2 Trombinoskop der Großregion SaarLorLux Seite/Page 3 Die Großregion SaarLorLux – eine „Region“? Die Großregion SaarLorLux 11,3 Mio. Einwohner 4,7 Mio. Arbeitskräfte 200.000 Grenzpendler 65.400 km² Fläche 5 Regionen 4 Länder 3 Sprachen der grenzüberschreitenden Nr. 1 Arbeitsmarktregionen Europas Seite/Page 4 „Variable Geometrien“ grenzüberschreitender Kooperationsräume Grenzüberschreitende Regionen in Europa EUREGIO (Gronau) Regio Basiliensis Maas-Rhein Ems-Dollart rhein-maas-nord Rhein-Waal PAMINA Einwohner Neiße Fläche (Mio.) Erzgebirge (1000 km²) Elbe-Labe Pomerania Bayr.Wald/B. Egrensis Spree-Neiße-Bober Viadrina Inn-Salzach Salzb./B./Traunst. Gipfel Großregion 12 10 8 6 4 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Seite/Page 5 Lage von SaarLorLux in Europa SaarLorLux „Blaue Banane“ Europäische Metropole Die großen Wirtschaftszentren Hauptachsen der inter- nationalen Integration durch Verkehrsnetze Mitteleuropäische Städteachse Atlantischer Bogen Die Peripherien, abseits der großen Binnenentwicklungsachsen Zurückgebliebene Räume -

Grenzüberschreitende Alltagspraktiken in Der Großregion Saarlorlux: Eine Bestandsaufnahme
Grenzüberschreitende Alltagspraktiken in der Großregion SaarLorLux: eine Bestandsaufnahme Christian Wille Gegenstand dieses Beitrags sind Alltagspraktiken, die von den Einwohnern des Saarlandes, Lothringens, Luxemburgs, von Rheinland-Pfalz und Wallonien grenzüberschreitend ausgeführt werden. Das bedeutet, ungeachtet der Diskus- sion um den Praktikenbegriff (vgl. Hillebrandt 2014; Wille 2014; Schäfer 2013) werden hier verschiedene Aspekte von regelmäßig und unhinterfragt stattfin- denden Aktivitäten behandelt, die in einem anderen Land als dem Wohnland ausgeführt werden. In diese Betrachtung einzubeziehen ist die Dimension der regelmäßigen physischen Mobilität, und zwar unter transnationalem Vorzei- chen, handelt es sich bei grenzüberschreitenden Alltagspraktiken doch um routinierte Aktivitäten, verbunden mit einer zirkulären (Pendel-)Bewegung, die sich über benachbarte nationale Territorien erstreckt. Hierbei ist vorauszu- schicken, dass in der Großregion SaarLorLux bereits ausgeprägte grenzüber- schreitende Mobilitätsphänomene auszumachen sind: Mobilität im Kontext von Erwerbsbeschäftigung (vgl. Wille 2015 und 2012; Belkacem/Pigeron-Piroth in diesem Band) und im Kontext von Wohnmigration (vgl. Wille 2014 und 2011; Boesen/Schnuer in diesem Band). In diesem Beitrag allerdings wird auf die mit diesen Mobilitätsphänomenen teilweise im Zusammenhang stehende grenz- überschreitende Mobilität im Kontext von Alltagspraktiken eingegangen. Da- für leitend ist die Überlegung, dass sich die Großregion SaarLorLux anhand der grenzüberschreitenden Ausführungen -

Grenzüberschreitendes Arbeiten in Der Großregion Saarlorlux
Schriften der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt Grenzüberschreitendes Arbeiten in der Großregion SaarLorLux Das Saarland, Lothringen, die Provinz Luxemburg, die Westpfalz, sie alle verbindet, dass sie sich in Bezug auf ihren jeweiligen National- staat in einer Randlage befinden. Die daraus resultierenden Nach- teile lassen sich nur durch eine konsequente Zusammenarbeit mit den Nachbarn auf der anderen Seite der Grenze reduzieren. Dies ist nicht nur im wirtschaftlichen Interesse der Menschen in dieser Herausgegeben von Region. Soll diese Zusammenarbeit aber nachhaltig wirken, dann muss sie die Menschen mit all ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt Jürgen Meyer stellen und darf sich nicht allein auf die wirtschaftlichen Interessen beschränken. Ein weites Arbeitsfeld für die kommenden Jahre, das Luitpold Rampeltshammer es auch mit Hilfe der Wissenschaft zu beackern gilt. Den Hochschu- len in der Region kommt dabei eine zentrale Rolle zu, sind sie es doch, die einerseits mittels der Forschung zu einer Erhellung der Problematik und zu einem Aufzeigen von Entwicklungspfaden beitragen und andererseits für einen immer größer werdenden Teil von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern die nötigen Qualifi- kationen vermitteln. Vor diesem Hintergrund hat der Beirat der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt im Jahre 2010 die Forschungsaus- schreibung „Grenzüberschreitendes Arbeiten in der Großregion SaarLorLux“ beschlossen. Die Beiträge in diesem Band sind das Ergebnis dieser Forschung. Sie zeigen, dass es eine lebhafte grenz- überschreitende Zusammenarbeit in der Region gibt, die in ihrer Dichte innerhalb der Europäischen Union eine Besonderheit dar- stellt. Eine Zusammenarbeit, die insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden demographischen Wandels, der Diskussion um zu- künftige Fachkräfte für die heimische Wirtschaft und dem Bemühen um eine nachhaltige Energieversorgung weiter vorangetrieben und gestaltet werden muss. -

Spaces and Identities in Border Regions
5. Space and Identity Constructions through Everyday-Cultural Practices 305 5.6 PERIURBAN LUXEMBOURG. DEFINITION, POSITIONING AND DISCURSIVE CONSTRUCTION OF SUBURBAN SpaCES AT THE BORDER BETWEEN CITY AND COUNTRYSIDE Markus Hesse “[…] The in-between city represents places that are ‘not quite traditional city and not quite traditional suburban’ (Young and Keil, 2010). They are forgotten geographies, where many people live and where […] the dialectical treatment of urban versus suburban neglects the many shades of urban places that require our planning and policy attention” (Kirby/ Modarres 2010: 67). The expansion of urban settlements beyond the borders of the (nucleus) city into previously non-urban spaces is a central feature of spatial development of the pre- and postwar period in the overwhelming majority of western industrialized nations, in Europe as much as in North America and Australia (see Harris/Larkham 1999). Point of departure of this process are the migrations from city to hinterland of households or enterprises, particularly industry, later also of commerce as well as recreational facilities. Ever since the onset of industrialization, more or less continuous population and employment growth has been over lengthy periods the normal mode of urban development. This has produced polycentric urban regions that display very diverse structures (see Kloosterman/Musterd 2001; Parr 2004). Scientific analysis in geography and spatial research has traditionally assigned the term of suburbanization to the expansion of the city beyond its borders (see Pratt 1994; Harris 2006); in francophone countries, this is also referred to as périurbanisation (see Paluch 1997; Piorr et al. 2011). This term also includes spaces that are further removed from the centre, spaces whose development is defined in English-speaking countries with the term of counterurbanization (see Champion 1989; Mitchell 2004). -

The Saarmoselle Eurodistrict Takes Off!
No. 59 - May 2010 Stefan Toscani The SaarMoselle Eurodistrict takes off! Minister of the interior After intensive preparation, the and European affairs SaarMoselle Eurodistrict was of Saarland officially established on 6 May 2010 (Germany) in Saarbrücken. Taking the form of an EGTC, it will broaden and facilitate cooperation between the partners of the SaarMoselle Was it by chance that conurbation, which has 600,000 Robert Schuman, the father inhabitants. of Europe, came from a "seam" region located at Welcomed by Pierre Lellouche, French the heart of the European continent? Probably secretary of state for European affairs, not. Today, as at the time, the common historical and Stephan Toscani, Saarland heritage represents the future prospect of minister of the interior and European Europe as he described it in his declaration of 9 affairs, a large number of elected M60May, 60 years ago. FShFor Schuman, bthboth a representatives, regional figures and Lorrainer and a Luxemburger, the common citizens assembled in Saarbrücken’s Charlotte Britz welcomed minister Pierre Lellouche at cross-border life, like the dividing effect of the official launch ceremony on 6 May in Saarbrücken. French-German garden to bring the borders, was a day-to-day reality. From this Eurodistrict into being. historical knowledge was born a "small Europe" public transport. under the name "SaarLorLux Grande Region". For Charlotte Britz, mayor of Saarbrücken Pierre Lellouche took advantage of this visit The region, with its constituent partners in and new president of the EGTC, "The to the border to meet a delegation from the Belgium (Walloon region and German-language European Union is still just a very abstract border workers defence committee, and community), Lorraine, Luxemburg, Saarland and concept, too distant from its citizens, too Rhineland-Palatinate, is unique in Europe in its bureaucratic and too paternalistic with discussed some highly practical issues with diversity.