Kunden PDF Von Repromedia Wien
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Royal House of Troy Ruling Kings and Queens of Troy
11/15/2018 Royal House - The Kingdom of Troy The Royal House of Troy King Priam was the last ancient King of Troy before the Trojan War. It is said that K ing Priam had as many as 50 children, but the most commonly known are by his first wife Princess Arisbe of Percote, Aesacus the Seerer and by his second wife Princess Hecuba of Phrygia, Hector, Paris, Cassandra, Helenus, Deiphobus. Helenus was the only son of King Priam to survive the Trojan War, and Hecuba, along with all of King Priam's daughters were enslaved by the Greek Kings. Her Royal Highness de jure Queen Krystal is descendant of Helenus. Ruling Kings and Queens of Troy and the Line of Succession Ilus of Troy (founder of the Hellenic city of Troy) Laomendon Priamos (com monly known as Priam) Helenus Genger Franco Esdron Gelio Basab iliano Plaserio I Plesron Eliaor Gaber iano Pleserio II Atenor I Priam I Helenu s II Plesron Basabilia no Alexandre Priam II Getmalr Almadie n Diluglic Helenus III Pleserio III Duluglio Marcomir Priam III Artenor K ing of Cimmerians Ephraim Marcomir Atenor II Priam IV Helenus IV Diocles Diocles Clodom ir Nicanor Marcom ir II Clodius Atenor I II Clodomir II Merodochu s Cassander o f Sicambria Antharius of Sicambria Francus King of West F ranks Clodius II King of Franks Marcomir III King of Fran ks Clodomir III King of Franks Atenor IV King of Franks Richemer King of Franks Odomir IV King of Franks Marcomir IV King of Frank s http://thekingdomoftroy.weebly.com/royal-house.html 1/3 11/15/2018 Royal House - The Kingdom of Troy Clodomir IV King of Franks Faraber King of Franks Sunno King of Franks Hilderic King of Franks Bartherus King of Fran ks Clodius III King of Franks Walter King of Franks Dagobert King of Fran ks Genebald King of Franks Dagobert II King of Frank s Clodius IV King of Franks Marcomir V King of Frank s Pharamond King of Franks Clodius of Cologne Childebert of Colog ne Sigebert of Cologne Cloderic of Cologne Munderic of Vitry-En -Perthois St. -

THE EPONYMOUS OFFICIALS of GREEK CITIES: I Aus: Zeitschrift Für Papyrologie Und Epigraphik 83 (1990) 249–288
ROBERT K. SHERK THE EPONYMOUS OFFICIALS OF GREEK CITIES: I aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 83 (1990) 249–288 © Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 249 The Eponymous Officials of Greek Cities: I (A) Introduction The eponymous official or magistrate after whom the year was named in Greek cities or as- sociations is well known to all epigraphists under various titles: archon, prytanis, stephanepho- ros, priest, etc. Some details about them have appeared in many articles and in scattered pas- sages of scholarly books. However, not since the publication of Clemens Gnaedinger, De Graecorum magistratibus eponymis quaestiones epigraphicae selectae (Diss. Strassburg 1892) has there been a treatment of the subject as a whole, although the growth of the material in this regard has been enormous.1 What is missing, however, is an attempt to bring the material up to date in a comprehensive survey covering the whole Greek world, at least as far as possible. The present article, of which this is only the first part, will present that material in a geographically organized manner: mainland Greece and the adjacent islands, then the Aegean islands, Asia Minor and Thrace, Syria, Egypt, Cyrene, Sicily, and southern Italy. All the epi- graphic remains of that area have been examined and catalogued. General observations and conclusions will be presented after the evidence as a whole has been given. I. Earliest Examples of Eponymity The earliest form of writing appeared in Sumer and Assyria sometime within the last half of the fourth millennium BC, and from there it spread westward. Thus, it is not at all surpris- ing that the Mesopotamian civilizations also made the earliest use of assigning names or events to years in dating historical records. -

Handel's Oratorios and the Culture of Sentiment By
Virtue Rewarded: Handel’s Oratorios and the Culture of Sentiment by Jonathan Rhodes Lee A dissertation submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Davitt Moroney, Chair Professor Mary Ann Smart Professor Emeritus John H. Roberts Professor George Haggerty, UC Riverside Professor Kevis Goodman Fall 2013 Virtue Rewarded: Handel’s Oratorios and the Culture of Sentiment Copyright 2013 by Jonathan Rhodes Lee ABSTRACT Virtue Rewarded: Handel’s Oratorios and the Culture of Sentiment by Jonathan Rhodes Lee Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Davitt Moroney, Chair Throughout the 1740s and early 1750s, Handel produced a dozen dramatic oratorios. These works and the people involved in their creation were part of a widespread culture of sentiment. This term encompasses the philosophers who praised an innate “moral sense,” the novelists who aimed to train morality by reducing audiences to tears, and the playwrights who sought (as Colley Cibber put it) to promote “the Interest and Honour of Virtue.” The oratorio, with its English libretti, moralizing lessons, and music that exerted profound effects on the sensibility of the British public, was the ideal vehicle for writers of sentimental persuasions. My dissertation explores how the pervasive sentimentalism in England, reaching first maturity right when Handel committed himself to the oratorio, influenced his last masterpieces as much as it did other artistic products of the mid- eighteenth century. When searching for relationships between music and sentimentalism, historians have logically started with literary influences, from direct transferences, such as operatic settings of Samuel Richardson’s Pamela, to indirect ones, such as the model that the Pamela character served for the Ninas, Cecchinas, and other garden girls of late eighteenth-century opera. -

Tra Atene E La Persia Le Città Greche D'asia Nel V Sec. A.C
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dottorato di Ricerca in Filologia e Storia del Mondo Antico Giuseppe Bonaccorso Tra Atene e la Persia: le città greche d’Asia nel V sec. a.C. __________________ Tesi di dottorato Ciclo: XXIX Curriculum: Storia Antica Tutor: Prof. Francesco Guizzi Co-Tutor: Prof. Pietro Vannicelli INDICE INTRODUZIONE………………………………………………… 4 Capitolo Primo DALLA BATTAGLIA DI MICALE ALLA BATTAGLIA DELL’EURIMEDONTE (479-466 A.C.) 1.1 La battaglia di Micale e la ‘seconda rivolta ionica’............................................. 13 1.2 L’integrazione dei Greci d’Asia nell’organizzazione imperiale achemenide....... 17 1.3 Dopo Micale: la reazione persiana........................................................................ 26 1.4 Dopo Micale: la reazione greca............................................................................ 32 1.5 La fondazione della Lega delio-attica e la questione della composizione originaria 36 1.6 L’influenza persiana sulle città costiere dell’Egeo................................................ 45 1.7 Il caso della città ionica di Teo.............................................................................. 56 1.8 Il primo decennio della Lega delio-attica e la battaglia dell’Eurimedonte........... 66 Capitolo Secondo DALL’ASCESA DI ARTASERSE ALLA ‘PACE DI CALLIA’ (465-449 A.C.) 2.1 L’ascesa di Artaserse e la ripresa delle ostilità tra Atene e la Persia.................. 80 2.2 Il disertore Temistocle al servizio del Gran Re in Asia Minore.......................... 89 2.3 La -

Wonder, Space, and Place in Pausanias' Periegesis
Axion Theas: Wonder, Space, and Place in Pausanias’ Periegesis Hellados by Jody Ellyn Cundy A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Classics University of Toronto © Copyright by Jody Ellyn Cundy 2016 Axion Theas: Wonder, Space, and Place in Pausanias’ Periegesis Hellados Jody Ellyn Cundy Doctor of Philosophy Department of Classics University of Toronto 2016 Abstract The Periegesis Hellados presents a description of the sites and sights of Roman Greece in ten carefully constructed books. These books present the fruits of author’s extensive travels and careful textual research over the course of several decades (between the 130’s and ca. AD 175-80) and compiled into a unified composite itinerary. There is no doubt that Pausanias travels through an “already written landscape,” and his travel experience is necessarily informed by and sometimes clearly motivated by his literary encounters. This project investigates Pausanias’ engagement with literary antecedents, with a particular focus on the antiquarian impulse to excerpt and compile anecdotes in thematic catalogues, which broadly resemble wonder-texts (paradoxographies). The organizing principle of these thematic catalogues contrasts with the topographical (spatial) structure of the frame narrative of the Periegesis. In part, this study aims to resolve the perceived tension between the travel account and the antiquarian mode in Pausanias’ project in order to show that they serve complementary rather than competing ends. Resolution of these competing paradigms allows in turn for a more coherent understanding of the Periegesis as unified subject. This study argues that wonder (thauma) is a unifying theme ii of Periegesis Hellados. -

And KEEPING up with the PERSIANS Some Reflections on Cultural Links in the Persian Empire
Working draft, not for distribution without permission of the author 1 ‘MANNERS MAKYTH MAN’ and KEEPING UP WITH THE PERSIANS Some reflections on cultural links in the Persian Empire Christopher Tuplin (University of Liverpool) Revised version: 9 June 2008 The purpose of the meeting (according to the web site) is to explore how ancient peoples expressed their identities by establishing, constructing, or inventing links with other societies that crossed traditional ethnic and geographic lines. These cross-cultural links complicates, undermine, or give nuance to conventional dichotomies such as self/other, Greek/barbarian, and Jew/gentile In the Achaemenid imperial context this offers a fairly wide remit. But it is a remit limited – or distorted – by the evidence. For in this, as in all aspects of Achaemenid history, we face a set of sources that spreads unevenly across the temporal, spatial and analytical space of the empire. For what might count as an unmediated means of access to a specifically Persian viewpoint we are pretty much confined to iconographically decorated monuments and associated royal inscriptions at Behistun, Persepolis and Susa (which are at least, on the face of it, intended to broach ideological topics) and the Persepolis Fortification and Treasury archives (which emphatically are not). This material is not formally or (to a large extent) chronologically commensurate with the voluminous, but unevenly distributed, Greek discourse that provides so much of the narrative of Achaemenid imperial history. Some of it may appear more commensurate with the substantial body of iconographically decorated monuments (most not associated with inscriptions) derived from western Anatolia that provides much of the material in the two papers under discussion. -
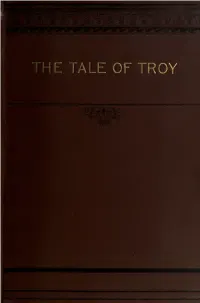
The Tale of Troy
THE TALE OF TROY WITH THE PUBLISHERS' COMPLIMENTS. THE TALE OF TROY DONE INTO ENGLISH BY AUBREY STEWART, M.A. LATE FELLOW OF TRINITY COLLEGE, CAMBRIDGE. ^London MACMILLAN AND CO. AND NEW YORK 1886 D CONTENTS CHAP. PAGE i. How Paris carried off Helen . i ii. How the Heroes gathered at Aulis 13 in. How Achilles quarrelled with Agamemnon . 27 iv. How Paris fought Menelaus . 45 v. How Hector fought Ajax . .61 vi. How Hector tried to burn the Ships 87 vii. How Patroclus lost the Arms of Achilles . .109 vni. How Achilles slew Hector . .129 ix. How the Greeksfought the Amazons 147 x. How Paris slew Achilles . .167 xi. How Philoctetes slew Paris . 193 xn. How the Greeks took Troy . .215 HOW PARIS CARRIED OFF HELEN B CHAPTER I g earned off upon a time there lived a king ONCEand queen, named Tyndareus and Leda. Their home was Sparta, in the plea- sant vale of Laconia, beside the river Eurotas. They had four children, and these were so beautiful that men doubted whether they were indeed born of mortal parents. Their two sons were named Castor and Polydeuces. As they grew up, Castor became a famous horseman, and Polydeuces was the best boxer of his time. Their elder daughter, Clytem- nestra, was wedded to Agamemnon the son of Atreus, king of Mycenae, who was the greatest prince of his age throughout all the land of Hellas. Her sister Helen was the The Tale of Troy CHAP. loveliest woman ever seen upon earth, and every prince in Hellas wooed her for his bride; yet was her beauty fated to bring sorrow and destruction upon all who looked upon her. -

Megara's Harbours
Chapter 4 KLAUS FREITAG – Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen [email protected] With and Without You: Megara’s Harbours The main question that will be addressed in this article is whether and how the harbour towns of the Megarid constituted local places in their own right. Exploring the entangled history of the polis Megara and its ports, this paper also points to the complexities behind scholarly approximations to the local horizon of an ancient Greek city-state. Population Figures and Territory Sizes The estimated population of Megara in the fifth century was c. 40,000. 1 In some calculations this figure includes a high number of slaves, c. 15,000 (cf. Plut. Demetr. 9).2 In the Hellenistic period, the number appears to have been significantly smaller. We note that, while 3,000 Megarian hoplites had fought at Plataia in 479 BCE, in 279 BCE, Megara only sent 400 hoplites to Thermopylai to face the Galatian Invasion. 3 This reduction might have been due, in part, to the secession of Pagai and Aigosthena. The epigraphic evidence from Aigosthena, discussed above, informs the estimation of population figures there, at least in the third century BCE. According to Beloch, the 1 Legon 1981: 23, based on estimations of agricultural capacities. 2 Legon 2005: 463. 3 Paus. 10.20.4; cf. Legon 1981: 301, who doubts that this was the full contingent. Plataia: Hdt. 9.28. Hans Beck and Philip J. Smith (editors). Megarian Moments. The Local World of an Ancient Greek City-State. Teiresias Supplements Online, Volume 1. 2018: 97-127. -

Dramatic Space and a Willingness to Let the Spectators Get Involved in the Play in Various Ways
Space in Early Modern English Drama Allan Folkestad Space in Early Modern English Drama The Literary Dramaturgy of Space in the Comedies of John Lyly Doctoral Dissertation at the University of Agder University of Agder Faculty of Humanities and Pedagogy 2012 Abstract The present dissertation investigates the literary dramaturgy of space in the comedies of John Lyly (1564-1606), i.e. the ways in which various textual elements contribute to the establishment of both local settings and wider worlds within the plays. Previous readings of Lyly’s literary dramaturgy have tended to focus on the relationship between the stylistic device of the antithesis and the structure of the dramatic worlds, whereas I argue that deeper insight into the literary dramaturgical techniques of Lyly can be achieved by deploying the conceptual framework of semiotics of drama. Rather than comparing Lyly’s dramaturgy to that of Shakespeare, the dissertation adopts a historical perspective where Lyly’s dramatic oeuvre is examined on the background of the dramaturgy of a selection of middle and early sixteenth-century plays. In the final chapter, however, the perspective changes where Lyly’s only urban play, Mother Bombie, is compared to Shakepeare’s Comedy of Errors. Using lists of all the spatialising utterances in a play as my main analytic tool and then sorting these utterances according to certain parameters reveals that whwn compared to the somewhat mechanical declamatory quality of the spatialising utterances of earlier plays, Lyly’s literary dramaturgy of space unfolds more organically from the dialogue and is better integrated with aspects of characterisation. Moreover, to a higher degree than earlier playwrights Lyly allows minor characters to contribute significantly to the spatial dramaturgy of a play in their speeches. -

The Histories
Place Names Latitude Longitude Numbers of Times Mentioned Adriatic Sea 42.7752864 15.885196 3 Paphos 34.757212 32.406593 1 Oaxos 35.3080415 24.8441326 2 Petra 35.25 26.25 2 Siphnus 35.208535 26.108246 4 Abae 38.5831615 22.929852 5 Abdera 40.93950935 24.9795992 13 Abydos 26.409131 31.91627145 18 Acarnania 38.71765475 21.19036225 2 Achaia 38.10212147 22.22458591 8 Achelous river 38.3388321 21.1067111 3 Acheron river 39.2348296 20.4831346 2 Achilleum 39.914982 26.1511315 1 Achilles 46.5 31.5 1 Pyrene 42.468926 2.866662 1 Adramytteum 39.5023635 26.936321 1 Aegaen Sea 37.44094966 25.85418454 9 Aegina island 37.7409397 23.430141 51 Egyptian sea 31.15802 32.68554 1 Egypt 19.21140877 30.56732963 263 Aeolia 38.84644288 26.95080175 2 Ethiopia 14.125005 38.721522 22 Aetolia 38.51650426 21.75966982 1 Agathyrsi 47.5 27.5 11 Agora 40.513545 26.786353 1 Aegae 38.154879 22.314637 2 Aegaleos Mountain 37.154 21.721 1 Aege 39.978627 23.666064 1 Aegira 38.1297925 22.377887 1 Aegilea island 38.1771519 24.1749085 2 Aegion 38.252707 22.081952 1 Aenea 40.439481 22.879124 2 Aenus 40.7248985 26.085729 2 Aenyra 40.683333 24.65 1 Aesa 40.309275 23.060368 1 Acanthus 40.39975 23.880112 8 Acragas 37.29289215 13.58945448 4 Acrothoum 38.4526062 23.2197021 1 Akrothooi 40.183833 24.34933 1 Alabanda 37.59557847 27.97571613 2 Alalia 42.10240033 9.511828 2 Alopecae 37.95 23.749997 1 Alpeni 38.801852 22.586084 4 Amathus 34.712264 33.13708095 3 Ampelus headland 37.75 26.75 2 Amphicaea 38.642319 22.598214 1 Amphissa 38.518403 22.374172 2 Anagyrous 37.8300155 23.804843 1 Anaphlystus -

The World of Hesiod a Study of the Greek Middle Ages C
Ttio History of Civilisation fuiiifti % C\ K. Oom,^ M*A. The History of Civilization Edited by C. K. OGDEN, M.A. Introduction and Pre-IIistory ♦Social Organization W. H. R. River*, F.R.S. The Earth before Histohy Edmond Perrier Prehistoric Man Jacques de Morgan Language • a Linguistic Introduction . Professor J Vendryis A Geographical Introduction to History Professor Luuen Fcbvre Race and History . Professor F,. Pittard From Tribe to Empire . Professor A. Moret ♦Life and Work in Prehistoric Times Professor G. Rcnard ♦Money and Monetary Policy in Early Times . Aitlmr R. Burns ♦The Migration of Symbois . Donuld A, Mackenzie ♦The Dawn of European Civilization Professor V. Gordon Childe ♦The Aryans ... ... Professor V. Gordon Childe The Early Empires and Greece The Nilf and Egyptian Civilization . ... Professor A. Mom Israel from its Beginnings to the Eighth Century . Professor A, Lads Jesus ....... • Cli Guigncbcrt Mesopotamia . Professor L Dcluporte The AIoean Civil IZATION . Professor Cr, Gloiz ♦Minoans, Philistines* and Greeks . A. R. Burn •Tub World of IIhmod . ... • A. K. Burn The Formation of the Greek People . Professor A. Jnrdi ♦Ancient Greece at WonK Professor G. Ginns Art in Greece . ... VV. Dconnu and A. de Riddcr Greek Thought and the Scientific Spirit . Protessor L. Robin The Greek City and its Institutions , Professor G Glotsc Macedonian Imperialism Professor P. Jciuguct Home and Beyond the Roman Empire \N.,1 • , ■ Professor LAm Homo jThh Roman Si hut in Rm-ic>ioN, Ihouokti anj> Aht , Professor A. C?rctiior RoMrTiiE0Lrw-GivHRT'IUTIONS ■ • • i/rmeasor Lion Homo Professor J, i>e< lareuii The Economic Life of the ancient World J. -

Achaemenid Grants of Cities and Lands to Greeks: the Case of Mentor and Memnon of Rhodes Maxim M
Achaemenid Grants of Cities and Lands to Greeks: The Case of Mentor and Memnon of Rhodes Maxim M. Kholod HE GRANTS of cities and lands to foreigners, including Greeks, who had provided and/or would in the future T provide important services to the Persian kings and satraps were a fairly common practice in the Achaemenid Empire.1 A portion of evidence for such grants concerns Asia Minor. For example, Cyrus the Great is said to have granted seven cities in Asia Minor to his friend Pytharchus of Cyzicus.2 The Spartan king Demaratus, after he had been allowed to dwell in Persia, received from Darius I and probably then from Xerxes lands and cities, among them Teuthrania and Halisarna, where his descendants, the Demaratides, still were in power at the beginning of the fourth century.3 Gongylus of Eretria, who had been expelled from his home city as an adherent of the Persians, received from Xerxes the cities Gambrium, Palaegambrium, 1 On these grants see in detail M. A. Dandamayev and V. G. Lukonin, Kultura i ekonomika drevnego Irana (Moscow 1980) 138–142 (Engl. transl.: Cambridge 1989); P. Briant, “Dons de terres et de villes: L’Asie Mineure dans le contexte achéménide,” REA 87 (1985) 51–72, and From Cyrus to Alexander (Winona Lake 2002) 561–563, 969; Ch. Tuplin, “The Administration of the Achaemenid Empire,” in I. Carradice (ed.), Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires (Oxford 1987) 133–137; G. Herman, Ritualised Friendship and the Greek City (Cambridge 1987) 106–115; P. Debord, L’Asie Mineure au IVe siècle (Bordeaux 1999) 189–193; H.