9783653068559.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Understanding the History of the Holocaust II
UNDERSTANDING THE HISTORY OF THE HOLOCAUST II Jewish Resistance, Miracles & Righteous Gentiles n the first Morasha shiur on the Holocaust, we developed a rudimentary Iunderstanding of the horrors of the Holocaust and its irrevocable impact on the Jewish people. We will now turn our attention to some of the glimmers of hope that appeared during those dark days. It is important to dispel the myth that Jews went to their deaths passively, “like lambs to the slaughter.” For reasons that will be mentioned below, Jewish resistance was often spiritual rather than physical; the manner in which they retained their human spirit, and even their Jewish spirit, demonstrates strength of character that we can barely imagine. Most of the stories of Jewish courage were lost with their heroes. Some have been passed on to us. It is our duty to remember these stories, and internalize their messages. Furthermore, while the Holocaust was a time of unimaginable suffering and darkness for the Jewish people, many of those who survived (and even those who ultimately did not) experienced moments of salvation that were nothing short of miraculous. Stretched beyond the limits of physical endurance and facing the merciless, overwhelming brutality of the Nazis, many Jews found that their lives were saved in the most improbable ways. The history of the Holocaust is replete with such miracles, evidence that God was still with us even during that time of suffering. Finally, it is important to mention some of the non-Jewish heroes who risked their own lives to save Jews from certain death. Even at a time in history when the entire world seemed to have turned against the Jewish people, there were still isolated individuals who demonstrated both mercy and courage by extending themselves to save Jews. -
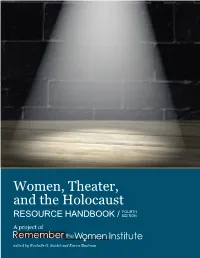
Women, Theater, and the Holocaust FOURTH RESOURCE HANDBOOK / EDITION a Project Of
Women, Theater, and the Holocaust FOURTH RESOURCE HANDBOOK / EDITION A project of edited by Rochelle G. Saidel and Karen Shulman Remember the Women Institute, a 501(c)(3) not-for-profit corporation founded in 1997 and based in New York City, conducts and encourages research and cultural activities that contribute to including women in history. Dr. Rochelle G. Saidel is the founder and executive director. Special emphasis is on women in the context of the Holocaust and its aftermath. Through research and related activities, including this project, the stories of women—from the point of view of women—are made available to be integrated into history and collective memory. This handbook is intended to provide readers with resources for using theatre to memorialize the experiences of women during the Holocaust. Women, Theater, and the Holocaust FOURTH RESOURCE HANDBOOK / EDITION A Project of Remember the Women Institute By Rochelle G. Saidel and Karen Shulman This resource handbook is dedicated to the women whose Holocaust-related stories are known and unknown, told and untold—to those who perished and those who survived. This edition is dedicated to the memory of Nava Semel. ©2019 Remember the Women Institute First digital edition: April 2015 Second digital edition: May 2016 Third digital edition: April 2017 Fourth digital edition: May 2019 Remember the Women Institute 11 Riverside Drive Suite 3RE New York,NY 10023 rememberwomen.org Cover design: Bonnie Greenfield Table of Contents Introduction to the Fourth Edition ............................................................................... 4 By Dr. Rochelle G. Saidel, Founder and Director, Remember the Women Institute 1. Annotated Bibliographies ....................................................................................... 15 1.1. -

Epoch of the Messiah by Rabbi Elchonon Wasserman
Epoch of the Messiah As Distributed By S. GOLDMAN - OTZAR HASEFARIM Inc. 33 Canal Street, New York, N.Y.1OOO2 Importers and Publishers of Hebrew Books Copyright 1985 by Rabbi E.S. Wasserman 851 North Kings Rd. Los Angeles, Calif. 90069 Rabbi Elchonon Bunim Wasserman, zt'l A Brief Biographical Sketch Reb Elchonon, zt'l, was born in 1874 in Birz, Lithuania. Circa 1889 his parents moved to Boisk, Latvia, at that time the Rabbinical Seat of Rabbi Cook, olov hasholom. From there he went to Telz where he studied under the illustrious gaonim, Rabbi Eliezer Gordon, zt'l and Rabbi Shimon Shkop, zt'l. In Telz, he was noted for his unusual diligence and profound mind. After many years of intensive study in Telz, he went to Volozin to become a disciple of the great Reb Chaim Brisker who was Rosh yeshivah of Volozin at that time. In 1898, he married the daughter of one of the leading sages of the day, Rabbi Meir Atlas, zt'l, who was then the Rabbi of Salant. Then came a period which impressed itself indelibly on the rest of his life. It began in 1906 when he went to Radin, the home of his master, the world-renowned Chofetz Chaim, zt'l where he studied until 1908 in the Kollel Kodshim. The Chofetz Chaim had founded this select institution for the future leaders of Israel. During the year 1908-1909, Rav Elchonon, together with the gaon Rabbi Yoel Baranchick zt'l started a yeshivah in Amsislav, Russia. In 1910, he accepted a call to become a rosh yeshivah in Brisk, the home of his teacher, Rabbi Chaim, zt'l. -

Jerusalemhem Volume 91, February 2020
Yad VaJerusalemhem Volume 91, February 2020 “Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism” The Fifth World Holocaust Forum at Yad Vashem (pp. 2-7) Yad VaJerusalemhem Volume 91, Adar 5781, February 2020 “Remembering the Holocaust, Published by: Fighting Antisemitism” ■ Contents Chairman of the Council: Rabbi Israel Meir Lau International Holocaust Remembrance Day ■ 2-12 Chancellor of the Council: Dr. Moshe Kantor “Remembering the Holocaust, Vice Chairman of the Council: Dr. Yitzhak Arad Fighting Antisemitism” ■ 2-7 Chairman of the Directorate: Avner Shalev The Fifth World Holocaust Forum at Yad Vashem Director General: Dorit Novak Tackling Antisemitism Through Holocaust Head of the International Institute for Holocaust ■ 8-9 Research and Incumbent, John Najmann Chair Education for Holocaust Studies: Prof. Dan Michman Survivors: Chief Historian: Prof. Dina Porat Faces of Life After the Holocaust ■ 10-11 Academic Advisor: Joining with Facebook to Remember Prof. Yehuda Bauer Holocaust Victims ■ 12 Members of the Yad Vashem Directorate: ■ 13 Shmuel Aboav, Yossi Ahimeir, Daniel Atar, Treasures from the Collections Dr. David Breakstone, Abraham Duvdevani, Love Letter from Auschwitz ■ 14-15 Erez Eshel, Prof. Boleslaw (Bolek) Goldman, Moshe Ha-Elion, Adv. Shlomit Kasirer, Education ■ 16-17 Yehiel Leket, Adv. Tamar Peled Amir, Graduate Spotlight ■ 16-17 Avner Shalev, Baruch Shub, Dalit Stauber, Dr. Zehava Tanne, Dr. Laurence Weinbaum, Tamara Vershitskaya, Belarus Adv. Shoshana Weinshall, Dudi Zilbershlag New Online Course: Chosen Issues in Holocaust History ■ 17 THE MAGAZINE Online Exhibition: Editor-in-Chief: Iris Rosenberg Children in the Holocaust ■ 18-19 Managing Editor: Leah Goldstein Editorial Board: Research ■ 20-23 Simmy Allen The Holocaust in the Soviet Union Tal Ben-Ezra ■ 20-21 Deborah Berman in Real Time Marisa Fine International Book Prize Winners 2019 ■ 21 Dana Porath Lilach Tamir-Itach Yad Vashem Studies: The Cutting Edge of Dana Weiler-Polak Holocaust Research ■ 22-23 ■ Susan Weisberg At the invitation of the President of the Fellows Corner: Dr. -

The Lithuanian Jewish Community of Telšiai
The Lithuanian Jewish Community of Telšiai By Philip S. Shapiro1 Introduction This work had its genesis in an initiative of the “Alka” Samogitian Museum, which has undertaken projects to recover for Lithuanians the true history of the Jews who lived side-by-side with their ancestors. Several years ago, the Museum received a copy of the 500-plus-page “yizkor” (memorial) book for the Jewish community of Telšiai,2 which was printed in 1984.3 The yizkor book is a collection of facts and personal memories of those who had lived in Telšiai before or at the beginning of the Second World War. Most of the articles are written in Hebrew or Yiddish, but the Museum was determined to unlock the information that the book contained. Without any external prompting, the Museum embarked upon an ambitious project to create a Lithuanian version of The Telshe Book. As part of that project, the Museum organized this conference to discuss The Telshe Book and the Jewish community of Telšiai. This project is of great importance to Lithuania. Since Jews constituted about half of the population of most towns in provincial Lithuania in the 19th Century, a Lithuanian translation of the book will not only give Lithuanian readers a view of Jewish life in Telšiai but also a better knowledge of the town’s history, which is our common heritage. The first part of this article discusses my grandfather, Dov Ber Shapiro, who was born in 1883 in Kamajai, in the Rokiškis region, and attended the Telshe Yeshiva before emigrating in 1903 to the United States, where he was known as “Benjamin” Shapiro. -
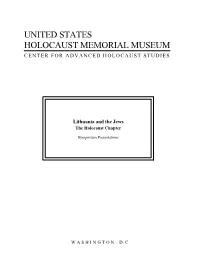
Lithuania and the Jews the Holocaust Chapter
UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES Lithuania and the Jews The Holocaust Chapter Symposium Presentations W A S H I N G T O N , D. C. Lithuania and the Jews The Holocaust Chapter Symposium Presentations CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM 2004 The assertions, opinions, and conclusions in this occasional paper are those of the authors. They do not necessarily reflect those of the United States Holocaust Memorial Council or of the United States Holocaust Memorial Museum. First printing, July 2005 Copyright © 2005 United States Holocaust Memorial Museum Contents Foreword.......................................................................................................................................... i Paul A. Shapiro and Carl J. Rheins Lithuanian Collaboration in the “Final Solution”: Motivations and Case Studies........................1 Michael MacQueen Key Aspects of German Anti-Jewish Policy...................................................................................17 Jürgen Matthäus Jewish Cultural Life in the Vilna Ghetto .......................................................................................33 David G. Roskies Appendix: Biographies of Contributors.........................................................................................45 Foreword Centuries of intellectual, religious, and cultural achievements distinguished Lithuania as a uniquely important center of traditional Jewish arts and learning. The Jewish community -
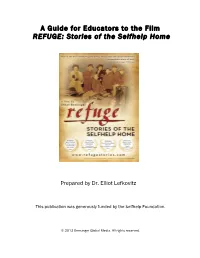
Study Guide REFUGE
A Guide for Educators to the Film REFUGE: Stories of the Selfhelp Home Prepared by Dr. Elliot Lefkovitz This publication was generously funded by the Selfhelp Foundation. © 2013 Bensinger Global Media. All rights reserved. 1 Table of Contents Acknowledgements p. i Introduction to the study guide pp. ii-v Horst Abraham’s story Introduction-Kristallnacht pp. 1-8 Sought Learning Objectives and Key Questions pp. 8-9 Learning Activities pp. 9-10 Enrichment Activities Focusing on Kristallnacht pp. 11-18 Enrichment Activities Focusing on the Response of the Outside World pp. 18-24 and the Shanghai Ghetto Horst Abraham’s Timeline pp. 24-32 Maps-German and Austrian Refugees in Shanghai p. 32 Marietta Ryba’s Story Introduction-The Kindertransport pp. 33-39 Sought Learning Objectives and Key Questions p. 39 Learning Activities pp. 39-40 Enrichment Activities Focusing on Sir Nicholas Winton, Other Holocaust pp. 41-46 Rescuers and Rescue Efforts During the Holocaust Marietta Ryba’s Timeline pp. 46-49 Maps-Kindertransport travel routes p. 49 2 Hannah Messinger’s Story Introduction-Theresienstadt pp. 50-58 Sought Learning Objectives and Key Questions pp. 58-59 Learning Activities pp. 59-62 Enrichment Activities Focusing on The Holocaust in Czechoslovakia pp. 62-64 Hannah Messinger’s Timeline pp. 65-68 Maps-The Holocaust in Bohemia and Moravia p. 68 Edith Stern’s Story Introduction-Auschwitz pp. 69-77 Sought Learning Objectives and Key Questions p. 77 Learning Activities pp. 78-80 Enrichment Activities Focusing on Theresienstadt pp. 80-83 Enrichment Activities Focusing on Auschwitz pp. 83-86 Edith Stern’s Timeline pp. -

The Reconstruction of Nations
The Reconstruction of Nations The Reconstruction of Nations Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999 Timothy Snyder Yale University Press New Haven & London Published with the assistance of the Frederick W. Hilles Fund of Yale University. Copyright © by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections and of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Printed in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Snyder, Timothy. The reconstruction of nations : Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, ‒ / Timothy Snyder. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN --- (alk. paper) . Europe, Eastern—History—th century. I. Title. DJK. .S .—dc A catalogue record for this book is available from the British Library. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. For Marianna Brown Snyder and Guy Estel Snyder and in memory of Lucile Fisher Hadley and Herbert Miller Hadley Contents Names and Sources, ix Gazetteer, xi Maps, xiii Introduction, Part I The Contested Lithuanian-Belarusian Fatherland 1 The Grand Duchy of Lithuania (–), 2 Lithuania! My Fatherland! (–), 3 The First World War and the Wilno Question (–), 4 The Second World War and the Vilnius Question (–), 5 Epilogue: -

Fine Judaica
t K ESTENBAUM FINE JUDAICA . & C PRINTED BOOKS, MANUSCRIPTS, GRAPHIC & CEREMONIAL ART OMPANY F INE J UDAICA : P RINTED B OOKS , M ANUSCRIPTS , G RAPHIC & C & EREMONIAL A RT • T HURSDAY , N OVEMBER 12 TH , 2020 K ESTENBAUM & C OMPANY THURSDAY, NOV EMBER 12TH 2020 K ESTENBAUM & C OMPANY . Auctioneers of Rare Books, Manuscripts and Fine Art Lot 115 Catalogue of FINE JUDAICA . Printed Books, Manuscripts, Graphic & Ceremonial Art Featuring Distinguished Chassidic & Rabbinic Autograph Letters ❧ Significant Americana from the Collection of a Gentleman, including Colonial-era Manuscripts ❧ To be Offered for Sale by Auction, Thursday, 12th November, 2020 at 1:00 pm precisely This auction will be conducted only via online bidding through Bidspirit or Live Auctioneers, and by pre-arranged telephone or absentee bids. See our website to register (mandatory). Exhibition is by Appointment ONLY. This Sale may be referred to as: “Shinov” Sale Number Ninety-One . KESTENBAUM & COMPANY The Brooklyn Navy Yard Building 77, Suite 1108 141 Flushing Avenue Brooklyn, NY 11205 Tel: 212 366-1197 • Fax: 212 366-1368 www.Kestenbaum.net K ESTENBAUM & C OMPANY . Chairman: Daniel E. Kestenbaum Operations Manager: Zushye L.J. Kestenbaum Client Relations: Sandra E. Rapoport, Esq. Judaica & Hebraica: Rabbi Eliezer Katzman Shimon Steinmetz (consultant) Fine Musical Instruments (Specialist): David Bonsey Israel Office: Massye H. Kestenbaum ❧ Order of Sale Manuscripts: Lot 1-17 Autograph Letters: Lot 18 - 112 American-Judaica: Lot 113 - 143 Printed Books: Lot 144 - 194 Graphic Art: Lot 195-210 Ceremonial Objects: Lot 211 - End of Sale Front Cover Illustration: See Lot 96 Back Cover Illustration: See Lot 4 List of prices realized will be posted on our website following the sale www.kestenbaum.net — M ANUSCRIPTS — 1 (BIBLE). -

Holocaust Responsa in the Kovno Ghetto 1941-44 by Ephraim Kaye
1 WEDNESDAY OCTOBER 13, 1999 AFTERNOON SESSION A 14:00-15:30 Holocaust Responsa in the Kovno Ghetto 1941-44 by Ephraim Kaye Goals of the Unit 1. To describe the lives of the Jews in the Kovno Ghetto as reflected in Rabbi Ephraim Oshry's responsa. 2. To illuminate several fateful issues that Orthodox Jews confronted in their struggle for Jewish survival in the ghetto, at a time when escape still seemed possible and hope for deliverance still flickered. 3. To engage students in discussion of these issues so they may arrive at their own answers. The main problem treated in this unit: How did Orthodox Jews contend with existential questions in the ghetto with the assistance and encouragement of Rabbi Ephraim Oshry, as reflected in his halakhic rulings? Phases of the Unit 1. Introduction: the teacher describes the nature of responsa literature and shows how it may be used as a historical source – generally, and in the specific context of Holocaust studies. 2. The students are divided into three groups, each assigned one of the halakhic problems taken up by Rabbi Oshry. A uniform eleven-item "worksheet" is given to all the groups. The items provide a foundation for analysis of the historical dimension of the issue. Each student is also given a "source sheet" that helps him or her deal with the issue at hand (a sheet with sources upon which R. Oshry based his halakhic decisions.) 3. Each group fills in each section of the worksheet and attempts to formulate a response to the question that it was given. -

Split Identity: Jewish Scholarship in the Vilna Ghetto by David Fishman
Split Identity: Jewish Scholarship in the Vilna Ghetto By David Fishman Festschrift in honor of David Roskies In geveb: A Journal of Yiddish Studies (June 2020) For the online version of this article: https://ingeveb.org/articles/split-identity In geveb: A Journal of Yiddish Studies (June 2020) SPLIT IDENTITY: JEWISH SCHOLARSHIP IN THE VILNA GHETTO by David Fishman Abstract: In this essay, David Fishman draws a comparison between yidishe visnshaft, or Jewish studies scholarship, and Judenforschung, the Nazi field of antisemitic Jewish studies used to justify the persecution and extermination of Jews in scientific terms. He examines the work of Zelig Kalmanovitch, who had been a well-known scholar and co-director of YIVO before World War II, during the time when he was forced to produce scholarship as a member of the Jewish slave labor brigade assigned to the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) in Vilna. Fishman notes the remarkable scholarly accomplishments Kalmanovitch was able to achieve in a time of enormous adversity. He also demonstrates several junctures in which Kalmanovitch, a meticulous scholar, omitted facts or altered scholarship in order to save lives. These dual impulses of preserving historical truths about Jewish communities and a willingness to obscure facts over which people could be killed contribute to Fishman's assessment that Kalmanovitch's scholarship emerged from erudition, love, and dedication to the Jewish people about whom he wrote, the very opposite of the purposes for which his scholarship was obtained by his Nazi slave masters. Between Yidishe Visnshaft and Judenforschung (Jewish Studies and the Study of Jews) On June 16, 1942, Herbert Gotthardt, a staff member of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) in Vilna, instructed Zelig Kalmanovitch to prepare an essay and bibliography on the Karaites. -

Teacher Meaning-Making at a Jewish Heritage Museum David Russell
Museum-Based Teacher Education: Teacher Meaning-Making at a Jewish Heritage Museum David Russell Goldberg Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy under the Executive Committee of the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2012 © 2012 David Russell Goldberg All Rights Reserved ABSTRACT MUSEUM-BASED TEACHER EDUCATION: TEACHER MEANING-MAKING AT A JEWISH HERITAGE MUSEUM David Russell Goldberg This study answers the question of what meanings teacher-participants make in Holocaust professional development at a Jewish heritage museum in a mandate state. By understanding these meanings, the educational community can better understand how a particular context and approach influences teacher meaning-making and the ways in which museum teacher education programs shape the learning of participants. Meaning- making is a process of interpretation and understanding experiences in ways that make sense to each individual teacher. Meanings that are formed may impact teachers’ pedagogic interpretation of the Holocaust, which may in turn shape their instructional practices. This instrumental case study used multiple interviews, observations, surveys and documents to explore the meanings teachers make about the Holocaust from participation in Holocaust professional development at a Jewish heritage museum. Participants in the study included nine teachers from public schools and private Jewish schools and two professional developers from the Museum. Each participant was interviewed three times, and six different professional development programs were observed over a period of six months. Programs typically lasted from one to six days and included a presentation by museum staff, Holocaust experts, and survivors. At any museum, each representation of the Holocaust conveys particular messages and mediates Holocaust history through a particular lens.