Übach – Palenberg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Case Study North Rhine-Westphalia
Contract No. 2008.CE.16.0.AT.020 concerning the ex post evaluation of cohesion policy programmes 2000‐2006 co‐financed by the European Regional Development Fund (Objectives 1 and 2) Work Package 4 “Structural Change and Globalisation” CASE STUDY NORTH RHINE‐WESTPHALIA (DE) Prepared by Christian Hartmann (Joanneum Research) for: European Commission Directorate General Regional Policy Policy Development Evaluation Unit CSIL, Centre for Industrial Studies, Milan, Italy Joanneum Research, Graz, Austria Technopolis Group, Brussels, Belgium In association with Nordregio, the Nordic Centre for Spatial Development, Stockholm, Sweden KITE, Centre for Knowledge, Innovation, Technology and Enterprise, Newcastle, UK Case Study – North Rhine‐Westphalia (DE) Acronyms BERD Business Expenditure on R&D DPMA German Patent and Trade Mark Office ERDF European Regional Development Fund ESF European Social Fund EU European Union GERD Gross Domestic Expenditure on R&D GDP Gross Domestic Product GRP Gross Regional Product GVA Gross Value Added ICT Information and Communication Technology IWR Institute of the Renewable Energy Industry LDS State Office for Statistics and Data Processing NGO Non‐governmental Organisation NPO Non‐profit Organisation NRW North Rhine‐Westphalia NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics PPS Purchasing Power Standard REN Rational Energy Use and Exploitation of Renewable Resources R&D Research and Development RTDI Research, Technological Development and Innovation SME Small and Medium Enterprise SPD Single Programming Document -

The Districts of North Rhine-Westphalia
THE DISTRICTS OF NORTH RHINE-WESTPHALIA S D E E N R ’ E S G N IO E N IZ AL IT - G C CO TIN MPETENT - MEE Fair_AZ_210x297_4c_engl_RZ 13.07.2007 17:26 Uhr Seite 1 Sparkassen-Finanzgruppe 50 Million Customers in Germany Can’t Be Wrong. Modern financial services for everyone – everywhere. Reliable, long-term business relations with three quarters of all German businesses, not just fast profits. 200 years together with the people and the economy. Sparkasse Fair. Caring. Close at Hand. Sparkassen. Good for People. Good for Europe. S 3 CONTENTS THE DIstRIct – THE UNKnoWN QUAntITY 4 WHAT DO THE DIstRIcts DO WITH THE MoneY? 6 YoUTH WELFARE, socIAL WELFARE, HEALTH 7 SecURITY AND ORDER 10 BUILDING AND TRAnsPORT 12 ConsUMER PRotectION 14 BUSIness AND EDUCATIon 16 NATURE conseRVAncY AND enVIRonMentAL PRotectIon 18 FULL OF LIFE AND CULTURE 20 THE DRIVING FORce OF THE REGIon 22 THE AssocIATIon OF DIstRIcts 24 DISTRIct POLICY AND CIVIC PARTICIPATIon 26 THE DIRect LIne to YOUR DIstRIct AUTHORITY 28 Imprint: Editor: Dr. Martin Klein Editorial Management: Boris Zaffarana Editorial Staff: Renate Fremerey, Ulrich Hollwitz, Harald Vieten, Kirsten Weßling Translation: Michael Trendall, Intermundos Übersetzungsdienst, Bochum Layout: Martin Gülpen, Minkenberg Medien, Heinsberg Print: Knipping Druckerei und Verlag, Düsseldorf Photographs: Kreis Aachen, Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis Gütersloh, Kreis Heinsberg, Hochsauerlandkreis, Kreis Höxter, Kreis Kleve, Kreis Lippe, Kreis Minden-Lübbecke, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Olpe, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Steinfurt, Kreis Warendorf, Kreis Wesel, project photos. © 2007, Landkreistag Nordrhein-Westfalen (The Association of Districts of North Rhine-Westphalia), Düsseldorf 4 THE DIstRIct – THE UNKnoWN QUAntITY District identification has very little meaning for many people in North Rhine-Westphalia. -

Europa Regina. 16Th Century Maps of Europe in the Form of a Queen Europa Regina
Belgeo Revue belge de géographie 3-4 | 2008 Formatting Europe – Mapping a Continent Europa Regina. 16th century maps of Europe in the form of a queen Europa Regina. Cartes d’Europe du XVIe siècle en forme de reine Peter Meurer Electronic version URL: http://journals.openedition.org/belgeo/7711 DOI: 10.4000/belgeo.7711 ISSN: 2294-9135 Publisher: National Committee of Geography of Belgium, Société Royale Belge de Géographie Printed version Date of publication: 31 December 2008 Number of pages: 355-370 ISSN: 1377-2368 Electronic reference Peter Meurer, “Europa Regina. 16th century maps of Europe in the form of a queen”, Belgeo [Online], 3-4 | 2008, Online since 22 May 2013, connection on 05 February 2021. URL: http:// journals.openedition.org/belgeo/7711 ; DOI: https://doi.org/10.4000/belgeo.7711 This text was automatically generated on 5 February 2021. Belgeo est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International. Europa Regina. 16th century maps of Europe in the form of a queen 1 Europa Regina. 16th century maps of Europe in the form of a queen Europa Regina. Cartes d’Europe du XVIe siècle en forme de reine Peter Meurer 1 The most common version of the antique myth around the female figure Europa is that which is told in book II of the Metamorphoses (“Transformations”, written around 8 BC) by the Roman poet Ovid : Europa was a Phoenician princess who was abducted by the enamoured Zeus in the form of a white bull and carried away to Crete, where she became the first queen of that island and the mother of the legendary king Minos. -

16-11-10 Team39 Tagestruktur-HS.Indd
Krefeld Standorte Tagesstruktur ViaNobis - Wir sind in ihrer Nähe. Kreis Heinsberg Die Eingliederungshilfe Viersen Niederheid Von-Siemens-Straße 6 Mönchengladbach 52511 Geilenkirchen Tel.: +49 2451 9434-714 Rheydt Fax: +49 2451 9434-713 [email protected] Tagesstruktur Odenkirchen Übach-Palenberg Beratung, Begleitung und Unterstützung Erkelenz Aachener Straße 88 Kreis Heinsberg Heinsberg 52531 Übach-Palenberg Hückelhoven Tel.: +49 2451 4906396 [email protected] Gangelt Kolpinghaus Gangelt Niederheid Wallstraße 23 52538 Gangelt Tel.: +49 2454 9389-815 Übach-Palenberg Fax: +49 2454 9389-820 [email protected] Sie fi nden uns hier: Heinsberg Erkelenz Valkenburger Straße 15 Gangelt 52525 Heinsberg Heinsberg Tel.: +49 2452 9778740 Hückelhoven Fax: +49 2452 8609605 Krefeld [email protected] Mönchengladbach Mönchengladbach-Odenkirchen Hückelhoven Niederheid Rheydt Martin-Luther-Straße 5a Übach-Palenberg 41836 Hückelhoven Viersen Tel.: +49 2433 9047817 Fax: +49 2433 9047819 TagesstrukturHü[email protected] Kontakt Erkelenz ViaNobis - Die Eingliederungshilfe Aachener Straße 30 41812 Erkelenz Bruchstraße 6 | 52538 Gangelt Tel.: +49 2431 9451516 Telefon: +49 2454 59-413 | Telefax: +49 2454 59-415 Fax: +49 2431 9452882 www.vianobis.de [email protected] Was heißt Tagesstruktur? Zielsetzung der Tagesstruktur Unsere Angebote in der Tagesstruktur Jeder Mensch braucht eine Tagesstruktur. Die Gestaltung des In einem geschützten und abstinenten Raum erfahren unsere Kreativität Papier- und Malarbeiten Tages in wiederkehrende, verlässliche Tages- und Wochen- Teilnehmer eine individuelle Förderung, Akzeptanz und Wert- ■ Holzarbeiten abläufe bietet Sicherheit und die Basis für die Förderung und schätzung. ■ Tonarbeiten den Erhalt von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Für Menschen mit ■ Seidenmalerei Behinderungen ist sie als zweiter Lebensraum, ergänzend zum Hier können sie soziale Kontakte aufbauen, einer sinnhaften ■ Wohnbereich, von großer Bedeutung. -

Übersicht Anlaufstellen Familien
Bildungs- und Kindergeld und Berufsausbildungs- Teilhabepaket Wohngeld Unterhaltsvorschuss Elterngeld BAföG Kinderzuschlag beihilfe sowie Erstausstattung Stadtverwaltung Kreisverwaltung Kreisverwaltung Heinsberg Familienkasse Nordrhein- Jobcenter Kreis Heinsberg Stadtverwaltung Erkelenz Agentur für Arbeit Düren Erkelenz Heinsberg (oder Studierendenwerk) Westfalen West Hermann-Josef-Gormanns- Erkelenz Johannismarkt 17 Tenholter Str. 42 Johannismarkt 17 Valkenburger Str. 45 Valkenburger Str. 45 Roermonder Str. 51 Straße 14-16 41812 Erkelenz 41812 Erkelenz 41812 Erkelenz 52525 Heinsberg 52525 Heinsberg 52072 Aachen 41812 Erkelenz Kreisverwaltung Kreisverwaltung Heinsberg Familienkasse Nordrhein- Gemeinde Gangelt Kreis Heinsberg Agentur für Arbeit Düren Jobcenter Kreis Heinsberg Heinsberg (oder Studierendenwerk) Westfalen West Gangelt Burgstr. 10 Valkenburger Str. 45 Schafhausener Str. 40 Schafhausener Str. 50 Valkenburger Str. 45 Valkenburger Str. 45 Roermonder Str. 51 52538 Gangelt 52525 Heinsberg 52525 Heinsberg 52525 Heinsberg 52525 Heinsberg 52525 Heinsberg 52072 Aachen Stadtverwaltung Stadtverwaltung Kreisverwaltung Kreisverwaltung Heinsberg Familienkasse Nordrhein- Agentur für Arbeit Düren Jobcenter Kreis Heinsberg Geilenkirchen Geilenkirchen Heinsberg (oder Studierendenwerk) Westfalen West Geilenkirchen Herzog-Wilhelm-Str. 16-18 Herzog-Wilhelm-Str. 16-18 Markt 9 Markt 9 Valkenburger Str. 45 Valkenburger Str. 45 Roermonder Str. 51 52511 Geilenkirchen 52511 Geilenkirchen 52511 Geilenkirchen 52511 Geilenkirchen 52525 Heinsberg 52525 -

Thriving in Geilenkirchen and Niederheid
Thriving In Geilenkirchen and Niederheid 1 Table of Contents Welcome .................................................................................................................................... 5 Contact Us ............................................................................................................................. 5 Staff Directory ........................................................................................................................ 6 Using the Phone ........................................................................................................................ 7 Emergency Numbers ............................................................................................................. 7 Frequently Called Numbers .................................................................................................... 8 Base Details ............................................................................................................................... 9 CFSU(E) Niederheid .............................................................................................................. 9 NATO Air Base Geilenkirchen ...............................................................................................11 JFC Brunssum ......................................................................................................................13 Languages ................................................................................................................................15 Holidays -

Coronavirus: Virologist Believes That Infection Through Surface Contact Is Unlikely
Coronavirus: Virologist believes that infection through surface contact is unlikely Author: Volker Blasek, editor, certified professional Source: University Hospital Bonn, North Rhine-Westphalia, Coronavirus Research Project COVID-19 in collaboration with the Institute of Virology at the University Hospital Bonn (published March 27, 2020), ukbnewsroom.de April 7, 2020 The text is drawn up in accordance with scientific standards and checked by medical professionals* *This text complies with published medical articles, guidelines, and research results and has been checked by medical professionals. What is the risk of infection with SARS-CoV-2 (COVID-19) by way of contact with surfaces? Controversial opinions concerning the risk of infection with the new SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) by way of contact with infected surfaces currently exist. Some laboratory studies have shown that the virus can survive on certain surfaces. But does the same thing happen in real-world conditions? Based on his research, virologist Professor Hendrik Streeck believes that the risk of infection by way of surface contact is extremely low . Professor Hendrick Streeck, together with Professor Dr. Christian Drosten, is currently perhaps the most famous virologist in Germany. A young lead researcher has taken over Drosten as director of the Institute of Virology at the University Hospital in Bonn. He and his team use a slightly different approach to work. While many virologists mainly work in laboratories, the Streek team collects data in the vicinity of Heinsberg, which is a high-risk area. And they have already received important unexpected results. Has the risk of infection through surface contact been overestimated? It has now been scientifically proven that SARS-CoV-2 (COVID-19) can be spread by airborne droplets. -

Landschaftsplan II/5 Selfkant
Landschaftsplan II/5 Selfkant Satzung des Kreises Heinsberg vom 11./13.03.1989 i. d. F. der 3. Änderung vom 17.11.1993 Ausarbeitung: Kreis Heinsberg, Untere Landschaftsbehörde, Valkenburger Straße 45, 52525 Heinsberg Landschaftsverband Rheinland, Referat Landschaftsplanung, Köln, Anette Heusch-Altenstein Wissenschaftliche Grundlagen für die Landschaftsplanung: Teil I: Elisabeth Neuland im Auftrag des Kreises Heinsberg und in Abstimmung mit der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung, Recklinghausen Stand: Mai 1979 Teil II: Dr. Jörg Steinborn, Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung, Recklinghausen unter Mitarbeit von M. Volpers und T. Hübner Stand: Februar 1981 - Seite I - Inhalt Satzung Allgemeine Hinweise PRÄAMBEL Rechtsgrundlage Räumlicher Geltungsbereich Anpassungsklausel Planbestandteile Kartographische Grundlage Verfahrensablauf Verfahren zur 1. Änderung Verfahren zur 3. Änderung TEXTLICHE DARSTELLUNGEN UND FESTSETZUNGEN, ERLÄUTERUNGSBERICHT 1. Entwicklungsziele für die Landschaft (§ 18 LG) 1.1 Entwicklungsziel 1: Erhaltung einer mit naturnahen Landschaftsräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft 1.2 Entwicklungsziel 2: Anreicherung einer im Ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen 1.3 Entwicklungsziel 3: Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflächenstruktur geschädigten oder stark vernachlässigten -

Psychosoziales Adressbuch
Psychosoziales Adressbuch Herausgeber: Kommunale Gesundheitskonferenz im Kreis Heinsberg 8. Auflage, Stand: Juli 2018 Impressum: Herausgeber: Kommunale Gesundheitskonferenz im Kreis Heinsberg Verantwortlich für den Inhalt: Kreis Heinsberg Der Landrat Gesundheitsamt Valkenburger Str. 45 52525 Heinsberg Telefon: (02452) 13 53-01 (02452) 13 53-13 Telefax: (02452) 13 53-95 E-Mail: [email protected] Stand: Juli 2018 I NHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Krankenhäuser und ihre Sozialdienste .................................................................................... 3 1.1 Allgemeine Krankenhäuser .......................................................................................................... 3 1.2 Dialyse .......................................................................................................................................... 5 1.3 Fachkrankenhäuser für Neurologie / Psychiatrie (Erwachsene) .................................................. 7 1.4 Gerontopsychiatrische Abteilungen ............................................................................................. 9 1.5 Geriatrie...................................................................................................................................... 11 1.6 Medizinische Einrichtungen für Kinder ....................................................................................... 12 2 Ärzte/Ärztinnen / Psychotherapeuten/innen ....................................................................... 15 2.1 Ärzte/Ärztinnen -

The Spread of COVID-19 and the BCG Vaccine: a Natural Experiment in Reunified Germany
Federal Reserve Bank of New York Staff Reports The Spread of COVID-19 and the BCG Vaccine: A Natural Experiment in Reunified Germany Richard Bluhm Maxim Pinkovskiy Staff Report No. 926 May 2020 This paper presents preliminary findings and is being distributed to economists and other interested readers solely to stimulate discussion and elicit comments. The views expressed in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect the position of the Federal Reserve Bank of New York or the Federal Reserve System. Any errors or omissions are the responsibility of the authors. The Spread of COVID-19 and the BCG Vaccine: A Natural Experiment in Reunified Germany Richard Bluhm and Maxim Pinkovskiy Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 926 May 2020 JEL classification: C21, I18, J60 Abstract As COVID-19 has spread across the globe, several observers noticed that countries still administering an old vaccine against tuberculosis—the BCG vaccine—have had fewer COVID-19 cases and deaths per capita in the early stages of the outbreak. This paper uses a geographic regression discontinuity analysis to study whether and how COVID-19 prevalence changes discontinuously at the old border between West Germany and East Germany. The border used to separate two countries with very different vaccination policies during the Cold War era. We provide formal evidence that there is indeed a sizable discontinuity in COVID-19 cases at the border. However, we also find that the difference in novel coronavirus prevalence is uniform across age groups and show that this discontinuity disappears when commuter flows and demographics are accounted for. -
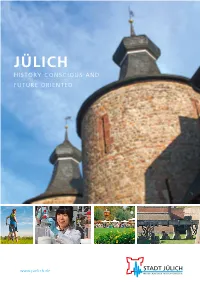
History Conscious and Future Oriented
JÜLICH HISTORY CONSCIOUS AND FUTURE ORIENTED www.juelich.de JÜLICH HISTORY CONSCIOUS AND FUTURE ORIENTED 2 CONTENTS We invite you to get to know Jülich – the historic fortress town and modern research town. It is worth going on a tour of discovery between the past, steeped in history, and innovative research. On the following pages, you will find out more about the founding of the town, get an impression of the imposing fortress buildings and get to know the research town Jülich, amongst other things. You can find the town map on the last page of this brochure. Current news at www.juelich.de Welcome speech 5 Jülich then: Pasqualini’s ideal town of the Renaissance and Napoleon’s bridge head 6 Jülich today: Residing and living in a diverse environment 10 Jülich – Home of top research and a Nobel prize winner 12 Experience Jülich: Historic sights and guided tours 18 Active Jülich: Sport and leisure facilities 22 Lots going on in Jülich … The event highlights 26 Brückenkopf-Park Jülich – the family park 28 The region around Jülich 30 Excursions in the area 32 Jülich in detail: Gastronomy and accommodation 34 3 JÜLICH: HISTORISCHE FESTUNGSSTADT UND MODERNE FORSCHUNGSSTADT Lernen Sie die Stadt im Herzen des Städtedreiecks Aachen, Köln und Düsseldorf kennen! 4 DEAR GUESTS OF OUR TOWN, I am pleased to introduce our historical fortress town and modern research town to you in this brochure. Jülich’s 2000 years of history offer you a trip through time between the past and the present, with the medieval witches’ tower, the citadel from the 16th century, the bridge head (18th / 19th century) right up to the modern research centre. -

Ambulante Suchthilfe Im Kreis Heinsberg
Ambulante Suchthilfe im Kreis Heinsberg Übersicht & Information Zielgruppen... Selbstbetroffene, Angehörige oder alle Menschen, die Fragen haben zu: • Alkohol • Medikamenten • Illegalen Drogen • Tabakabhängigkeit • Glücksspiel • PC/Internetkonsum • Problematischem Essverhalten 2 Anzeichen einer Substanzabhängigkeit: 1. Toleranzentwicklung Man braucht immer mehr Suchtmittel, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Man verträgt immer mehr Suchtmittel, kann große Mengen verstoffwechseln. 2. Entzugserscheinungen Bei plötzlichem Absetzen zeigen sich Ent- zugssymptome, z. B. Zittern, Schwitzen, Unruhe, Übelkeit, Erbrechen, Krampfanfälle, starke Kreislaufschwierigkeiten, Delir. 3. Verlangen Der Betroffene hat einen starken Wunsch oder inneren Zwang, Suchtmittel zu konsumieren. 3 Anzeichen einer Substanzabhängigkeit... 4. Kontrollverluste Der Betroffene hat nur eine verminderte Kontrollfähigkeit über Beginn, Menge oder Beendigung des Suchtmittelkonsums. 5. Vernachlässigung anderer Lebensbereiche Das normale Leben wird zugunsten des Suchtmittels aufgegeben. Dies führt u. a. zu einem oft dramatischen sozialen Abstieg. 6. Fortsetzen des Konsums trotz negativer Folgen Wie z. B. Organschädigung, Gedächtnis- störung, depressive Verstimmungen. 4 Der erste Schritt... Beratung Angehörige Betroffene in Suchtfragen Die Beratung ist kostenlos, zieloffen und dient der Klärung. Wir unterliegen der Schweige- pflicht und dem Zeugnisverweigerungsrecht. Auf Wunsch können Sie auch anonym beraten werden. 5 Wie kann es weitergehen... • Vorbereitung und Vermittlung