Technischer Bericht Wasserbauplan Aare Oberi Au Uttigen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
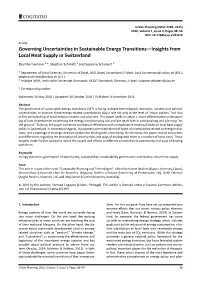
Governing Uncertainties in Sustainable Energy Transitions—Insights from Local Heat Supply in Switzerland
Urban Planning (ISSN: 2183–7635) 2016, Volume 1, Issue 3, Pages 38–54 DOI: 10.17645/up.v1i3.673 Article Governing Uncertainties in Sustainable Energy Transitions—Insights from Local Heat Supply in Switzerland Basil Bornemann 1,*, Stephan Schmidt 1 and Susanne Schubert 2 1 Department of Social Sciences, University of Basel, 4051 Basel, Switzerland; E-Mails: [email protected] (B.B.), [email protected] (S.S.) 2 Institute IWAR, Technische Universität Darmstadt, 64287 Darmstadt, Germany; E-Mail: [email protected] * Corresponding author Submitted: 20 May 2016 | Accepted: 10 October 2016 | Published: 4 November 2016 Abstract The governance of sustainable energy transitions (SET) is facing multiple technological, economic, societal and political uncertainties. In practice, these energy-related uncertainties play a role not only at the level of “major politics,” but also in the policymaking of local decision makers and planners. This paper seeks to attain a more differentiated understand- ing of how uncertainties concerning the energy transition play out and are dealt with in policymaking and planning “on the ground.” To do so, the paper combines conceptual reflections with an explorative empirical study on local heat supply policy in Switzerland. In conceptual regards, it proposes some distinctions of types of uncertainties related to energy transi- tions, and a typology of strategic decision options for dealing with uncertainty. On this basis, the paper reveals similarities and differences regarding the perception of uncertainties and ways of dealing with them in a number of Swiss cities. These insights evoke further questions about the causes and effects of different sensitivities to uncertainty and ways of dealing with them. -

20. MTB Downhill - Homberg Race 2015 Downhill Berner Kantonalmeisterschaft Rangliste Downhill Final Provisorisch
20. MTB Downhill - Homberg Race 2015 Downhill Berner Kantonalmeisterschaft Rangliste Downhill Final provisorisch Platz Nr. Name und Vorname Wohnort Team Sponsor Ziel Zeit Open Damen 1 305 Bieri Martina Schwendibach HOT-TRAIL Anifit 2:47.42 2 308 Darbre Lauriane Biel Pink Gravity Palmina, Bike Corner, Bellwald 3:00.78 3 307 Kühne Alice Scuol Pink Gravity Bike Corner Birsfelden, Palmin 3:03.80 4 306 Roth Silvia Adliswil - - 3:28.12 Abwesende 301 Flaig Ulrike Zürich Ali Fligh Fast - 303 Grossmann Naomi Veltheim keines - Ausgesch. 304 Borgeat Aline Geneve Cyclone Dh team Trek-100%-mucc-off-troy Lee de Open Senioren 1 263 Ryser Bruno Homberg 2:23.71 2 265 Aeschlimann Björn Walkringen Rennshop.ch Rennshop.ch / dead rabbit 2:24.91 3 261 Bieri Patrick Schwendibach HOT-TRAIL HOT-TRAIL 2:31.99 4 264 Wedge Derek Crans Redalp 2:37.56 5 267 Staudenmann Christian Manishaus Suspensioncenter Suspensioncenter 2:42.90 6 262 Grossenbacher Andreas Riggisberg Suspensioncenter Suspensioncenter 2:45.82 Open Junioren 1 202 Jenny Micha Kerzers Airborne Maniacs - 2:25.11 2 221 Huber Leonardo Lyss Velo Atelier Biel Velo Atelier Biel 2:34.18 3 201 Gugger Noah Thun - - 2:39.24 4 28 Nafzger Enzo Eich 2:41.77 5 210 Saurer Elia Aeschlen RC Steffisburg - 2:42.25 6 208 Wittwer Richard Wichtrach Team Freerun - 2:42.61 7 206 Feuz Tom Lauterbrunnen Bergvelo - 2:43.02 8 213 Siegenthaler Dean Uetendorf Velo Clusive 2:43.12 9 215 Teuscher Lukas Oberhofen 2:47.51 10 203 Haeuselmann Tim Muri bei Bern Muri - 2:48.31 11 209 Eisenhut Louis Wilderswil - - 2:48.70 12 214 Gerber Florian Steffisburg 2:51.22 13 204 Ammann Joël Besenbüren Keines - 2:53.31 14 211 Walther Timo Thun - - 2:53.77 15 205 Kuster Dennis Wald kein team - 2:54.09 16 207 Feuz Ronny Lauterbrunnen Bergvelo - 3:01.79 17 216 Studer Fabio Kerzers 3:04.32 Abwesende 212 Müller Micha Wichtrach Cycleworks.ch/ Flowrider Racin Cycleworks.ch/ Flowrider Racin 26.04.2015 / Homberg den 26.04.2015 um 15:22 / Seite 1/4 Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.09 TAG - Heuer Thomas Stähli VolaSoftControlPdf 20. -

Der Jahresbericht 2017-18
Ehemaligenverein der Schule Uetendorf Jahresbericht 2017/2018 Vorstandsmitglieder Präsident Thomas Riesen Kassierin Cornelia Thönen-Spycher Beisitzerin Barbara Klossner-Durtschi Layout Jahresbericht Sonja Guggisberg-Schüpbach Schulleitung Christine Maurer Peter Müller Adrian Röthlisberger Präsidentin Eva Bichsel Schulkommission Titelbild Schräge Vögel zur Ausstellung im Tierpark, Bern Strickprojekt Klassen 5d und 5e Einladung zur Hauptversammlung Mittwoch, 31. Oktober 2018, 19.30 Uhr im Lehrerzimmer, Schulhaus Riedern 1 Traktanden 1. Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der letzten Hauptversammlung 3. Jahresbericht 2017/2018 4. Jahresrechnung 2017/2018 5. Wahlen 6. Verschiedenes Im Anschluss an die Hauptversammlung offerieren wir Ihnen einen kleinen Imbiss. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen. Ehemaligenverein der Schule Uetendorf Ehemaligenverein Der Vorstand der Schule Uetendorf 1 Liebe Ehemalige Seit die meisten unserer Mitglieder die Schul- handen sind. Zu verstehen, wie ein Programm bank gedrückt haben, hat sich enorm viel ver- geschrieben wird, was hinter einer App steckt, ändert in der Schule. Von aussen erscheint wie das Internet grundsätzlich aufgebaut ist, diese mir wie ein Computer-System, an dem im gehört einfach zum Grundwissen, welches die laufenden Betrieb ständig updated und erwei- jungen Menschen für ihren Lebensweg brau- tert wird. Gerade eben wurde wieder ein neues chen wie das 1x1 (oder braucht man das even- Update eingespielt – nicht Schule 4.0 als Pen- tuell nicht mehr?) dant zu Industrie 4.0 – sondern der Lehrplan 21. Wer jetzt vermutet, dass ich von Amtes wegen Dieser Lehrplan 21 beinhaltet auch zeitlich gerne noch mehr Informatik in der Schule hätte, grosse Teile im Modul «Medien und Informa- liegt falsch! Denn neben den digitalen Fertig- tik». Wer mich etwas kennt, weiss, dass ich mich keiten sind sogenannte «social skills» genau so seit vielen Jahren im Bereich der ICT-Berufsbil- wichtig. -

Liniennetz Thun Und Umgebung Linden Jassbach Aeschlen Linden Gridenbühl Grafenbühl Schlegwegbad Oberdiessbach Abzw
Konolfingen 711 Linden Dorf Liniennetz Thun und Umgebung Linden Jassbach Aeschlen Linden Gridenbühl Grafenbühl Schlegwegbad Oberdiessbach Abzw. Bleiken Langenegg Bahnhof 44 Heimenschwand Hinterägerten 167 Oberdiessbach Aeschlen Aeschlen Marbach 44 Münsingen 167 Kastanienpark Dorf Bareichte Scheidweg Heimenschwand Post Herbligen Dorf 42 Heimenschwand Badhaus Bern Bruchenbühl Brenzikofen Höh Heimberg Dornhalde Wangelen Mühlematt 711 710 3 Wangelen Wendeplatz 43 Kuhstelle HeimenschwandWachseldornDorf Feuerwehrmagazin Hof WachseldornSüderen Schulhaus Dorf Buechwaldstrasse Rohrimoos Bad Heimenschwand Aare Riedackerstrasse Bühl Rothachen Süderen Oberei Alte Post Burgistein 701 Oberlangenegg Innerer Kreuzweg Bern Heimberg Bahnhof Fischbach Sportzentrum Obere MürggenRachholtern Lood Fahrni Dörfli Fahrni Bach Hänni UnterlangeneggAebnitSchwarzenegg Ried SchmiedeBären Ried Käserei Oberlangenegg Stalden Fahrni Lueg Gysenbühl Bödeli MoosbodenGarage Laueligrabenweg 41 Eriz Säge 712 Uttigen Aarhölzliweg Steffisburg Wendeplatte Schmiede Fahrni Unterlangenegg Bühl Schiessstand Linden Zeichenerklärung 53 Seftigen Bahnhof Heimberg Lädeli Fahrni Schlierbach Kreuzweg Schwand Abrahams Schoss 711 Tarifzone TUS Eriz Losenegg 700 Steffisburg Engerain Oberes Flühli Bieten Schulhaus Gurzelen Steffisburg Emberg Schwarzenegg Dorf Gesamtes LIBERO- Gurzelen Stuffäri Kreuz Jungfrau- Schwarzenegg Dürren Fahrausweisangebot gültig strasse Alte Bernstrasse Steffisburg Flühli 1 Haldeneggweg 57 Uetendorf Zulgbrücke Steffisburg Kirche Nur LIBERO-Abos gültig Riggisberg Gurzelen -

RGSK II Anhang A
Regionales Gesamtverkehrs‐ und Siedlungskonzept Thun‐Oberland West 2. Generation Anhang A Exemplar für die Genehmigung Beinhaltet die behördenverbindlichen Teile des Agglomerationsprogramms V+S Thun Thun, 8. Dezember 2016 RGSK Thun‐Oberland West 2. Generation Anhang A Impressum Erarbeitung im Auftrag des Regierungsrates Justiz‐, Gemeinde‐ und Kirchendirektion (JGK) und Bau‐, Verkehrs‐ und Energiedirektion (BVE) Regionale Projektleitung Planungsregionen Kandertal, Obersimmental‐Saanenland, Entwicklungsraum Thun und Regionale Verkehrs‐ konferenz OW Auftraggeber Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) Matthias Fischer Beat Michel Kant. Tiefbauamt, Oberingenieurkreis I (OIK I) Markus Wyss Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination (AÖV) Bruno Meier Geschäftsführung Planungsregionen Region Kandertal (KA) und Region Obersimmental‐Saanenland (OS‐SA) Andreas Grünig Entwicklungsraum Thun (ERT) Manuela Gebert Agglomeration Thun Thomas Jenne Auftragnehmer ALPGIS AG, Fliederweg 11, 3600 Thun Emanuel Buchs Seraina Ziörjen Metron Bern AG, Neuengasse 43, 3001 Bern Monika Saxer Antje Neumann Rundum mobil GmbH, Schulhausstrasse 2, 3600 Thun Gerhard Schuster 8. Dezember 2016 2/32 RGSK Thun‐Oberland West 2. Generation Anhang A Inhaltsverzeichnis Unfallschwerpunkte 4 Schema zur Ermittlung und Behebung von Unfallschwerpunkten 4 Definition eines Unfallschwerpunktes (USP) 5 Unfallschwerpunkte in der Region Thun‐Oberland West 6 Aus dem Kantonalen Richtplan: ÖV‐Erschliessungsgüteklassen 8 Behandlung der kantonalen Vollzugs‐ und Prüfungsaufträge 9 Analyse -

Geschäftsbericht 2012 (Pdf)
1 09.01. Philipp Hildebrand gibt sein Amt als Präsident der Schweizerischen Nationalbank per sofort ab; 13.01. Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia; 3 14.01. Beat Feuz gewinnt die Lauberhornabfahrt; 11.02. Whitney Houston wird in Los Angeles tot aufgefunden; 17.02. Das Musical «Alperose» wird in Bern uraufgeführt; 17.02. Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff tritt wegen der Kreditaffäre zurück; 24.02. Der Stummfilm «The Artist» wird mit fünf Oscars ausgezeichnet; 4 5 28.02. Die Mieter der Berner Markthalle erhalten die Kündigung auf Mai 2013; 10.03. Der kanadische Skicrosser Nick Zoricic stirbt am Weltcup in Grindelwald; GESCHÄFTSBERICHT 2012 186. Geschäftsjahr der AEK BANK 1826 Genossenschaft Erstattet vom Verwaltungsrat an die Generalversammlung der Genossenschafter vom 16. März 2013 6 7 IN KÜRZE 2012 2011 Veränderung CHF 1’000 CHF 1’000 CHF 1’000 Bilanzsumme 3‘082‘055 2‘895‘844 + 186‘211 Allgemeine gesetzliche Reserve 222‘598 214‘357 + 8‘241 Reserven für allgemeine Bankrisiken 99‘750 96‘750 + 3‘000 Kundenausleihungen 2‘710‘856 2‘569‘912 + 140‘944 Kundengelder 2‘297‘010 2‘110‘495 + 186‘515 15.04. Wacker Thun gewinnt nach 2002 und 2006 zum dritten Mal den Schweizer Cup; 28.04. Der Uetendorfer Luca Hänni wird bei DSDS neuer «Superstar»; Eigene Mittel (nach Gewinnverwendung) 341‘727 330‘393 + 11‘334 Bruttogewinn 33‘583 32‘399 + 1‘184 Mitarbeitende 120 115 Vollzeitstellen 102.2 99.6 Auszubildende 9 9 Hauptsitz / 3601 Thun Niederlassungen 13 12 Nebenamtliche Niederlassungen 2 2 8 9 AEK BANK 1826 Verwaltungsrat Führung und Organisation Präsident Dr. Hans-Ulrich Zurflüh1, Oberhofen Direktion Dr. -

Jahresprogramm 2020
Kontakt www.samariteruetendorf-thierachern.ch Samariterverein Uetendorf-Thierachern Präsident Thomas Gattiker 079 828 75 41 Schulrainstrasse 45 3661 Uetendorf Vize-Präsidentin Monica Hübscher 033 345 49 83 Niederhornweg 8 3661 Uetendorf Jahresprogramm Kassier Beno Hunger 076 322 10 15 Goferi 402 3634 Thierachern 2020 Sekretärin Barbara Aeschlimann 078 732 78 06 Bödeli 194 3619 Eriz Kursleiterin/ Renata Wyss 078 904 60 54 Technische Leiterin Niesenstrasse 42 3634 Thierachern Technische Leiterin/ Silvia Wyss 033 345 34 74 Blutspenden Niesenstrasse 42 3634 Thierachern Kursleiterin Sarah Hess 079 230 29 60 Langestrasse 28 3603 Thun Postendienst Monika Stähli 079 248 80 52 Fischerweg 51 3600 Thun Materialverwalter/ Werner Stähli 033 345 53 78 Krankenmobilien Räbgasse 3 3634 Thierachern Krankenbesuche Hanni Rusterholz 033 345 63 59 Uetendorf Schilthornweg 20 ... chum, u mach doch mit ... 3661 Uetendorf Krankenbesuche Maria Jossi 033 345 32 03 Thierachern Brüggstrasse 25 3634 Thierachern Monatsübungen Postendienste (19.30 – 21.30 Uhr) Datum Anlass Datum Thema Ort Sa, 28. März 2020 Tannenfuhr Thierachern (Versteigerung und Fest) Mo, 13. Januar 2020 Verbände SanPo Sa, 4. April 2020 Tannenfuhr Thierachern (Umzug) Di, 10. März 2020 Atmung KGH So, 26. April 2020 Schulfest, Uetendorf Mo, 20. April 2020 Bodycheck SanPo So, 17. Mai 2020 UBS Kids Cup, MZH Bach Uetendorf Postendienst mit Mo, 11. Mai 2020 SanPo Festhaltungen So, 14. Juni 2020 Ryfflischiessen, Thun-Guntelsey Di, 9. Juni 2020 1. Hilfe Orientierungslauf SanPo Fr, 31. Juli 2020 Bundesfeier, MZH Kandermatte Thierachern Mi, 9. September 2020 Skelett SanPo Sa, 1. August 2020 Bundesfeier, Badi Uetendorf Mo, 12. Oktober 2020 Wintersalbe KGH Sa, 22. August 2020 ROKJA Strassenfest, Uetendorf Mo, 9. -

Die Region Thun-Oberhofen Auf Ihrem Weg in Den Bernischen Staat (1384–1803)
Die Region Thun-Oberhofen auf ihrem Weg in den bernischen Staat (1384–1803) Anne-Marie Dubler1 Inhaltsverzeichnis 1. Die Region zur Zeit der Grafen von Kiburg: Stadt Thun, Äusseres Amt, Adelsherrschaften .............................. 64 2. Die Stadt Thun und das Freigericht unter Bern: Die Neugestaltung der Verwaltung ............................................... 68 Stadt Thun: Stadtraum und Burgernziel ....................................... 69 Das Freigericht ersetzt das Äussere Amt ....................................... 70 Wem Gericht und Galgen gehören, dem gehört die Herrschaft: Die Rolle der Gerichtsbarkeit ....................................................... 71 3. Der Ausbau der bernischen Landesverwaltung in der Region ....... 77 Das Amt Thun und seine Erweiterung.......................................... 77 Die Vogtei Oberhofen – eine späte Neuschöpfung........................ 83 Die Amtsverwaltungen von Thun und Oberhofen: Schultheissen von Thun................................................................ 83 Vögte von Oberhofen................................................................... 84 Landschreiber von Thun .............................................................. 85 Amtsschreiber von Oberhofen...................................................... 86 Berns Strategie beim Aufbau der Landesherrschaft in der Region ... 86 4. Die Stadt Thun erwirbt und verwaltet Herrschaften über ihr Stadtspital....................................................................... 87 5. Die Privatherrschaften in der Region -

1 Regionale Offene Kinder Und Jugendarbeit Amsoldingen – Thierachern – Uebesc
Regionale Offene Kinder und Jugendarbeit Amsoldingen – Thierachern – Uebeschi – Uetendorf - Uttigen Vorwort Jugend: Quo vadis? Ein Ausschnitt aus den Uetendorfer Nachrichten weist auf Probleme mit Jugendlichen hin: „Es wird oft geraucht von Schülern aller Alterskategorien ... hauptsächlich in der Freizeit, auf dem Schulweg und wenn am Abend draussen noch „gespielt“ wird... Bier scheint der geeignete Durstlöscher zu sein... Ein berühmter Sport ist das Chlauen...“ Der Text wurde jedoch nicht 2015 sondern 1992 von besorgten Eltern geschrieben! Viele weitere Texte, teilweise aus der Antike, zeigen auf: Seit jeher reiben sich die Erwachsenen an den Jugendlichen – und umgekehrt. Es gibt auch andere Nachrichten. Unter dem Titel „Generation brav“ hat die NZZ kürzlich Fakten aufgezeigt: Die Jugendkriminalität sinkt, Minderjährige konsumieren weniger Alkohol, rauchen weniger und schwänzen weniger die Schule. Kinder und Jugendliche fallen auf. Oft positiv, lebensbejahend, voller Energie, manchmal jedoch auch destruktiv, lärmend, zerstörend. In diesem Spannungsfeld arbeiten auch die institutionellen Angebote wie Schule, Schulsozialarbeit, Tagesschule oder auch die Offene Kinder- und Jugendarbeit. Wichtig im Ganzen erscheint mir, dass alle Beteiligten ihre eigene Rolle kennen, verstehen und diese auch wahrnehmen. Auch die Rolle des Andern will verstanden sein. Nur so kann ein gesellschaftliches Ganzes entstehen, welches unseren Kindern und Jugendlichen eine gute Basis für eine gesunde Entwicklung bietet, ihnen den nötigen Freiraum gibt, ihnen aber auch die Leitplanken aufzeigt und setzt. Ich bin dankbar, dass das Jugendbüro seine Rolle im letzten Jahr neu definiert und gefunden hat. Sei es in der Animation in den Treffs oder mit dem Bauwagen, in der Prävention oder auch in der persönlichen Begleitung von Jugendlichen. In allen fünf Vertragsgemeinden sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jugendbüros mittlerweile gut bekannt und ihre Angebote werden sehr gut besucht. -

11. Februar 2020 Verkehrserschwerung
Oberingenieurkreis l Tiefbauamt des Kantons Bern Schlossberg 20, Postfach 3602 Thun Telefon +41 31 636 44 00 www.be.ch/tba [email protected] Stefan von Gunten Direktwahl +41 31 636 44 21 [email protected] 11. Februar 2020 Verkehrserschwerung Kantonsstrasse Nr. 1137 Amsoldingen - Höfen - Oberstocken Kantonsstrasse Nr. 1106 Uetendorf - Amsoldingen - Reutigen Gemeinde: Amsoldingen 21020238 / Erneuerung Gehwege Amsoldingen Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassengesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) und Art. 43 der Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), wird auf dieser Kantonsstrasse die Verkehrsabwicklung wie folgt erschwert: Teilstrecke Amsoldingen Stäghalte - Chorherrengasse ( 2'611'105 / 1'175'690 - 2'610'828 / 1'175'002) Dauer 24.02.2020 bis voraussichtlich Ende Juni 2020 Verkehrsführung Teilweise einspurige Verkehrsführung, Verkehrsregelung mit Lichtsignal- anlage oder von Hand. Einschränkungen Zu Fuss Gehende und Radfahrende können die Baustelle unter erschwerten Verhältnissen passieren. Grund Bauliche Sanierung der Gehwege. Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis für die unumgängliche Verkehrserschwerung. 3602 Thun, 12. Februar 2020 Oberingenieurkreis l Geschäft: 2019.BVE.14925 / Dok: 1120543 Geht zur zweimaligen Publikation (per E-Mail) an Thuner Amtsanzeiger Donnerstag, 20.02. und 27.02.2020 Amtsblatt des Kantons Bern Mittwoch, 19.02. und 26.02.2020 Kopie zur Kenntnis an Gemeindeverwaltung Amsoldingen (mit der Bitte um Weiterleitung an interessierte lokale Betriebe) Örtliche Feuerwehr Regierungsstatthalteramt -

Albert Schweitzer-Woche Uetendorf Ehrfurcht Vor
PROGRAMM Mittwoch 18.September 2019 Albert Schweitzer – Sein Werk und Gedankengut von Entwicklung und Zusammenarbeit Nachtessen im Restaurant Alpenblick – CHF 35.– ohne Getränke 17.45 Uhr Eintreffen der Gäste 20.15 Uhr Vortrag im Mehrzwecksaal mit Fritz von Gunten, Präsident Hilfsverein Albert Schweitzer-Spital, Kollekte ca. 21.00 Uhr Ende des Vortrags, anschliessend gemütliches Ausklingen im Restaurant Alpenblick Anmeldungen: Restaurant Alpenblick Uetendorfberg, 3661 Uetendorf, Telefon 033 346 03 01 Freitag 20. September 2019 Orgelkonzert zum Gedenken an Albert Schweitzers «Ehrfurcht vor dem Leben» Dominik Röglin spielt die Albert Schweitzer-Orgel Textlesung Regula van Swigchem 20.00 Uhr in der Kirche Uetendorf, Kollekte EHRFURCHT VOR DEM LEBEN ALBERT SCHWEITZER-WOCHE UETENDORF 13.– 20. SEPTEMBER 2019 Kirchgemeinde Thierachern www.albert-schweitzer.ch Thierachern-Uebeschi-Uetendorf PROGRAMM William Maul W. Measey, einst Besitzer des Schlosses Oberhofen am Thunersee und grosser Verehrer und Gönner vom «Urwaldspital» in Lambarene (Gabun) bat Albert Schweitzer, für die Freitag 13. September 2019 Kirche von Uetendorf eine Orgel zu entwerfen. Diese sollte klanglich jener Orgel in der Kirche von Cinema Paradiso präsentiert in der Kirche Uetendorf den Film Günsbach im Elsass, der Heimatgemeinde Schweitzers, entsprechen. Anlässlich seines Besuches «Albert Schweitzer» von Erica Anderson am 21. September 1957 in Uetendorf spielte Schweitzer auf «seiner» Orgel. Allerdings nur mit 1957 – Oscar für den besten Dokumentarfilm neun Fingern, da der kleine Finger seiner rechten Hand in einem Gips steckte. Anschliessend gemütliches Ausklingen in der Paradiso-Lounge im Albert Schweitzer-Saal Filmstart um 19.30 Uhr, Kollekte Aus Anlass 70 Jahre Schweizer Hilfsverein für das Albert Schweitzer-Spital in Lambarene findet vom 13.– 20. -

Regine Gfeller Die Schulleiterin Geht Mit Respekt in Die Wintersaison
NR. 5 | OKTOBER 2020 Kultur Grosser Kulturpreis für Portenier SEITE 12 Biodiversität Massnahmen für die kalte Jahreszeit SEITE 18 Schloss Thun Sonderausstellung Zähringer SEITE 26 Regine Gfeller Die Schulleiterin geht mit Respekt in die Wintersaison. SEITE 6 NEU bei Möbel Brügger: INHALT Eröffnung Rolf Benz Studio am 13. Oktober 2020 Wohnevent Dienstag 13. Okt. 2020 Editorial Liebe Leserin, bis Sonntag lieber Leser Als Schulleiterin und 18. Okt. 2020 Lehrerin prägt Regine Seite Gfeller die Zukunft Dienstag bis Freitag 18 Thuns seit 30 Jahren. 09.00-18.30 Uhr In Ihrem Beruf, den sie mit grosser Leiden- Samstag und Sonntag schaft ausübt, ist sie 10.00 -17.00 Uhr mit verschiedenen Er- wartungen konfrontiert. Obwohl man nicht allen Ansprüchen gerecht werden könne, schätzt die Schulleiterin die zu- nehmende Differenzierung und Farbig- keit in der Gesellschaft, wie sie im Tite- linterview betont. Sie ist des Lobes voll über «die heutige Jugend» und attes- Seite 24 tiert ihr eine hohe Kompetenz, viel Selbstsicherheit und Kreativität. Eigen- Wohnen mit Emotionen schaften, von denen Thun nur profitie- Seite 15 ren kann. Nebst der Schule werden natürlich auch in der Politik wichtige Grundsteine für die künftige Entwicklung unserer Stadt gelegt. Eines der aktuell wichtigs- Grosse Inhalt ten und grössten Projekte der Stadt ist die Ortsplanungsrevision. Im Rahmen EDITORIAL Herbstausstellung. 18 Serie Biodiversität: Wie der der Mitwirkung konnte sich die Bevölke- 3 Simone Tanner: Thun – eine Garten im Herbst zum Refugium rung dazu äussern, wie Thun in 10, 20 lebens- und liebenswerte Stadt für Tiere wird oder 30 Jahren aussehen soll. Die über Besuchen Sie uns und 21 Seegebiet: Äschenlarven erhalten 600 Eingaben und 1200 Anliegen sind neues Zuhause machen Sie eine Probefahrt.