Metastasio Und Hasse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Závěrečné Práce
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu Zpěv J. A. Hasse – La Clemenza di Tito Diplomová práce Autor práce: BcA. Pavel Valenta Vedoucí práce: doc. Mgr. MgA. Monika Holá Ph.D. Oponent práce: PhDr. Alena Borková Brno 2013 Bibliografický záznam VALENTA, Pavel. J. A. Hasse – La Clemenza di Tito. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra zpěvu, rok 2013. 49 s. Vedoucí diplomové práce odb. as. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. Anotace Diplomová práce „J. A. Hasse – La Clemenza di Tito“ pojednává o Hasseho opeře s původním názvem „Tito Vespasiano, ovvero La Clemenza di Tito“ z roku 1735. Obsahuje životopisy jejích tvůrců Johanna Adolfa Hasseho (hudba) a Pietra Metastasia (libreto) a historické okolnosti vzniku opery. Součástí je pojednání o novodobé světové premiéře opery v roce 2010 v zámeckém divadle v Českém Krumlově a dramaturgický rozbor titulní role císaře Tita Vespasiana. Annotation Diploma thesis „J. A. Hasse – La Clemenza di Tito” deals with Hasse’s opera with original title “Tito Vespasiano, ovvero La Clemenza di Tito“ from 1735. Thesis include biographies of composer J. A. Hasse and librettist P. Metastasio and historical circumstances of the genesis of the opera. Also included information about its modern world premiere in castle theatre in Cesky Krumlov in 2010 and dramatical analysis of the role of Tito Vespasiano. Klíčová slova Tito Vespasiano, La Clemenza di Tito, opera, Johann Adolf Hasse, Pietro Metastasio, barokní divadlo, Český Krumlov, analýza role Keywords Tito Vespasiano, La Clemenza di Tito, Opera, Johann Adolf Hasse, Pietro Metastasio, Baroque Theatre, Český Krumlov, analysis of the role Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. -

L'opera Italiana Nei Territori Boemi Durante Il
L’OPERA ITALIANA NEI TERRITORI BOEMI DURANTE IL SETTECENTO V. 1-18_Vstupy.indd 2 25.8.20 12:46 Demofoonte come soggetto per il dramma per musica: Johann Adolf Hasse ed altri compositori del Settecento a cura di Milada Jonášová e Tomislav Volek ACADEMIA Praga 2020 1-18_Vstupy.indd 3 25.8.20 12:46 Il libro è stato sostenuto con un finanziamento dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca. Il convegno «Demofoonte come soggetto per il dramma per musica: Johann Adolf Hasse ed altri compositori del Settecento» è stato sostenuto dall’Istituto della Storia dell’Arte dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca con un finanziamento nell’ambito del programma «Collaborazione tra le Regioni e gli Istituti dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca » per l’anno 2019. Altra importante donazione ha ricevuto l’Istituto della Storia dell’Arte dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca da Johann Adolf Hasse-Gesellschaft a Bergedorf e.V. Prossimo volume della collana: L’opera italiana – tra l’originale e il pasticcio In copertina: Pietro Metastasio, Il Demofoonte, atto II, scena 9 „Vieni, mia vita, vieni, sei salva“, Herissant, vol. 1, Paris 1780. In antiporta: Il Demofoonte, atto II, scena 5 „Il ferro, il fuoco“, in: Opere di Pietro Metastasio, Pietro Antonio Novelli (disegnatore), Pellegrino De Col (incisore), vol. 4, Venezia: Antonio Zatta, 1781. Recensori: Prof. Dr. Lorenzo Bianconi Prof. Dr. Jürgen Maehder Traduzione della prefazione: Kamila Hálová Traduzione dei saggi di Tomislav Volek e di Milada Jonášová: Ivan Dramlitsch -

Handel's Oratorios and the Culture of Sentiment By
Virtue Rewarded: Handel’s Oratorios and the Culture of Sentiment by Jonathan Rhodes Lee A dissertation submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Davitt Moroney, Chair Professor Mary Ann Smart Professor Emeritus John H. Roberts Professor George Haggerty, UC Riverside Professor Kevis Goodman Fall 2013 Virtue Rewarded: Handel’s Oratorios and the Culture of Sentiment Copyright 2013 by Jonathan Rhodes Lee ABSTRACT Virtue Rewarded: Handel’s Oratorios and the Culture of Sentiment by Jonathan Rhodes Lee Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Davitt Moroney, Chair Throughout the 1740s and early 1750s, Handel produced a dozen dramatic oratorios. These works and the people involved in their creation were part of a widespread culture of sentiment. This term encompasses the philosophers who praised an innate “moral sense,” the novelists who aimed to train morality by reducing audiences to tears, and the playwrights who sought (as Colley Cibber put it) to promote “the Interest and Honour of Virtue.” The oratorio, with its English libretti, moralizing lessons, and music that exerted profound effects on the sensibility of the British public, was the ideal vehicle for writers of sentimental persuasions. My dissertation explores how the pervasive sentimentalism in England, reaching first maturity right when Handel committed himself to the oratorio, influenced his last masterpieces as much as it did other artistic products of the mid- eighteenth century. When searching for relationships between music and sentimentalism, historians have logically started with literary influences, from direct transferences, such as operatic settings of Samuel Richardson’s Pamela, to indirect ones, such as the model that the Pamela character served for the Ninas, Cecchinas, and other garden girls of late eighteenth-century opera. -

MWV Saverio Mercadante
MWV Saverio Mercadante - Systematisches Verzeichis seiner Werke vorgelegt von Michael Wittmann Berlin MW-Musikverlag Berlin 2020 „...dem Andenken meiner Mutter“ November 2020 © MW- Musikverlag © Michael Wittmann Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdruckes und der Übersetzung. !hne schriftliche Genehmigung des $erlages ist es auch nicht gestattet, dieses urheberrechtlich geschützte Werk oder &eile daraus in einem fototechnischen oder sonstige Reproduktionverfahren zu verviel"(ltigen oder zu verbreiten. Musikverlag Michael Wittmann #rainauerstraße 16 ,-10 777 Berlin /hone +049-30-21*-222 Mail4 m5 musikverlag@gmail com Vorwort In diesem 8ahr gedenkt die Musikwelt des hundertfünzigsten &odestages 9averio Merca- dantes ,er Autor dieser :eilen nimmt dies zum Anlaß, ein Systematisches Verzeichnis der Wer- ke Saverio Mercdantes vorzulegen, nachdem er vor einigen 8ahren schon ein summarisches Werkverzeichnis veröffentlicht hat <Artikel Saverio Mercadante in: The New Groves ictionary of Musik 2000 und erweitert in: Neue MGG 2008). ?s verbindet sich damit die @offnung, die 5eitere musikwissenschaftliche ?rforschung dieses Aomponisten zu befördern und auf eine solide philologische Grundlage zu stellen. $orliegendes $erzeichnis beruht auf einer Aus5ertung aller derzeit zugänglichen biblio- graphischen Bindmittel ?in Anspruch auf $ollst(ndigkeit 5(re vermessen bei einem Aom- ponisten 5ie 9averio Mercadante, der zu den scha"fensfreudigsten Meistern des *2 8ahrhunderts gehört hat Auch in :ukunft ist damit zu rechnen, da) 5eiter Abschriften oder bislang unbekannte Werke im Antiquariatshandel auftauchen oder im :uge der fortschreitenden Aata- logisierung kleinerer Bibliotheken aufgefunden 5erden. #leichwohl dürfte (mit Ausnahme des nicht vollst(ndig überlieferten Brüh5erks> mit dem Detzigen Borschungsstand der größte &eil seiner Werk greifbar sein. ,ie Begründung dieser Annahme ergibt sich aus den spezi"ischen #egebenheiten der Mercadante-Überlieferung4 abgesehen von der frühen Aonservatoriumszeit ist Mercdante sehr sorgfältig mit seinen Manuskripten umgegangen. -

Iphigénie En Tauride
Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Tauride CONDUCTOR Tragedy in four acts Patrick Summers Libretto by Nicolas-François Guillard, after a work by Guymond de la Touche, itself based PRODUCTION Stephen Wadsworth on Euripides SET DESIGNER Saturday, February 26, 2011, 1:00–3:25 pm Thomas Lynch COSTUME DESIGNER Martin Pakledinaz LIGHTING DESIGNER Neil Peter Jampolis CHOREOGRAPHER The production of Iphigénie en Tauride was Daniel Pelzig made possible by a generous gift from Mr. and Mrs. Howard Solomon. Additional funding for this production was provided by Bertita and Guillermo L. Martinez and Barbara Augusta Teichert. The revival of this production was made possible by a GENERAL MANAGER gift from Barbara Augusta Teichert. Peter Gelb MUSIC DIRECTOR James Levine Iphigénie en Tauride is a co-production with Seattle Opera. 2010–11 Season The 17th Metropolitan Opera performance of Christoph Willibald Gluck’s Iphigénie en This performance is being broadcast Tauride live over The Toll Brothers– Metropolitan Conductor Opera Patrick Summers International Radio Network, in order of vocal appearance sponsored by Toll Brothers, Iphigénie America’s luxury Susan Graham homebuilder®, with generous First Priestess long-term Lei Xu* support from Second Priestess The Annenberg Cecelia Hall Foundation, the Vincent A. Stabile Thoas Endowment for Gordon Hawkins Broadcast Media, A Scythian Minister and contributions David Won** from listeners worldwide. Oreste Plácido Domingo This performance is Pylade also being broadcast Clytemnestre Paul Groves** Jacqueline Antaramian live on Metropolitan Opera Radio on Diane Agamemnon SIRIUS channel 78 Julie Boulianne Rob Besserer and XM channel 79. Saturday, February 26, 2011, 1:00–3:25 pm This afternoon’s performance is being transmitted live in high definition to movie theaters worldwide. -

European Music Manuscripts Before 1820
EUROPEAN MUSIC MANUSCRIPTS BEFORE 1820 SERIES TWO: FROM THE BIBLIOTECA DA AJUDA, LISBON Section B: 1740 - 1770 Unit Six: Manuscripts, Catalogue No.s 1242 - 2212 Primary Source Media EUROPEAN MUSIC MANUSCRIPTS BEFORE 1820 SERIES TWO: FROM THE BIBLIOTECA DA AJUDA, LISBON Section B: 1740-1770 Unit Six: Manuscripts, Catalogue No.s 1242 - 2212 First published in 2000 by Primary Source Media Primary Source Media is an imprint of the Gale Cengage Learning. Filmed in Portugal from the holdings of The Biblioteca da Ajuda, Lisbon by The Photographic Department of IPPAR. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior permission. CENGAGE LEARNING LIBRARY PRIMARY SOURCE MEDIA REFERENCE EMEA GALE CENGAGE LEARNING Cheriton House 12 Lunar Drive North Way Woodbridge Andover SP10 5BE Connecticut 06525 United Kingdom USA http://gale.cengage.co.uk/ www.gale.cengage.com CONTENTS Introduction 5 Publisher’s Note 9 Contents of Reels 11 Listing of Manuscripts 15 3 INTRODUCTION The Ajuda Library was established after the Lisbon earthquake of 1755 near the royal palace of the same name to replace the court library which had been destroyed in the earthquake, and from its creation it incorporated many different collections, which were either acquired, donated or in certain cases confiscated, belonging to private owners, members of the royal family or religious institutions. Part of the library holdings followed the royal family to Brazil after 1807 and several of these remained there after the court returned to Portugal in 1822. The printed part of those holdings constituted the basis of the National Library of Rio de Janeiro. -

Of Titles (PDF)
Alphabetical index of titles in the John Larpent Plays The Huntington Library, San Marino, California This alphabetical list covers LA 1-2399; the unidentified items, LA 2400-2502, are arranged alphabetically in the finding aid itself. Title Play number Abou Hassan 1637 Aboard and at Home. See King's Bench, The 1143 Absent Apothecary, The 1758 Absent Man, The (Bickerstaffe's) 280 Absent Man, The (Hull's) 239 Abudah 2087 Accomplish'd Maid, The 256 Account of the Wonders of Derbyshire, An. See Wonders of Derbyshire, The 465 Accusation 1905 Aci e Galatea 1059 Acting Mad 2184 Actor of All Work, The 1983 Actress of All Work, The 2002, 2070 Address. Anxious to pay my heartfelt homage here, 1439 Address. by Mr. Quick Riding on an Elephant 652 Address. Deserted Daughters, are but rarely found, 1290 Address. Farewell [for Mrs. H. Johnston] 1454 Address. Farewell, Spoken by Mrs. Bannister 957 Address. for Opening the New Theatre, Drury Lane 2309 Address. for the Theatre Royal Drury Lane 1358 Address. Impatient for renoun-all hope and fear, 1428 Address. Introductory 911 Address. Occasional, for the Opening of Drury Lane Theatre 1827 Address. Occasional, for the Opening of the Hay Market Theatre 2234 Address. Occasional. In early days, by fond ambition led, 1296 Address. Occasional. In this bright Court is merit fairly tried, 740 Address. Occasional, Intended to Be Spoken on Thursday, March 16th 1572 Address. Occasional. On Opening the Hay Marker Theatre 873 Address. Occasional. On Opening the New Theatre Royal 1590 Address. Occasional. So oft has Pegasus been doom'd to trial, 806 Address. -

EJC Cover Page
Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR. Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries. We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes. Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early- journal-content. JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. GLUCK'S LONDON OPERAS By WILLIAM BARCLAY SQUIRE WV ITH the conspicuous exception of Horace Walpole's letters, we are singularly deficient in social chronicles of the later years of the reign of George II. For con- temporary accounts of the invasion of England by Prince Charles Edward in 1745, of his surprising march to Derby and the consternation it created in London-when the news arrived on a day long remembered as 'Black Friday'-Walpole's letters, which are our chief authority, have to be supplemented by reference to the newspapers of the day. -
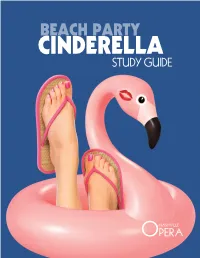
Beach Party Ci Nd Erella Study Guide
BEACH PARTY CI ND ERELLA STUDY GUIDE NASHVILLE OPERA CINDERELLA by Gioachino Rossini JUNE 12, 2021 The Ann & Frank Bumstead Production Special 90-minute Adaptation Ascend Amphitheater Directed by John Hoomes Conducted by Dean Williamson Featuring the Nashville Opera Orchestra CAST & CHARACTERS Cinderella (Angelina) Emily Fons* The Prince Matthew Grills* Dandini Jonathan Beyer* Don Magnifico Stefano de Peppo* Alidoro Christopher Curcuruto*† Tisbe Emilyl Cottam*† Clorinda Bryn Holdsworth* Brian Russell Jonas Grumby * Nashville Opera debut † 2021 Mary Ragland Emerging Artist TICKETS & INFORMATION Contact Nashville Opera at 615.832.5242 or visit nashvilleopera.org/cinderella SPONSORED BY ANN MARIE AND MARTIN M cNAMARA III NASHVILLE WITH SUPPORT FROM THE JUDY & NOAH SUE & EARL OPERA LIFF FOUNDATION SWENSSON THE STORY Rossini composed his version of the CINDERELLA folk tale in a staggering three weeks during 1817. He was only twenty-four years old at the time. Based on Charles Perrault’s CENDRILLON of 1697, La Cenerentola follows a common girl who dreams of a happier life and a prince who seeks to marry the most beautiful girl he can find. Rossini’s plot diverges from the fairy-tale tradition and takes a more realistic approach, with an endearing and sensible central character. Director John Hoomes brings some of the magic spirit back by setting the farcical tale by the sea in his BEACH BLANKET BINGO -inspired staging. THIS SYNOPSIS HAS BEEN UPDATED TO REFLECT JOHN HOOMES’S BEACH-PARTY STAGING It’s morning in the broken-down surf shop owned by Don and tells him to search for the young woman wearing the Magnifico. -

Carlo Goldoni As Musical Reformer
CARLO GOLDONI AS MUSICAL REFORMER IN SEARCH OF REALISM IN THE DRAMMA GIOCOSO La vraisemblance doit toujours être la principale règle, et sans laquelle toutes les autres deviennent déréglées. -l’Abbé d’Aubignac, La Pratique du Théâtre by Pervinca Rista Dissertation submitted to the Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Baltimore, Maryland March 18, 2015 © Pervinca Rista All Rights Reserved Abstract Venetian playwright Carlo Goldoni (1707-1793), who is best remembered in literary history for his realist ‘reform’ of comic theatre, was also a prolific librettist. In particular, his texts for music written from 1748 onwards remain understudied but warrant significant reappraisal, for Goldoni was one of the first to give shape to the dramma giocoso, an innovative and realistic new genre of opera that went on to have a lasting legacy all the way to W. A. Mozart and Lorenzo da Ponte. Through an interdisciplinary, historical approach and intertextual analysis, the present study reevaluates Goldoni’s drammi giocosi, largely overlooked by scholarship, to uncover the lasting innovations in form and content introduced by the Venetian playwright. Analysis of these texts also reveals clear affinity between Goldoni's contributions to the dramma giocoso and his reform of prose theatre. Most importantly, unlike other types of comic opera, the dramma giocoso has the particularity of combining buffo with serio, a dynamic that, through Goldoni's mature output, continually evolves to bring new realism and social relevance to opera theatre. Goldoni’s influence on this type of musical representation has not been fully considered, but the realism in music that he achieves through the dramma giocoso must be acknowledged as a lasting contribution to modern literature, and to operatic history. -

WOLFGANG AMADEUS MOZART Works for The
New Mozart Edition II/5/7 Lucio Silla WOLFGANG AMADEUS MOZART Series II Works for the Stage WORK GROUP 5: OPERAS AND SINGSPIELS VOLUME 7: LUCIO SILLA SUB-VOLUME 1: ACT I PRESENTED BY KATHLEEN KUZMICK HANSELL 1986 International Mozart Foundation, Online Publications IV New Mozart Edition II/5/7 Lucio Silla Neue Mozart-Ausgabe (New Mozart Edition)* WOLFGANG AMADEUS MOZART The Complete Works BÄRENREITER KASSEL BASEL LONDON En coopération avec le Conseil international de la Musique Editorial Board: Dietrich Berke Wolfgang Plath Wolfgang Rehm Agents for BRITISH COMMONWEALTH OF NATIONS: Bärenreiter Ltd. London BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Bärenreiter-Verlag Kassel SWITZERLAND and all other countries not named here: Bärenreiter-Verlag Basel As a supplement to each volume a Critical Report (Kritischer Bericht) in German is available The editing of the NMA is supported by City of Augsburg City of Salzburg Administration Land Salzburg City of Vienna Konferenz der Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, represented by Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, with funds from Bundesministerium für Forschung und Technologie, Bonn and Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Ministerium für Kultur der Deutschen Demokratischen Republik Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Vienna * Hereafter referred to as the NMA. The predecessor, the "Alte Mozart-Edition" (Old Mozart Edition) is referred to as the AMA. International Mozart Foundation, Online Publications V New Mozart Edition II/5/7 Lucio Silla CONTENTS Sub-volume 1: Editorial Principles ……………..…………………………………………………….. VII Foreword………….…………………….……………………………………………… IX Facsimile: first page of the autograph: beginning of the Overtura………………………. XLIV Facsimile: autograph Atto primo , leaf 91 r: beginning of Scena VII …………………….. XLV Facsimiles: autograph Atto secondo , leaf 14(13) v and leaf 15(14) r: from the Recitativo in Scena II……………………………………………………………. -
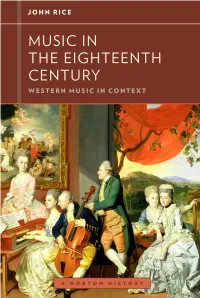
MUSIC in the EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: a Norton History Walter Frisch Series Editor
MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: A Norton History Walter Frisch series editor Music in the Medieval West, by Margot Fassler Music in the Renaissance, by Richard Freedman Music in the Baroque, by Wendy Heller Music in the Eighteenth Century, by John Rice Music in the Nineteenth Century, by Walter Frisch Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries, by Joseph Auner MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY John Rice n W. W. NORTON AND COMPANY NEW YORK ē LONDON W. W. Norton & Company has been independent since its founding in 1923, when William Warder Norton and Mary D. Herter Norton first published lectures delivered at the People’s Institute, the adult education division of New York City’s Cooper Union. The firm soon expanded its program beyond the Institute, publishing books by celebrated academics from America and abroad. By midcentury, the two major pillars of Norton’s publishing program— trade books and college texts—were firmly established. In the 1950s, the Norton family transferred control of the company to its employees, and today—with a staff of four hundred and a comparable number of trade, college, and professional titles published each year—W. W. Norton & Company stands as the largest and oldest publishing house owned wholly by its employees. Copyright © 2013 by W. W. Norton & Company, Inc. All rights reserved Printed in the United States of America Editor: Maribeth Payne Associate Editor: Justin Hoffman Assistant Editor: Ariella Foss Developmental Editor: Harry Haskell Manuscript Editor: JoAnn Simony Project Editor: Jack Borrebach Electronic Media Editor: Steve Hoge Marketing Manager, Music: Amy Parkin Production Manager: Ashley Horna Photo Editor: Stephanie Romeo Permissions Manager: Megan Jackson Text Design: Jillian Burr Composition: CM Preparé Manufacturing: Quad/Graphics—Fairfield, PA Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rice, John A.