Inhaltsverzeichnis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tales of Mold-Ripened Cheese SISTER NOËLLA MARCELLINO, O.S.B.,1 and DAVID R
The Good, the Bad, and the Ugly: Tales of Mold-Ripened Cheese SISTER NOËLLA MARCELLINO, O.S.B.,1 and DAVID R. BENSON2 1Abbey of Regina Laudis, Bethlehem, CT 06751; 2Department of Molecular and Cell Biology, University of Connecticut, Storrs, CT 06269-3125 ABSTRACT The history of cheese manufacture is a “natural cheese both scientifically and culturally stems from its history” in which animals, microorganisms, and the environment ability to assume amazingly diverse flavors as a result of interact to yield human food. Part of the fascination with cheese, seemingly small details in preparation. These details both scientifically and culturally, stems from its ability to assume have been discovered empirically and independently by a amazingly diverse flavors as a result of seemingly small details in preparation. In this review, we trace the roots of cheesemaking variety of human populations and, in many cases, have and its development by a variety of human cultures over been propagated over hundreds of years. centuries. Traditional cheesemakers observed empirically that Cheeses have been made probably as long as mam- certain environments and processes produced the best cheeses, mals have stood still long enough to be milked. In unwittingly selecting for microorganisms with the best principle, cheese can be made from any type of mam- biochemical properties for developing desirable aromas and malian milk. In practice, of course, traditional herding textures. The focus of this review is on the role of fungi in cheese animals are far more effectively milked than, say, moose, ripening, with a particular emphasis on the yeast-like fungus Geotrichum candidum. -

Identificación De Ácaros Interceptados En Plantas Y Productos Vegetales Importados En Tres Puertos Marítimos De Colombia
Identificación de ácaros interceptados en plantas y productos vegetales importados en tres puertos marítimos de Colombia. Julián Camilo Reyes Bello Universidad Nacional de Colombia sede Palmira Facultad de Ciencias Agropecuarias Palmira, Colombia 2014 Identificación de ácaros interceptados en plantas y productos vegetales importados en tres puertos marítimos de Colombia. Julián Camilo Reyes Bello Trabajo de tesis para optar al título de Magíster en CIENCIAS AGRARIAS línea de Investigación Protección de Cultivos Director (a): Nora Cristina Mesa Cobo. Ph.D. Codirectores: Mario Augusto García. Ph.D. Línea de Investigación: Protección de Cultivos Universidad Nacional de Colombia sede Palmira Facultad de Ciencias Agropecuarias Palmira, Colombia 2014 A Dios, mi esposa y mi hija por su amor y paciencia en este proyecto. A mis padres por sus enseñanzas y fortaleza. A mi familia Reyes-Bello. 3 Agradecimientos A mis Directores por sus aportes técnicos, científicos y valiosos consejos de formación. Al Instituto Colombiano Agropecuario y sus funcionarios de la Subgerencia de Protección Fronteriza de los diferentes puertos marítimos por su valiosa disposición y colaboración a este proyecto. A los Ingenieros, Francisco Molineros, Ivan Zapata, Hernán Manjarrez y Manuel Mejia, gracias por sus valiosos esfuerzos y aportes a este documento. A mis jefes Wilkien Ramírez y Rafael San Miguel por sus valiosas apreciaciones. A la Doctora Adriana Castañeda y los profesionales de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico por sus resultados de Diagnostico que contribuyen sustancialmente al resultado de esta investigación, especialmente a la Dr. Alexandra Sierra. Al grupo de Acarología de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira por su constante apoyo. A mis colegas y amigos del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal por su voluntad y apoyo constante. -

5 Biology, Behavior, and Ecology of Pests in Other Durable Commodities
5 Biology, Behavior, and Ecology of Pests in Other Durable Commodities Peter A. Edde Marc Eaton Stephen A. Kells Thomas W. Phillips Introduction biology, behavior, and ecology of the common insect pests of stored durable commodities. Physical ele- Other durable commodities of economic importance ments defined by the type of storage structure, insect besides dry grains include tobacco, spices, mush- fauna, and interrelationships in the storage environ- rooms, seeds, dried plants, horticultural and agro- ment are also discussed. nomic seeds, decorative dried plants, birdseed, dry pet foods, and animal products such as dried meat and fish, fishmeal, horns, and hooves. Similar to dry Life Histories grains, these commodities are typically maintained and Behavior at such low moisture levels that preserving quality by minimizing insect damage can be a significant chal- lenge. Stored commodities may become infested at the processing plant or warehouse, in transit, at the store, or at home. Many arthropod pests of stored commodities are relatively abundant outdoors, but natural host plants before preadaptation to stored products remain unknown. Capable of long flight, they migrate into unprotected warehouses. Adults (larvae) crawl through seams and folds or chew into sealed packages and multiply, diminishing product quality and quantity. Infestations may spread within a manufacturing facility through electrical conduit Figure 1. Adult of the cigarette beetle, Lasioderma serricorne and control panels. (F.), 2 to 4 mm long (from Bousquet 1990). The type of pest observed on a stored product Cigarette Beetle Lasioderma depends on the commodity, but some insects vary widely in their food preferences and may infest a Serricorne (F.) wide range of commodities. -
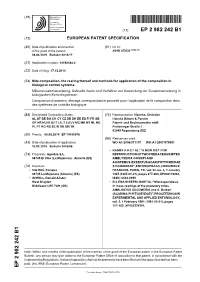
Mite Composition, the Rearing Thereof and Methods for Application of the Composition in Biological Control Systems
(19) TZZ _T (11) EP 2 982 242 B1 (12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION (45) Date of publication and mention (51) Int Cl.: of the grant of the patent: A01K 67/033 (2006.01) 24.04.2019 Bulletin 2019/17 (21) Application number: 14198488.0 (22) Date of filing: 17.12.2014 (54) Mite composition, the rearing thereof and methods for application of the composition in biological control systems. Milbenzusammensetzung, Aufzucht davon und Verfahren zur Anwendung der Zusammensetzung in biologischen Kontrollsystemen Composition d’acariens, élevage correspondant et procédé pour l’application de la composition dans des systèmes de contrôle biologique (84) Designated Contracting States: (74) Representative: Hannke, Christian AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB Hannke Bittner & Partner GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO Patent- und Rechtsanwälte mbB PL PT RO RS SE SI SK SM TR Prüfeninger Straße 1 93049 Regensburg (DE) (30) Priority: 06.08.2014 EP 14180076 (56) References cited: (43) Date of publication of application: WO-A1-2006/071107 WO-A1-2007/075081 10.02.2016 Bulletin 2016/06 • RASMY A H ET AL: "A NEW DIET FOR (73) Proprietor: Agrobio S.L. REPRODUCTION OF TWO PREDACEOUS MITES 04745 El Viso (La Mojonera) - Almeria (ES) AMBLYSEIUS-GOSSIPI AND AGISTEMUS-EXSERTUS ACARI PHYTOSEIIDAE (72) Inventors: STIGMAEIDAE", ENTOMOPHAGA,LIBRAIRIE LE • Vila Rifá, Enrique FRANCOIS, PARIS, FR, vol. 32, no. 3, 1 January 04745 La Mojonera (Almeria) (ES) 1987 (1987-01-01), pages 277-280, XP008118963, • Griffiths, Donald Alister ISSN: 0013-8959 West Drayton • ELLENA. -

Duc Tung Nguyen Artificial and Factitious Foods for the Production
es y mit en or t tion and eda oduc ung Nguy T oseiid pr Duc or the pr yt oods f t of ph emen titious f tion enhanc tificial and fac Ar popula Artificial and factitious foods for the production and Duc Tung Nguyen population enhancement of phytoseiid predatory mites 2015 ISBN 978-90-5989-764-9 To my family Promoter: Prof. dr. ir. Patrick De Clercq Department of Crop Protection, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium Chair of the examination committee: Prof. dr. ir. Geert Haesaert Department of Applied Biosciences Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium Members of the examination committee: Prof. dr. Gilbert Van Stappen Department of Animal Production Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium Prof. dr. ir. Luc Tirry Department of Crop Protection, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium Prof. dr. ir. Stefaan De Smet Department of Animal Production Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium Prof. dr. Felix Wäckers Lancaster Environment Centre University of Lancaster, United Kingdom Prof. dr. Nguyen Van Dinh Department of Entomology Faculty of Agronomy Vietnam National University of Agriculture, Vietnam Dean: Prof. dr. ir. Guido Van Huylenbroeck Rector: Prof. dr. Anne De Paepe Artificial and factitious foods for the production and population enhancement of phytoseiid predatory mites by Duc Tung Nguyen Thesis submitted in the fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor (PhD) in Applied Biological Sciences Dutch translation: Artificiële en onnatuurlijke voedselbronnen voor de productie en de populatie-ondersteuning van roofmijten uit de familie Phytoseiidae Please refer to this work as follows: Nguyen, D.T. -

Milben Als Hausungeziefer U. Vorratsschädlinge in Nordwestdeutschland 249-267 ©Zoologisches Museum Hamburg
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg Jahr/Year: 1965 Band/Volume: 3 Autor(en)/Author(s): Rack Gisela Artikel/Article: Milben als Hausungeziefer u. Vorratsschädlinge in Nordwestdeutschland 249-267 ©Zoologisches Museum Hamburg, www.zobodat.at ENTOMOLOGI SCHE MITTEILUNGEN aus dem Zoologischen Staatsinstitut u. Zoologischen Museum Hamburg Herausgeber: Professor Dr. Herbert Weidner 3. Band Hamburg Nr. 62 Ausgegeben am 15. November 1968 Milben als Hausungeziefer u. Vorratsschädlinge in Nordwestdeutschland VonG isela R ack , Hamburg*) In den vergangenen zehn Jahren konnten in Nordwestdeutschland, ins besondere Hamburg, aber auch an anderen Stellen Deutschlands eine Anzahl haus- und vorratsschädlicher Milben und solche, die in Labora torien schädlich wurden, festgestellt werden. Es sind etliche Milben dar unter, die bisher in Deutschland noch nicht beobachtet worden sind. Sie stammen meist aus dem Hamburger Hafen, der durch die Aufnahme ver schiedenster Importgüter für die Einschleppung fremder Milbenarten ver ständlicherweise eine wichtige Rolle spielt. Es sind keine gezielten Untersuchungen von Häusern, Lagerhallen, Lebensmittelfirmen etc. durchgeführt beziehungsweise regelmäßig Proben entnommen worden, wie es zum Beispiel in vorbildlicher Weise in der Tschechoslowakei(Z därkovä 1967) geschah, sondern es wurde lediglich registriert, was der Verfasserin zur Determination und Begutachtung zugeschickt oder gebracht worden ist. Die Artenzahl würde sich wesent lich erhöhen und vor allem die Kenntnisse über das Auftreten und Ver halten von haus- und vorratsschädlichen Milben könnten erheblich ver mehrt werden — was dringend notwendig ist —, würden die aus Wohnun gen stammenden Milben und die Proben vermilbter Vorräte immer an die richtige Stelle zur Determination verschickt oder weitergeleitet werden. -
Acari, Laelapidae) from Iran 17 Doi: 10.3897/Zookeys.208.3281 Research Article Launched to Accelerate Biodiversity Research
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 208: 17–25A new (2012) species and new records of Laelaspis Berlese (Acari, Laelapidae) from Iran 17 doi: 10.3897/zookeys.208.3281 RESEARCH ARTICLE www.zookeys.org Launched to accelerate biodiversity research A new species and new records of Laelaspis Berlese (Acari, Laelapidae) from Iran Omid Joharchi1,†, Mahdi Jalaeian2,‡, Saeed Paktinat-Saeej3,§, Azadeh Ghafarian4,| 1 Department of Plant Protection, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran 2 Agriculture & Natural Re- sources Research Center of Khorasan Razavi Province, Plant Protection Department, Mashhad, Iran 3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran 4 Department of Entomology, Collage of Agriculture, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran † urn:lsid:zoobank.org:author:7085421B-EBD9-430F-AC1B-A520DC4F38DC ‡ urn:lsid:zoobank.org:author:78D97837-6130-46C1-B1EB-3DD17CF098E4 § urn:lsid:zoobank.org:author:F82EC1F7-249B-449A-962D-CF280F673DD2 | urn:lsid:zoobank.org:author:6EB94491-13EE-4326-8E9A-9299E472DBA3 Corresponding author: Omid Joharchi ([email protected]) Academic editor: Andre Bochkov | Received 24 April 2012 | Accepted 9 July 2012 | Published 17 July 2012 urn:lsid:zoobank.org:pub:0F0A8627-2D99-4B2C-8DF0-F23F429F0D9F Citation: Joharchi O, Jalaeian M, Paktinat-Saeej S, Ghafarian A (2012) A new species and new records of Laelaspis Berlese (Acari, Laelapidae) from Iran. ZooKeys 208: 17–25. doi: 10.3897/zookeys.208.3281 Abstract This paper reports on three species of mites of the genus Laelaspis in Iran – Laelaspis calidus Berlese from Pheidole pallidula, L. humeratus (Berlese) from Tetramorium caespitum and L. dariusi Joharchi & Jalaeian, sp. n. from soil. -

Depo Gıdalarını Ve Peynirleri Enfeste Eden Akarlara Halk Sağlığı Açısından Bakış
Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (3): 191199, 2010 Türkiye Parazitol Derg. © Türkiye Parazitoloji Derneği © Turkish Society for Parasitology Depo Gıdalarını ve Peynirleri Enfeste Eden Akarlara Halk Sağlığı Açısından Bakış Sibel CEVİZCİ1, Seher GÖKÇE1, Kamil BOSTAN2, Ayşe KAYPMAZ1 İstanbul Üniversitesi 1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye ÖZET: Akarlar, bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlığını da olumsuz etkileyen, yaşam kalitesini azaltan atopik dermatit, aler‐ jik rinit ve astım gibi çok sayıda alerjen kaynaklı rahatsızlıklara neden olabilen mikro canlılardır. İnsanların yaşadığı her yerde bulunabilen akarlara çeşitli gıda maddelerinde de rastlanmaktadır. Bu derlemenin amacı depo gıdalarında, özellikle peynirlerde bulunabilen akar çeşitlerini incelemek ve neden olabilecekleri olası rahatsızlıkları halk sağlığı açısından değerlendirmektir. Bazı yöresel peynir çeşitlerinin dışında depo gıda maddelerinde akar bulunması, sağlık açısından getirebileceği risklerden dolayı arzu edilmemektedir. Bununla birlikte peynirlerde, özellikle açıkta olgunlaştırılan peynirlerde akar enfestasyonu her zaman söz ko‐ nusu olabilmektedir. Özellikle gıda güvenliği açısından gereken önlemlerin yeterince alınmadığı işletmelerde bu risk çok daha fazladır. Peynirlerle ilgili oluşturulan standartlarda akar yönünden bir kısıtlama getirilmediği gibi kalite güvence sistemlerinde akarlarla mücadele genellikle göz ardı edilmektedir. Oysaki her yaşta birey tarafından -

Erarbeitung Von Richtlinien Für Die Integrierte Schädlingsbekämpfung 1
_______________________________________________________________________________ UMWELTFORSCHUNGSPLAN DES BUNDESMINISTERS FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT - Umweltgerechte(r) Schädlingsbekämpfung und Pflanzenschutz - Forschungsbericht 126 06 011 UBA I 4. 7 Erarbeitung von Richtlinien für die integrierte Schädlingsbekämpfung im nichtagrarischen Bereich (außer Holzschädlinge) von Eva Scholl Weltersbach Juli 1995 Im Auftrag des Umweltbundesamtes _______________________________________________________________________________ Waldstr. 2a, 66879 Steinwenden Tel. / Fax 06371 / 51244 II III Inhalt Einführung; der historische Hintergrund .................................................................................. IX Der historische Hintergrund, IX; An den Leser, XI 1. Bestandsaufnahme............................................................................................................................1 1.1. Zustandsbeschreibung ........................................................................................................... 1 Natur - Schädlinge - Schaden - Nutzen, 1; Geschädigte , 2; Retter , 3. 1.2. Aktionskreise - Knotenpunkte; Zustand, Diskussion ........................................................ 4 Verbraucher, 4; Schädlingsbekämpfer, 6; Methoden & Mittel, 11; Stoffe und Energie - Streß, 11; Resistenz / Repellenz, 14; Industrie, 15; Werbung, 16; Kostenrechnung für die Allgemeinheit, 17; Forschung, Lehre, 18; Gesetzgeber, 20; Zuständigkeiten, 21; Umweltorganisationen, 21; Informationsmanagement, 23; Ausblick, -
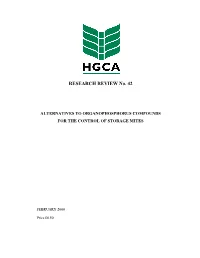
RESEARCH REVIEW No. 42
RESEARCH REVIEW No. 42 ALTERNATIVES TO ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS FOR THE CONTROL OF STORAGE MITES FEBRUARY 2000 Price £6.50 RESEARCH REVIEW No. 42 ALTERNATIVES TO ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS FOR THE CONTROL OF STORAGE MITES by D A COLLINS Central Science Laboratory, Sand Hutton, York YO4 1LZ This review was funded by HGCA as part of a research project on the alternatives to organo-phosphorus compounds for the control of storage mites. The work started in October 1998 and lasts in total for 42 months. The total grant (£174,534) covers ongoing research as well as this review (Project no. 2084). The Home-Grown Cereals Authority (HGCA) has provided funding for this project but has not conducted the research or written this report. While the authors have worked on the best information available to them, neither HGCA nor the authors shall in any event be liable for any loss, damage or injury howsoever suffered directly or indirectly in relation to the report or the research on which it is based. Reference herein to trade names and proprietary products without stating that they are protected does not imply that they may be regarded as unprotected and thus free for general use. No endorsement of named products is intended nor is any criticism implied of other alternative, but unnamed products. CONTENTS Page 1. Introduction 1 2. Insect Growth Regulators (IGRs) 3 2.1 Juvenile Hormone Analogues (JHAs) 4 2.2 Moulting hormone (ecdysone) analogues 6 2.3 Chitin synthesis inhibitors 6 3. Inert Dusts 8 4. Botanicals 11 4.1 Azadirachtin (Neem) 11 4.2 Other plant derived products 13 5. -

Catalog and Bibliography of the Acari of the New Zealand Subregion!
Pacific Insects Monograph 25: 179-226 20 March 1971 CATALOG AND BIBLIOGRAPHY OF THE ACARI OF THE NEW ZEALAND SUBREGION! By A.V. Spain2 and M. Luxton3 One of the main problems encountered in studying the mites, or Acari, of New Zealand is the scattered nature of the literature on the group, much of that on taxonomy occurring in a wide range of European publications. This paper gives the species known from the New Zealand Subregion, together with an extensive bibliography covering all aspects of their study. It expands and updates the earlier works of Lamb (1952) and Dumbleton (1962) but does not include species recorded only as quarantine interceptions. This information is available from Manson (1967) and Manson & Ward (1968). Acarology is now a vigorous science as demonstrated by the growing number of publica tions reflecting acarological interests as diverse as public health, marine zoology and agriculture. Interest in taxonomic acarology is expanding, new synonymies being regularly reported in systematic papers. No attempt is made here to establish new combinations for the New Zealand Acari, even where this appeared necessary, but those already reported in the literature have been included to avoid confusion. Detailed notes on synonymy have not been added to the list except in certain instances (e.g. the species of the genus Halozetes: Cryptostigmata) where confusion has been especially great. Over the past few years intensive collecting by staff of the B. P. Bishop Museum of Hawaii, and by members of the various Antarctic expeditions, has produced many new species of Acari from New Zealand's subantarctic islands. -

SYNTHESIS and PHYLOGENETIC COMPARATIVE ANALYSES of the CAUSES and CONSEQUENCES of KARYOTYPE EVOLUTION in ARTHROPODS by HEATH B
SYNTHESIS AND PHYLOGENETIC COMPARATIVE ANALYSES OF THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF KARYOTYPE EVOLUTION IN ARTHROPODS by HEATH BLACKMON Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON May 2015 Copyright © by Heath Blackmon 2015 All Rights Reserved ii Acknowledgements I owe a great debt of gratitude to my advisor professor Jeffery Demuth. The example that he has set has shaped the type of scientist that I strive to be. Jeff has given me tremendous intelectual freedom to develop my own research interests and has been a source of sage advice both scientific and personal. I also appreciate the guidance, insight, and encouragement of professors Esther Betrán, Paul Chippindale, John Fondon, and Matthew Fujita. I have been fortunate to have an extended group of collaborators including professors Doris Bachtrog, Nate Hardy, Mark Kirkpatrick, Laura Ross, and members of the Tree of Sex Consortium who have provided opportunities and encouragement over the last five years. Three chapters of this dissertation were the result of collaborative work. My collaborators on Chapter 1 were Laura Ross and Doris Bachtrog; both were involved in data collection and writing. My collaborators for Chapters 4 and 5 were Laura Ross (data collection, analysis, and writing) and Nate Hardy (tree inference and writing). I am also grateful for the group of graduate students that have helped me in this phase of my education. I was fortunate to share an office for four years with Eric Watson.