Khodadad Rezakhani: Reorienting the Sasanians
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

09-Khodadad-Rezakhani-02.Pdf
Samuel Jordan Center for Persian Studies and Culture www.dabirjournal.org Digital Archive of Brief notes & Iran Review ISSN: 2470-4040 Vol.01 No.03.2017 1 xšnaoθrahe ahurahe mazdå Detail from above the entrance of Tehran’s fire temple, 1286š/1917–18. Photo by © Shervin Farridnejad The Digital Archive of Brief notes & Iran Review (DABIR) ISSN: 2470-4040 www.dabirjournal.org Samuel Jordan Center for Persian Studies and Culture University of California, Irvine 1st Floor Humanities Gateway Irvine, CA 92697-3370 Editor-in-Chief Touraj Daryaee (University of California, Irvine) Editors Parsa Daneshmand (Oxford University) Arash Zeini (Freie Universität Berlin) Shervin Farridnejad (Freie Universität Berlin) Book Review Editor Shervin Farridnejad (Freie Universität Berlin) Editorial Assistants Ani Honarchian (UCLA) Sara Mashayekh (UCI) Advisory Board Samra Azarnouche (École pratique des hautes études); Dominic P. Brookshaw (Oxford University); Matthew Canepa (University of Minnesota); Ashk Dahlén (Uppsala University) Peyvand Firouzeh (Cambridge University); Leonardo Gregoratti (Durham University); Frantz Grenet (Collège de France); Wouter F.M. Henkelman (École Pratique des Hautes Études); Rasoul Jafarian (Tehran University); Nasir al-Ka‘abi (University of Kufa); Andromache Karanika (UC Irvine); Agnes Korn (Goethe Universität Frankfurt am Main); Lloyd Llewellyn-Jones (University of Edinburgh); Jason Mokhtarain (University of Indiana); Ali Mousavi (UC Irvine); Mahmoud Omidsalar (CSU Los Angeles); Antonio Panaino (University of Bologna); Alka Patel (UC Irvine); Richard Payne (University of Chicago); Khoda- dad Rezakhani (Princeton University); Vesta Sarkhosh Curtis (British Museum); M. Rahim Shayegan (UCLA); Rolf Strootman (Utrecht University); Giusto Traina (University of Paris-Sorbonne); Mohsen Zakeri (University of Göttingen) Logo design by Charles Li Layout and typesetting by Kourosh Beighpour Contents Notes 1. -

Animal Headdresses on the Sealings of the Bactrian Documents
Animal Headdresses on the Sealings of the Bactrian Documents Judith A. Lerner, New York Introduction The so-called Bactrian documents from northern Afghanistan, consisting of le- gal and economic texts as well as letters, have contributed to our greater under- standing of the region between the 4th and 8th centuries. As a crossroads for trade and a theater for conquest, during this time span the region had come under the successive domination by Kushano-Sasanians, Kidarites, Hephtalites and Turks. Nicholas Sims-Williams first reported on the Bactrian documents in 1996 and since then, as the number of documents has grown, has continued to enlighten us on their contents and implications, thereby expanding our knowledge of the language, history, religion and culture of Afghanistan in this period. Some of the documents still have their original sealings: small lumps of clay that bear the impressions of the contractors’, witnesses’ and letter-writers’ seals. The majority of the sealings, however, are not associated with the documents they originally sealed. While more than 150 Bactrian documents are now known, there are many more clay sealings in various collections, unfortunately separated from what they sealed, but which – from their shape and fabric and the style and iconography of the seals impressed on them – can be considered part of this cor- pus. As an art historian, I have been privileged to study the sealings in two major collections, those of Prof. N. D. Khalili (London) and Mr. Aman ur Rahman (Islamabad/Dubai), and in this endeavor to work closely with Nicholas Sims- Williams who has published the documents in the Khalili Collection and will be publishing the inscriptions on the sealings in the Rahman Collection.1 His linguistic knowledge and insights, and his generosity in sharing them, have been critical to my stylistic and iconographic analysis of the sealings. -

2015, Vol. 1, No. 1
2015, Vol. 1, No. 1 ©2015 Jordan Center for Persian Studies DABIR 2015 1(1) University of California, Irvine http://www.dabirjournal.org/ www.dabirjournal.org Editor-in-Chief Touraj Daryaee Samuel Jordan Center for Persian Studies and Culture University of California, Irvine 1st Floor Humanities Gateway Irvine, CA 92697-3370 e-mail: [email protected] Editors Parsa Daneshmand (Oxford University) Arash Zeini (Independent scholar) Book Review Editor Shervin Farridnejad (Freie Universität Berlin) Editorial Assistants Ani Honarchian (UCLA) Sara Mashayekh (UCI) Advisory Board Samra Azarnouche (École pratique des hautes études) Dominic P. Brookshaw (Oxford University) Matthew Canepa (University of Minnesota) Ashk Dahlén (Uppsala University) Peyvand Firouzeh (Cambridge University) Leonardo Gregoratti (Durham University) Frantz Grenet (Collège de France) Wouter F.M. Henkelman (École Pratique des Hautes Études) Rasoul Jafarian (Tehran University) Nasir al-Ka‘abi (University of Kufa) Andromache Karanika (UC Irvine) Agnes Korn (Goethe Universität Frankfurt am Main) Lloyd Llewellyn-Jones (University of Edinburgh) Jason Mokhtarain (University of Indiana) Ali Mousavi (UC Irvine) Mahmoud Omidsalar (CSU Los Angeles) Antonio Panaino (University of Bologna) Alka Patel (UC Irvine) Richard Payne (University of Chicago) Khodadad Rezakhani (Freie Universität Berlin) Vesta Sarkhosh Curtis (British Museum) M. Rahim Shayegan (UCLA) Rolf Strootman (Utrecht University) Giusto Traina (University of Paris-Sorbonne) Mohsen Zakeri (University of Göttingen) Logo design by Charles Li Layout and typesetting by Arash Zeini i xšnaoθrahe ahurahe mazdå Detail from above the entrance of Tehran’s fire temple, 1286š/1917–18. Photo by © Shervin Farridnejad ii Contents I Articles 1 1 A re-examination of two terms in the Elamite version of the Behistun inscription Saber Amiri Pariyan ............................................. -

Ammianus Marcellinus and the Kidarites 44 7
Samuel Jordan Center for Persian Studies and Culture www.dabirjournal.org Digital Archive of Brief notes & Iran Review ISSN: 2470-4040 Vol.01 No.03.2017 1 xšnaoθrahe ahurahe mazdå Detail from above the entrance of Tehran’s fire temple, 1286š/1917–18. Photo by © Shervin Farridnejad The Digital Archive of Brief notes & Iran Review (DABIR) ISSN: 2470-4040 www.dabirjournal.org Samuel Jordan Center for Persian Studies and Culture University of California, Irvine 1st Floor Humanities Gateway Irvine, CA 92697-3370 Editor-in-Chief Touraj Daryaee (University of California, Irvine) Editors Parsa Daneshmand (Oxford University) Arash Zeini (Freie Universität Berlin) Shervin Farridnejad (Freie Universität Berlin) Book Review Editor Shervin Farridnejad (Freie Universität Berlin) Editorial Assistants Ani Honarchian (UCLA) Sara Mashayekh (UCI) Advisory Board Samra Azarnouche (École pratique des hautes études); Dominic P. Brookshaw (Oxford University); Matthew Canepa (University of Minnesota); Ashk Dahlén (Uppsala University) Peyvand Firouzeh (Cambridge University); Leonardo Gregoratti (Durham University); Frantz Grenet (Collège de France); Wouter F.M. Henkelman (École Pratique des Hautes Études); Rasoul Jafarian (Tehran University); Nasir al-Ka‘abi (University of Kufa); Andromache Karanika (UC Irvine); Agnes Korn (Goethe Universität Frankfurt am Main); Lloyd Llewellyn-Jones (University of Edinburgh); Jason Mokhtarain (University of Indiana); Ali Mousavi (UC Irvine); Mahmoud Omidsalar (CSU Los Angeles); Antonio Panaino (University of Bologna); Alka Patel (UC Irvine); Richard Payne (University of Chicago); Khoda- dad Rezakhani (Princeton University); Vesta Sarkhosh Curtis (British Museum); M. Rahim Shayegan (UCLA); Rolf Strootman (Utrecht University); Giusto Traina (University of Paris-Sorbonne); Mohsen Zakeri (University of Göttingen) Logo design by Charles Li Layout and typesetting by Kourosh Beighpour Contents Notes 1. -

The Israel-Egypt Peace Treaty
Volume 7 - Number 8 April - May 2011 £4 | €5 | US$6.5 THIS ISSUE » THE ISRAEL-EGYPT PEACE TREATY – DOOMED TO FAILURE? » THE GCC STATES » THE GULF AND ITS INDIAN ENTANGLEMENTS » WOMEN’S SUFFRAGE IN KUWAIT » THE DRIVE TO DIVERSIFY GULF ECONOMIES » A HISTORY OF SAUDI ARABIA IN TEXTILES » MANHATTAN COMES TO MAKKAH » ARABIAN STUDIES IN BRITAIN » PLUS » REVIEWS AND EVENTS IN LONDON ‘Deraa’ (inner dress), Central Region, Bani Tamim Tribe, 2009 © Art of Heritage (see page 14) About the London Middle East Institute (LMEI) Volume 7 - Number 8 April-May 2011 Th e London Middle East Institute (LMEI) draws upon the resources of London and SOAS to provide teaching, training, research, publication, consultancy, outreach and other services related to the Middle Editorial Board East. It serves as a neutral forum for Middle East studies broadly defi ned and helps to create links between Nadje Al-Ali individuals and institutions with academic, commercial, diplomatic, media or other specialisations. SOAS With its own professional staff of Middle East experts, the LMEI is further strengthened by its academic Narguess Farzad SOAS membership – the largest concentration of Middle East expertise in any institution in Europe. Th e LMEI also Nevsal Hughes has access to the SOAS Library, which houses over 150,000 volumes dealing with all aspects of the Middle Association of European Journalists East. LMEI’s Advisory Council is the driving force behind the Institute’s fundraising programme, for which Najm Jarrah it takes primary responsibility. It seeks support for the LMEI generally and for specifi c components of its George Joff é programme of activities. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA, IRVINE Narrative and Iranian
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE Narrative and Iranian Identity in the New Persian Renaissance and the Later Perso-Islamicate World DISSERTATION submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in History by Conrad Justin Harter Dissertation Committee: Professor Touraj Daryaee, Chair Professor Mark Andrew LeVine Professor Emeritus James Buchanan Given 2016 © 2016 Conrad Justin Harter DEDICATION To my friends and family, and most importantly, my wife Pamela ii TABLE OF CONTENTS Page LIST OF FIGURES iv ACKNOWLEDGMENTS v CURRICULUM VITAE vi ABSTRACT OF THE DISSERTATION vii CHAPTER 1: INTRODUCTION 1 CHAPTER 2: Persian Histories in the 9th-12th Centuries CE 47 CHAPTER 3: Universal History, Geography, and Literature 100 CHAPTER 4: Ideological Aims and Regime Legitimation 145 CHAPTER 5: Use of Shahnama Throughout Time and Space 192 BIBLIOGRAPHY 240 iii LIST OF FIGURES Page Figure 1 Map of Central Asia 5 iv ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my gratitude to all of the people who have made this possible, to those who have provided guidance both academic and personal, and to all those who have mentored me thus far in so many different ways. I would like to thank my advisor and dissertation chair, Professor Touraj Daryaee, for providing me with not only a place to study the Shahnama and Persianate culture and history at UC Irvine, but also with invaluable guidance while I was there. I would like to thank my other committee members, Professor Mark LeVine and Professor Emeritus James Given, for willing to sit on my committee and to read an entire dissertation focused on the history and literature of medieval Iran and Central Asia, even though their own interests and decades of academic research lay elsewhere. -
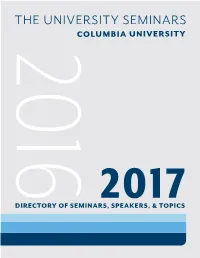
20162017 Directory of Seminars, Speakers, & Topics Table of Contents
THE UNIVERSITY SEMINARS COLUMBIA UNIVERSITY 2016 2016 2017 CONFERENCES 2017 DIRECTORY OF SEMINARS, SPEAKERS, & TOPICS Columbia University | THE UNIVERSITY SEMINARS 20162017 DIRECTORY OF SEMINARS, SPEAKERS, & TOPICS TABLE OF CONTENTS Contacts 4 Introduction 5 History of the University Seminars 6 Annual Report 8 Leonard Hastings Schoff Memorial Lectures Series 10 Schoff Publication Fund 12 Annual Dinner, Tannenbaum-Warner Award, & Tannenbaum Lecture 14 2016–2017 Seminar Conferences 19 2016–2017 Seminar Meetings 39 Index of Seminars 128 ADVISORY BOARD INTRODUCTION Robert E. Remez, Chair Professor of Psychology, Barnard College George Andreopoulos Professor, Political Science and Criminal Justice, City University of New York The University Seminars are groups of professors and other experts, from Columbia and elsewhere, who gather once a month to work together on problems that cross the boundaries between university departments. Susan Boynton Professor of Music, Columbia University Each seminar elects its own officers, plans its own program, and selects its own membership: members from Columbia, Jennifer Crewe associate members from elsewhere, and any speakers or other guests it invites to its sessions. Approximately half of the Associate Provost and Director, Columbia University Press seminars admit selected graduate students as guests. Seminar participants and speakers attend by invitation and neither pay nor are paid, although a central office supports travel and hotel expenses for speakers when its endowment income Kenneth T. Jackson permits. Jacques Barzun Professor of History and the Social Sciences, Columbia University Some seminars are tight, restricted discussion groups that specialize in particular subfields; others are broad-based David Johnston leture series where eminent visitors disseminate the latest knowledge. -

Long Distance Trade and the Parthian Empire: Reclaiming Parthian Agency from an Orientalist Historiography
Western Washington University Western CEDAR WWU Graduate School Collection WWU Graduate and Undergraduate Scholarship Spring 2018 Long Distance Trade and the Parthian Empire: Reclaiming Parthian Agency from an Orientalist Historiography Evan J. (Evan Jeffery) Jones Western Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cedar.wwu.edu/wwuet Part of the History Commons Recommended Citation Jones, Evan J. (Evan Jeffery), "Long Distance Trade and the Parthian Empire: Reclaiming Parthian Agency from an Orientalist Historiography" (2018). WWU Graduate School Collection. 692. https://cedar.wwu.edu/wwuet/692 This Masters Thesis is brought to you for free and open access by the WWU Graduate and Undergraduate Scholarship at Western CEDAR. It has been accepted for inclusion in WWU Graduate School Collection by an authorized administrator of Western CEDAR. For more information, please contact [email protected]. Long Distance Trade and the Parthian Empire: Reclaiming Parthian Agency from an Orientalist Historiography By Evan Jones Accepted in Partial Completion of the Requirements for the Degree Master of Arts in History ADVISORY COMMITTEE Dr. Steven Garfinkle, Chair Dr. Roger Thompson Dr. Tristan Goldman GRADUATE SCHOOL Dr. Gautam Pillay, Dean Master’s Thesis In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for a master’s degree at Western Washington University, I grant to Western Washington University the non-exclusive royalty-free right to archive, reproduce, distribute, and display the thesis in any and all forms, including electronic format, via any digital library mechanisms maintained by WWU. I represent and warrant this is my original work and does not infringe or violate any rights of others. -

Long Distance Trade and the Parthian Empire: Reclaiming Parthian Agency from an Orientalist Historiography Evan J
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Western Washington University Western Washington University Western CEDAR WWU Graduate School Collection WWU Graduate and Undergraduate Scholarship Spring 2018 Long Distance Trade and the Parthian Empire: Reclaiming Parthian Agency from an Orientalist Historiography Evan J. (Evan Jeffery) Jones Western Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cedar.wwu.edu/wwuet Part of the History Commons Recommended Citation Jones, Evan J. (Evan Jeffery), "Long Distance Trade and the Parthian Empire: Reclaiming Parthian Agency from an Orientalist Historiography" (2018). WWU Graduate School Collection. 692. https://cedar.wwu.edu/wwuet/692 This Masters Thesis is brought to you for free and open access by the WWU Graduate and Undergraduate Scholarship at Western CEDAR. It has been accepted for inclusion in WWU Graduate School Collection by an authorized administrator of Western CEDAR. For more information, please contact [email protected]. Long Distance Trade and the Parthian Empire: Reclaiming Parthian Agency from an Orientalist Historiography By Evan Jones Accepted in Partial Completion of the Requirements for the Degree Master of Arts in History ADVISORY COMMITTEE Dr. Steven Garfinkle, Chair Dr. Roger Thompson Dr. Tristan Goldman GRADUATE SCHOOL Dr. Gautam Pillay, Dean Master’s Thesis In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for a master’s degree at Western Washington University, I grant to Western Washington University the non-exclusive royalty-free right to archive, reproduce, distribute, and display the thesis in any and all forms, including electronic format, via any digital library mechanisms maintained by WWU. -

The Silk Road and Trans-Eurasian Exchange
The Road That Never Was: The Silk Road and Trans- Eurasian Exchange Khodadad Rezakhani he Silk Road, or Silk Route, is a name used today to refer to a supposed trade route of ancient Eurasia, its use bringing different images to mind. These are often of camel caravans on dusty roads, forbidding deserts, and exotic towns and “oases.” The con- cept as a whole tends to ignore realities such as geography and ecology, as well as political units, facts that become lost among the more potent romantic notions. While itineraries are presented at some length, actual places are forgotten, and it is supposed that a conventional “beginning” in China and a vague “destination” somewhere along the Mediterranean are enough. On the way, places such as Transoxiana, the Pamirs, Iran, and indeed the whole of the Near East are simply brushed aside and not much discussed. The Silk Road has then be- come a grand narrative that serves mostly to obscure important details and sometimes even more. As one modern historian similarly opposed to the idea of the Silk Road has suggested, “‘The Silk road’ now has become both band wagon and gravy train, with an endless stream of books, journals, conferences and international exhibitions devoted to it, reaching virtual mania proportions that is almost unstoppable.” 1 This is why I am suggesting not only that the concept of a continuous, purpose- driven road or even “routes” is counterproductive in the study of world history but also that it has no basis in historical reality or records. Doing away with the whole concept of the “Silk Road” of might do us, at least as historians, a world of good and actually let us study what in reality Studies was going on in the region. -

Khalet Al-Jam‟A. a Bronze and Iron Ages Necropolis Near Bethlehem (Palestine): Results of the 2019 Archaeological Excavations
[Vicino Oriente XXIII (2019), pp. 1-22] KHALET AL-JAM‟A. A BRONZE AND IRON AGES NECROPOLIS NEAR BETHLEHEM (PALESTINE): RESULTS OF THE 2019 ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS Lorenzo Nigro - Daria Montanari - Gaia Cecconi - Sapienza University of Rome Mohammed Ghayyada - Jehad Yasine - Ministry of Tourism and Antiquities - Department of Archaeology and Cultural Heritage In Spring 2019 the Italian-Palestinian joint team of Sapienza University of Rome and the Ministry of Tourism and Antiquities of Palestine Dept. of Archaeology and Cultural Heritage resumed rescue excavations at the Necropolis of Khalet al-Jam’a, 2.2 Km south-east from the Church of Nativity in Bethlehem. Works were focused on Tomb A7, identified in 2015, a huge underground burial place, dating back to the Iron IIC (8th-7th century BC), but also including earlier depositions dating from the EB IVB-MB. This suggests that an original EBIV tomb was modified and re-used in the following Middle Bronze and Iron Age. A provisional report of activities and finds is offered below. Keywords: Bethlehem; necropolis; Early Bronze Age IV; Middle Bronze Age; Iron Age II 1. INTRODUCTION In April 2019, the joint team of the Palestinian MOTA-DACH and Sapienza University of Rome1 resumed archaeological activities at the Necropolis of Khalet al-Jam‟a, 2.2 Km south-east from the center of Bethlehem.2 Aim of this season was the excavation of Tomb A7, in the south-western sector of Area A (fig. 1), already recognized and surveyed in 2015, when its entrance was first identified.3 2. TOMB A7 Tomb A7 is quite different from the majority of the tombs in the KJ necropolis. -

Curriculum Vitae
Center for Iran and Persian Gulf Studies Princeton University Khodadad REZAKHANI 2-S-2 Green Hall Princeton, NJ 08544 [email protected] EDUCATION 2010 Department of History, UCLA PhD in Middle Eastern/Near Eastern History 2002: London School of Economics, UK MSc Global History EXPERIENCE Oct. 2020- Dept. Area Studies, Leiden University Research Officer Aug. 2016 – Dec 2020 Princeton University, NJ Associate Research Scholar, Lecturer Aug 2014- Aug 2016: Freie Universität Berlin Alexander von Humboldt Foundation Fellow; Lecturer May 2014-Aug. 2014: Max Planck Institute for the History of Science, Berlin Research Fellow, Dept. I 2013 – 2014: Dept. History, University of Nevada, Reno Visiting Assistant Professor of History 2012-2013: SOAS, University of London Senior Teaching Fellow 2011-2013: Aga Khan University, London, UK Adjunct Lecturer 2010-2013: London School of Economics, UK Research Officer, Central and West Asia in the Project URKEW (European Research Council funded) LANGUAGES Modern Persian: Native English: Fluent/Native German: Advanced Arabic, French, Russian: intermediate/research Ancient Rezakhani – Curriculum Vitae Research/Teaching languages: Middle Persian, Bactrian, Syriac. Other Research Languages: Greek, Old Norse PUBLICATIONS Published Books Reorienting the Sasanians: East Iran in Late Antiquity. Edinburgh: Edinburgh University Press 2017. Honourable Mention: E. Yarshater Book Award, 2018. The Anonymous Syriac Chronicle known as ‘the Chronicle of Khuzistan’, Persian Translation and historical marginalia (with Sajad Amiri), Tehran: Sina, 1395/2016. T. Daryaee, K. Rezakhani, From Oxus to Euphrates: Near East in Late Antiquity, Irvine, CA: UCI Jordan Center 2016. (Persian translation: Tehran, Nov. 2018). Forthcoming Books Inventing the Silk Road: Travel, Trade, and Myth-Making, 100-1500 CE.