Carl Gotthard Langhans 1732 - 1808
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
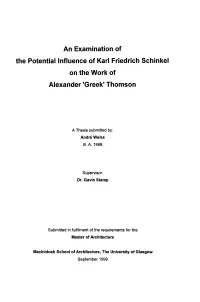
An Examination of the Potential Influence of Karl Friedrich Schinkel on the Work of Alexander 'Greek' Thomson
An Examination of the Potential Influence of Karl Friedrich Schinkel on the Work of Alexander 'Greek' Thomson A Thesis submitted by: Andre Weiss B. A. 1998 Supervisor: Dr. Gavin Stamp Submitted in fulfilment of the requirements for the Master of Architecture Mackintosh School of Architecture, The University of Glasgow September 1999 ProQuest N um ber: 13833922 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 13833922 Published by ProQuest LLC(2019). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 4 8 1 0 6 - 1346 Contents List of Illustrations ...................................................................................................... 3 Introduction .................................................................................................................9 1. The Previous Claims of an InfluentialRelationship ............................................18 2. An Exploration of the Individual Backgrounds of Thomson and Schinkel .............................................................................................................38 -

Schinkel Und Die Industrialisierung Preußens INAUGURAL-DISSERTATION Zur Erlangung Der Doktorwürde Des Fachbereichs Germanistik
Schinkel und die Industrialisierung Preußens INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung der Doktorwürde des Fachbereichs Germanistik und Kunstwissenschaften der Philipps-Universität Marburg vorgelegt von Franz Hermann Kiefer, M.A. aus Spandau Kassel, den 31.08.2004 Aus: Karl Friedrich Schinkel Stich nach einer farbigen Deutsche Bauakademie Kreidezeichnung von Berlin 1952 Franz Krüger 2 Schinkel und die Industrialisierung Preußens Seite Inhaltsverzeichnis 3 Forschungsstand 5 Abkürzungen 9 1 Werdegang Schinkels bis zum Eintritt in die Ober-Bau- 12 Deputation 2 Ökonomisch-technische Erfordernisse aktivieren die 17 Verwaltung 3 Vom Agrarland zum Industriestandort 35 4 Schinkel und Beuth als „bürokratische Stützen“ des 53 wirtschaftlichen Aufschwungs 4.1 Schinkels und Beuths Aufgaben in der „Technischen 69 Deputation für Gewerbe“ 4.1.1 Traktat „Vorbilder für Fabrikanten und 78 Handwerker“ 4.1.2 Vorlegeblätter 85 5 Schinkel und die industrielle Erzeugung von Baumaterialien 91 und ihre Verwendung in Preußen 3 5.1 Verwendung von Schmiede- und Gußeisen im 93 preußischen Bauwesen 5.1.1 Säulen 103 5.1.2 Anker 107 5.1.3 Treppen 110 5.1.4 Dachziegel 115 5.1.5 Fabrik- und Institutsbauten 117 5.1.6 Brückenkonstruktionen 122 5.1.7 Eiserne Dachkonstruktionen 134 5.1.8 Zeltdächer 139 5.2 Schinkel versucht subsidiarisch eine Zinkindustrie 141 zu schaffen 5.3 Das Revival des Backsteins durch Schinkel 156 6 Neue Baukonstruktionen auf tradierten Grundlagen 169 6.1 Bohlendächer - Eine Konstruktion des Übergangs - 170 6.2 Lehmbau als Ausdruck äußerster Ökonomie 181 7 Zusammenfassung 196 8 Anhang 201 8.1 Quellen- und Literaturverzeichnis 201 8.2 Monographien 222 Exkurse: a) Eytelwein und die preußischen Maß- und Gewichtssysteme 223 b) Kirchenbau 230 c) Trennung von Architekt und Ingenieur 231 d) Bauanschläge als Grundlage einer fachgerechten Bauabwicklung 234 8.3 Bildteil 241 4 Forschungsstand Die Überschrift „Schinkel und die Industrialisierung Preußens“, enthält zwei diametrale Begriffe. -

Anmerkungen 12 Dass Es Schwer Falle, »Sich Architekturtheorie Auger• Halb Der Von Vitruv Gestifteten Literatur Zu Ver• Gegenwartigen«, Schreibt G
Anmerkungen 12 Dass es schwer falle, »sich Architekturtheorie auger halb der von Vitruv gestifteten Literatur zu ver gegenwartigen«, schreibt G. Germann in seinem Kapitel uber die Architekturtheorie des Mittelalters. Prolog: Poesie der Baukunst (Georg Germann: Einfuhrung in die Geschichte der Architekturtheorie. 3., durchges. Aufl, Darmstadt 1 Mit guten Grunden ubergeht Georg Germann in 1993, S.30) seiner Einfuhrung in die Geschichte der Architektur 13 Das prominenteste Beispiel durfren die scamilli im theorie deutschsprachige Schriften dieser Epoche pares sein. Buch III, Kapitel 3. Vgl. dazu August und beschliefst seinen Uberblick uber Abbau und Rodes ausfuhrliche Anmerkung im ersten Band sei Ende des Vitruvianismus mit Durand und Semper ner Ubersetzung des Vitruv, S. 135 ff. (Vgl. Georg Germann: Einfuhrung in die Geschichte 14 Vgl. Vitruv 3,1. der Architekturtheorie. 3., durchges. Aufl. Darmstadt 15 Abbi!dung S. 4. 1993, bes. S. 255). - Das Fehlen einer zusammenfas 16 Noch August Wilhelm Schlegel polemisierte gegen senden Darstellung moniert Hanno-Walter Kruft diese Vorstellung: »Ein Baumeister, Namens Sturm, (Vgl. Kruft, S. 331). - Wahrend der Arbeit an die hat gemeynt, die Griechischen Saulenordnungen sem Buch erschien die wertvolle Habi!itationsschrift seyen von Gott unmittelbar geoffenbart, wei! ihre von Klaus Jan Philipp: Um 1800. Architekturtheorie Verhaltnisse so vollkommen, dag es die mensch und Architekturkritik in Deutschland zwischen 1790 lichen Krafte ubersteige sie zu erfinden. Wenn jene und 1810. Stuttgart, London 1997. Sie bietet einen Redensart nichts weiter bedeuten soli als diefs: sie ausgezeichneten Uberblick uber die architektur theo liege in der Natur der Sache, so kann man sic gem retische Literatur der Zeit. In Umfang, Darstel gelten lassen; buchstablich genommen , mufste man lungsverfahren und Ergebnissen grundsatzlich von aber sagen, Gott sey bei dieser seiner Offenbarung diesem Buch unterschieden, zeigt Philipps Arbeit, etwas wankelmurhig gewesen.« (Vorlesungen, S. -

German Nationalism and the Allegorical Female in Karl Friedrich Schinkel's the Hall of Stars
Brigham Young University BYU ScholarsArchive Theses and Dissertations 2012-04-17 German Nationalism and the Allegorical Female in Karl Friedrich Schinkel's The Hall of Stars Allison Slingting Brigham Young University - Provo Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/etd Part of the Art Practice Commons BYU ScholarsArchive Citation Slingting, Allison, "German Nationalism and the Allegorical Female in Karl Friedrich Schinkel's The Hall of Stars" (2012). Theses and Dissertations. 3170. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/3170 This Thesis is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. German Nationalism and the Allegorical Female in Karl Friedrich Schinkel’s The Hall of Stars Allison Sligting Mays A thesis submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Heather Belnap Jensen, Chair Robert B. McFarland Martha Moffitt Peacock Department of Visual Arts Brigham Young University August 2012 Copyright © 2012 Allison Sligting Mays All Rights Reserved ii ABSTRACT German Nationalism and the Allegorical Female in Karl Friedrich Schinkel’s The Hall of Stars Allison Sligting Mays Department of Visual Arts, BYU Master of Arts In this thesis I consider Karl Friedrich Schinkel’s The Hall of Stars in the Palace of the Queen of the Night (1813), a set design of Die Zauberflöte (The Magic Flute), in relation to female audiences during a time of Germanic nationalism. -

Technical Nation Building: German Professional Organisations and Their Journals in the Nineteenth Century
The Journal of Architecture ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/rjar20 Technical nation building: German professional organisations and their journals in the nineteenth century Christiane Weber To cite this article: Christiane Weber (2020) Technical nation building: German professional organisations and their journals in the nineteenth century, The Journal of Architecture, 25:7, 924-947, DOI: 10.1080/13602365.2020.1839120 To link to this article: https://doi.org/10.1080/13602365.2020.1839120 © 2020 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group Published online: 17 Nov 2020. Submit your article to this journal Article views: 257 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rjar20 924 Technical nation building: German professional organisations and their journals in the nineteenth century Christiane Weber Technical nation building: German professional organisations and their journals in the nineteenth century Christiane Weber During the long nineteenth century, the German States saw an exception- ally large number of technical journals published by equally numerous Institut für Architekturtheorie und professional organisations as a means of supporting the scientific inter- Baugeschichte, Universität Innsbruck action among their respective members. As the political fragmentation Austria of the German Federation into thirty-nine states hindered the -

Bibliographie Germanistischer Bibliographien 2011/2012
10.3726/82041_1444 7 Bibliographie germanistischer Bibliographien 2011/2012 Von Volker Michel, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a. M. Hinweis Die vorliegende Folge erfasst (nach Autopsie) bibliographische Überblicke in Zeitschrif- ten sowie Literaturverzeichnisse in Monographien und Sammelbänden zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, die im Zeitraum 1.11.2011 bis 31.10.2012 von der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt / Main) erworben und ausgewertet worden sind. Die Systematik orientiert sich an der Klassifikation der „Biblio- graphie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL)“; Titel können dabei unter mehreren Systemstellen Aufnahme finden. Die ausgegebenen Schlagwörter gestat- ten Rückschlüsse auf das jeweils behandelte Thema / Werk bzw. den behandelten Autor. Sämtliche Titel sind vor Ort zugänglich, per Fernleihe bestellbar sowie online im größeren Kontext über www.bdsl-online.de und www.germanistik-im-netz.de recher- chierbar. Die UB Frankfurt / Main wird als Sondersammelgebietsbibliothek für „Ger- manistik. Deutsche Sprache und Literatur“ von der Deutschen Forschungsgemein- schaft (DFG) gefördert. Unsere fachrelevanten Neuerwerbungen – rückläufig für ein Jahr und jeweils nach Monaten getrennt – sind auch unter www.germanistik-im- netz.de/neuerwerbungen/ubf.html abrufbar. Redaktionsschluss: 31. Oktober 2012. [01.] Allgemeine deutsche Sprach- und hrsg. von Heinz Drügh … Mit Beitr. von Literaturwissenschaft Hans-Heino Ewers … – Stuttgart: Metzler, 2012. [01.01.] Bibliographie Schlagwörter: Germanistik; Lehrbuch 1. Bibliographie germanistischer Bibliogra- Literaturverz. S. 485–491. phien 2010/2011 / Volker Michel. Schlagwörter: Germanistik; Bibliographie [01.07.] Germanistik im Ausland 2010–2011 4. Auswahlbibliographie von Neuerscheinun- In: Jahrbuch für Internationale Germanis- gen für das Fach Deutsch als Fremdsprache tik, (2011), H. 2, S. 165–255. 2010 / Dietrich Eggers; Dorothee Schwarck. 2. Kommentierte Bibliographie. -

Carl Gotthard Langhans' Journey to Italy at the Turn of 1768 and 1769
Quart 2020, 2 PL ISSN 1896-4133 [s. 91-101] Carl Gotthard Langhans’ journey to Italy at the turn of 1768 and 1769 Jerzy Krzysztof Kos University of Wrocław he Italian journey of Carl G. Langhans (1732–1808) was an exceptional undertaking among architects Tactive in Prussia during the reign of Frederick II Hohenzollern (king in 1740–1786). Its route, chronol- ogy, some events, information about the buildings seen and people encountered, can now only be recon- structed in general outlines which however give an idea of the purpose and effects of the journey. The most important preserved archival evidence of Langhans’ Italian journey is his five letters to Prince Franz Philipp Adrian von Hatzfeld (1717–1779), stored in the State Archive in Wrocław1, and several draw- ings held in the Berlin Märkisches Museum2. The only preserved artistic effect of the journey are the ar- chitectural details made in Carrara and two busts decorating the portico of the former Palace of Hatzfelds in Wroclaw3. Langhans’ journey was a project related to the construction of the new Hatzfeld Palace, in the former Albrechtsgasse in Wrocław (Breslau). The founder of the palace, Franz Philipp Adrian von Hatzfeld, be- longed to the Catholic and pro-Habsburg nobility of Prussian Silesia. He received the title of prince from the king of Prussia in 1742, perhaps in accordance with Frederick II’s principle that the uncertain subjects should be gained for the kingdom by flooding them with titles and decorations4. Indeed, no pro-Habsburg declarations by the Prince are known, even though his sympathies with Austria were evidenced both by testimonies from witnesses of the time5, and by the still ongoing personal contacts with Vienna, sustained by his brother Karl Friedrich Anton, Minister of Finance of Empress Maria Theresa6. -

Gilly-Weinbrenner-Schinkel: Baukunst Auf Papier Zwischen Gotik Und
ünf bedeutende Konvolute von Architekturzeichnungen und –reproduktionen aus den Beständen der Göttinger Universitätskunstsammlung und der Niedersächsischen Staats- und Universitäts- bibliothekF Göttingen werden in der Ausstellung „Gilly – Weinbrenner – Schinkel“ erstmals gemeinsam gezeigt. Eine besondere Entdeckung bieten dabei Friedrich Gillys Entwürfe für ein Theater in Stettin: Es sind die frühesten überhaupt bekannten, überdies brillant in Szene gesetzten Zeichnungen des früh verstorbenen Lehrers von Karl Friedrich Schinkel. Weitere Einblicke in die Architektenpraxis um 1800 vermittelt eine Mappe mit Zeichnungen für ein Theater in Königsberg, die vermutlich Carl Ferdinand Langhans nach Entwürfen Gillys angefertigt hat. Von der Mittelalter-Faszination die- ser Zeit zeugt Friedrich Fricks ebenfalls nach Vorlagen Gillys gedruckte Aquatinta-Serie „Schloss Marienburg in Preußen“. Für einen pragmatischen, aber nicht minder bemerkenswerten Umgang mit mittelalterlicher Bausubstanz stehen Friedrich Weinbrenners Entwürfe für den Umbau der Göttinger Paulinerkirche zur Universitätsbibliothek. Und schließlich belegen Karl Friedrich Schin- kels druckgraphisch reproduzierten Entwürfe für einen Königspalast auf der Akropolis in Athen, wie lange man im 19. Jahrhundert an einer schöpferischen Erneuerung des griechischen Altertums arbeitete. Die im Katalog erfassten Zeichnungen und Drucke laden dazu ein, Umbrüche und Leitmotive in der Architekturdarstellung um und nach 1800 nachzuvollziehen. Fünf einleitende Aufsätze eröffnen zusätzliche Forschungsperspektiven. -

UNDER 40S PICASSO HEADLINE
JANUARY/FEBRUARY 2015 JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE ARCHITECTS JANUARY/FEBRUARY UNDER 40s PICASSO HEADLINE 15002 Issue RSA R20.00 (incl VAT) 9 771682 938004 Other countries R17.50 (excl VAT) 71 JAN|FEB 2015 COVER_71_final.indd 1 2015/02/18 10:59 AM _To Check_fcp.indd 1 2014/12/08 8:45 AM PUBLISHERS: Picasso Headline (Pty) Ltd Times Media Building Central Park Black River Park, Fir Street Cover Illustration Observatory, 7925 Heidi van Eeden Tel: +27 21 469 2400 Fax: +27 86 682 2926 EDITORIAL Editor Julian Cooke [email protected] Editorial Advisory Committee Walter Peters, Roger Fisher, Ilze Wolff, Paul Kotze YOUTHFUL MATURITY Content Manager Raina Julies There are three rather interesting differences in this publication of under 40s’ Content Co-ordinator Michéle Jarman work and the previous one of 10 years ago (Architecture SA July/August 2005). The [email protected] first regards authorship. In that previous edition, all the work came from architects who were principals of practices. In this one, there are a number of projects by Copy Editor Vanessa Rogers architects working in someone else’s practice, meaning that established firms are 2015 | JANUARY/FEBRUARY NOTE EDITOR’S openly attributing authorship of some of their output to employees. How much PRODUCTION Head of Design Studio more generous is this recognition than the vigorous covering up of authorship in Jayne Macé-Ferguson the past, when it had not been that of a principal! The practice was unfair to the individual and confusing historically. We know, of course, that the principal owns the Designer Mfundo Ndzo designs coming from his or her office, and is responsible to the client and ultimately to society for them. -

Buildings As Tools That Function and Playthings That Express: Schinkel’S Tectonic Design(S) for Mausoleum of the Queen Luise
Buildings as Tools that Function and Playthings that Express: Schinkel’s Tectonic Design(s) for Mausoleum of the Queen Luise Ana Mernik 48-341 Expression in Architecture Research Paper 9.3.2015 Mernik In 1810, Karl Friedrich Schinkel sketched a Gothic variation on Frederick William III’s Classical design for his late wife’s tomb [Figures 1, photograph and 2, Schinkel’s sketch]. Over the next two years, Schinkel worked with Heinrich Gentz to please Prussia’s king and revitalize its subjects after the death of Queen Luise and defeat by Napoleon four years prior. Although his idea for the interior was never materialized, he did inspire Gentz’s design.1 The two versions were both intended to commemorate the beloved Queen, console the mourning public, and create the feeling of eternal life. However, while their message was the same, their means of communication differed. Every observer can have a unique experience from observing the same form. But is it equally easy for different forms to have the same atmospheric effect, or communicate the same intent across multiple individuals? The question suggests (Figure 1) Classical design of tomb, built (Figure 2) Gothic vision of tomb, idea that meaning is not intrinsic in forms, but rather independent of them - it is attached or added as another layer of the building’s whole. In his essay “Karl Friedrich Schinkel, The Last Great Architect,” Rand Carter posed this same question while observing Schinkel’s National Monument for the Liberation Wars. He suggested that context was the key to distinguishing the expression and meaning of one monument from the next.2 This paper attempts to answer the same question for the 1 Jörg C. -

Day at the Office, Night at the Opera with Karl Friedrich Schinkel Kurt W
study centre mellon lectures 30 March 2006 10 Day at the Office, Night at the Opera with Karl Friedrich Schinkel Kurt W. Forster Karl Friedrich Schinkel did not become an architect, painter, and designer of stage sets by following a predictable career path. The son of a Protestant pastor in Neu-Ruppin whose widow moved her family to the city of Berlin in 1794, Schinkel grew up in somewhat unstable circumstances, and as he matured, began to lead a life of restless activity. At barely 17 years of age, he coaxed a self-portrait from his pen, a crude but compelling image of a rebellious youth. He proudly sealed his likeness with the classical formula “Schinkel se ipse fecit,” suggesting perhaps the more literal meaning, “Schinkel the man who made himself.” In retrospect, it may be claimed that he was truly a self-made man among his eminent contemporaries. In the words of his earliest biographer Gustav Waagen, Schinkel’s restlessness was simply another manifestation of his dazzling versatility. Schinkel was originally drawn to architecture by a stirring experience: He discovered his “calling” through an encounter with a work by the young Friedrich Gilly (Fig. 1). It was an almost religious conversion, so intense as to move him to leave school prematurely and seek encouragement from his idol. Schinkel apprenticed himself to the Gillys, Friedrich and his father David, who together represented the best of two worlds: the elder Gilly, professor of architecture and a seasoned practitioner, no doubt assumed a paternal role vis-à-vis the young Schinkel, while his son Friedrich, recently returned from an extended sojourn in France, carried with him the new fervor of an architectural revolution-in-the-making. -

(1712-1786) Die Entstehungsgeschichte Des Reiterdenkmales Fr
Berliner Stadtbibliothek Berliner Stadtbibliothek Berlin-Saal Berlin-Saal Mittwoch Mittwoch 5. Dezember 2012 5. Dezember 2012 19.00 Uhr 19.00 Uhr Breite Str. 36 Breite Str. 36 10178 Berlin 10178 Berlin Eintritt frei Eintritt frei www.zlb.de www.zlb.de Vortrag Vortrag Die Entstehungsgeschichte Die Entstehungsgeschichte des Reiterdenkmales des Reiterdenkmales Friedrich des Großen (1712-1786) Friedrich des Großen (1712-1786) Horst Peter Serwene, Berlin Horst Peter Serwene, Berlin Veranstaltung des Vereins für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865 Veranstaltung des Vereins für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865 Zentral- und Landesbibliothek Berlin Zentral- und Landesbibliothek Berlin Stiftung des öff entlichen Rechts Stiftung des öff entlichen Rechts Vortrag Vortrag Die Entstehungsgeschichte des Die Entstehungsgeschichte des Reiterdenkmales Friedrich des Großen Reiterdenkmales Friedrich des Großen (1712-1786) (1712-1786) Horst Peter Serwene, Berlin Horst Peter Serwene, Berlin Das Denkmalprojekt für Friedrich den Großen erstreckte sich über 70 Jahre Das Denkmalprojekt für Friedrich den Großen erstreckte sich über 70 Jahre (1779–1851) und ist eines der interessantesten in der Kunstgeschichte (1779–1851) und ist eines der interessantesten in der Kunstgeschichte Preußens. Seine Errichtung fällt in eine Zeit, in der die größten preußischen Preußens. Seine Errichtung fällt in eine Zeit, in der die größten preußischen Baumeister wie Carl Gotthard Langhans, Friedrich Gilly oder Karl Friedrich Baumeister wie Carl Gotthard Langhans, Friedrich Gilly oder Karl Friedrich Schinkel und Bildhauer wie Antoine Tassaert, Johann Gottfried Schadow und Schinkel und Bildhauer wie Antoine Tassaert, Johann Gottfried Schadow und Christian Daniel Rauch ihre bedeutenden Bauten und Standbilder entwarfen. Christian Daniel Rauch ihre bedeutenden Bauten und Standbilder entwarfen.