Validierung Der Endemischen Trichterspinne Histopona
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Summary List of Fossil Spiders
A summary list of fossil spiders compiled by Jason A. Dunlop (Berlin), David Penney (Manchester) & Denise Jekel (Berlin) Suggested citation: Dunlop, J. A., Penney, D. & Jekel, D. 2010. A summary list of fossil spiders. In Platnick, N. I. (ed.) The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History, online at http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/index.html Last udated: 10.12.2009 INTRODUCTION Fossil spiders have not been fully cataloged since Bonnet’s Bibliographia Araneorum and are not included in the current Catalog. Since Bonnet’s time there has been considerable progress in our understanding of the spider fossil record and numerous new taxa have been described. As part of a larger project to catalog the diversity of fossil arachnids and their relatives, our aim here is to offer a summary list of the known fossil spiders in their current systematic position; as a first step towards the eventual goal of combining fossil and Recent data within a single arachnological resource. To integrate our data as smoothly as possible with standards used for living spiders, our list follows the names and sequence of families adopted in the Catalog. For this reason some of the family groupings proposed in Wunderlich’s (2004, 2008) monographs of amber and copal spiders are not reflected here, and we encourage the reader to consult these studies for details and alternative opinions. Extinct families have been inserted in the position which we hope best reflects their probable affinities. Genus and species names were compiled from established lists and cross-referenced against the primary literature. -

Revision of the Histopona Italica Group (Araneae: Agelenidae), with the Description of Two New Species
Zootaxa 3640 (1): 023–041 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Article ZOOTAXA Copyright © 2013 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3640.1.2 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:2865EE2A-01A9-45D9-B299-AAF6E118D5C4 Revision of the Histopona italica group (Araneae: Agelenidae), with the description of two new species ANGELO BOLZERN1,2, PAOLO PANTINI3 & MARCO ISAIA4,5 1Naturhistorisches Museum Basel, Augustinergasse 2, CH-4001 Basel, Switzerland 2American Museum of Natural History, Invertebrate Zoology, Central Park West at 79th Street, New York, NY 10024-5192, United States. E-mail: [email protected] 3Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”, Piazza Cittadella, 10. I-24129 Bergamo, Italy. E-mail: [email protected] 4Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino, Via Accademia Albertina, 13. I-10123 Torino, Italy. E-mail: [email protected] 5Corresponding author Abstract During a large survey of agelenid spiders from different private and museum collections, a closer examination of material from all over Italy (including type material and fresh material) previously identified as Histopona italica Brignoli 1977, disclosed two new species for science, both belonging to the italica group. Based on the results of the present work, we describe Histopona leonardoi sp. n. and H. fioni sp. n. and revise the distribution pattern of H. italica group in Italy and Switzerland. Drawings and photographs of relevant structures and a table summary of the diagnostic characters allowing a fast separation of the species are provided. Key words: taxonomy, endemic fauna, biogeography, Alps, Apennines Introduction According to Platnick (2012) the genus Histopona Thorell 1869 currently includes 18 valid species, two of them, H. -

Araneae: Sparassidae)
EUROPEAN ARACHNOLOGY 2003 (LOGUNOV D.V. & PENNEY D. eds.), pp. 107125. © ARTHROPODA SELECTA (Special Issue No.1, 2004). ISSN 0136-006X (Proceedings of the 21st European Colloquium of Arachnology, St.-Petersburg, 49 August 2003) A study of the character palpal claw in the spider subfamily Heteropodinae (Araneae: Sparassidae) Èçó÷åíèå ïðèçíàêà êîãîòü ïàëüïû ó ïàóêîâ ïîäñåìåéñòâà Heteropodinae (Araneae: Sparassidae) P. J ÄGER Forschungsinstitut Senckenberg, Senckenberganlage 25, D60325 Frankfurt am Main, Germany. email: [email protected] ABSTRACT. The palpal claw is evaluated as a taxonomic character for 42 species of the spider family Sparassidae and investigated in 48 other spider families for comparative purposes. A pectinate claw appears to be synapomorphic for all Araneae. Elongated teeth and the egg-sac carrying behaviour of the Heteropodinae seem to represent a synapomorphy for this subfamily, thus results of former systematic analyses are supported. One of the Heteropodinae genera, Sinopoda, displays variable character states. According to ontogenetic patterns, shorter palpal claw teeth and the absence of egg-sac carrying behaviour may be secondarily reduced within this genus. Based on the idea of evolutionary efficiency, a functional correlation between the morphological character (elongated palpal claw teeth) and egg-sac carrying behaviour is hypothesized. The palpal claw with its sub-characters is considered to be of high analytical systematic significance, but may also give important hints for taxonomy and phylogenetics. Results from a zoogeographical approach suggest that the sister-groups of Heteropodinae lineages are to be found in Madagascar and east Africa and that Heteropodinae, as defined in the present sense, represents a polyphyletic group. -

Revision of the Histopona Italica Group (Araneae: Agelenidae), with the Description of Two New Species
TERMS OF USE This pdf is provided by Magnolia Press for private/research use. Commercial sale or deposition in a public library or website is prohibited. Zootaxa 3640 (1): 023–041 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Article ZOOTAXA Copyright © 2013 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3640.1.2 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:2865EE2A-01A9-45D9-B299-AAF6E118D5C4 Revision of the Histopona italica group (Araneae: Agelenidae), with the description of two new species ANGELO BOLZERN1,2, PAOLO PANTINI3 & MARCO ISAIA4,5 1Naturhistorisches Museum Basel, Augustinergasse 2, CH-4001 Basel, Switzerland 2American Museum of Natural History, Invertebrate Zoology, Central Park West at 79th Street, New York, NY 10024-5192, United States. E-mail: [email protected] 3Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”, Piazza Cittadella, 10. I-24129 Bergamo, Italy. E-mail: [email protected] 4Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino, Via Accademia Albertina, 13. I-10123 Torino, Italy. E-mail: [email protected] 5Corresponding author Abstract During a large survey of agelenid spiders from different private and museum collections, a closer examination of material from all over Italy (including type material and fresh material) previously identified as Histopona italica Brignoli 1977, disclosed two new species for science, both belonging to the italica group. Based on the results of the present work, we describe Histopona leonardoi sp. n. and H. fioni sp. n. and revise the distribution pattern of H. italica group in Italy and Switzerland. -
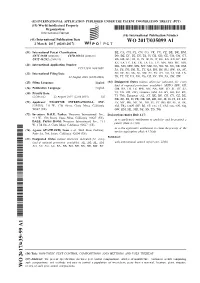
WO 2017/035099 Al 2 March 2017 (02.03.2017) P O P C T
(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) (19) World Intellectual Property Organization International Bureau (10) International Publication Number (43) International Publication Date WO 2017/035099 Al 2 March 2017 (02.03.2017) P O P C T (51) International Patent Classification: BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, C07C 39/00 (2006.01) C07D 303/32 (2006.01) DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, C07C 49/242 (2006.01) HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, (21) International Application Number: MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PCT/US20 16/048092 PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, (22) International Filing Date: SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, 22 August 2016 (22.08.2016) TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW. (25) Filing Language: English (84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, (26) Publication Language: English GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, (30) Priority Data: TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, 62/208,662 22 August 2015 (22.08.2015) US TJ, TM), European (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, (71) Applicant: NEOZYME INTERNATIONAL, INC. -
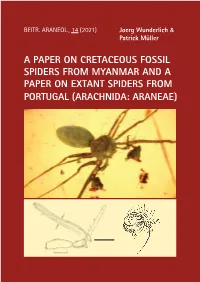
A Paper on Cretaceous Fossil Spiders from Myanmar and a Paper on Extant Spiders from Portugal (Arachnida: Araneae)
A PAPER ON CRETACEOUS FOSSIL BEITR. ARANEOL., 14 (2021) Joerg Wunderlich & (2021) Patrick Müller SPIDERS FROM MYANMAR AND A PAPER 14 ON EXTANT SPIDERS FROM PORTUGAL (ARACHNIDA: ARANEAE) A PAPER ON CRETACEOUS FOSSIL BEITR. ARANEOL., 14 (2021) SPIDERS FROM MYANMAR AND A BEITR. ARANEOL., PAPER ON EXTANT SPIDERS FROM Joerg Wunderlich (ed.) PORTUGAL (ARACHNIDA: ARANEAE) In this paper I (JW) try to round off the “trinity of fossil spider faunas” of three vanished worlds: of the Dominican, Baltic and Burmese (Kachin) ambers (from ca. 22, 45 and 100 (!) million years ago), which I treated in about a dozen volumes concerning the most diverse group of predatory animals of this planet, the spiders (Araneae). We treat in short the cannibalism of few Cretaceous spiders and provide notes on their orb webs. The focus of this study is the diverse fauna of the higher strata which is preserved in Burmese (Kachin) amber. Probably as the most IMPORTANT GENERAL RESULTS I found the Mid Cretaceous Burmese spider fauna to be at least as diverse as the fauna of today but composed by quite different groups and – in contrast to most groups of insects - by numerous (more than 60 %) extinct families of which apparently not a single genus survived. I identified and described ca. 300 species (55 families) of spiders in Burmese (Kachin) amber and estimate that probably more than three thousand spider species lived 100 million years ago in this ancient forest which was a tropical rain forest. What will be the number of spider species (and other animals) that survives the next 100 years in the endangered rain forest of today in Myanmar? A second IMPORTANT GENERAL RESULT: probably during the last 60-70 million years ancient spider groups of the “Middle age of the Earth” (the Mesozoicum) were largely displaced by derived members of the Orb weavers like the well- known Garden Spider (as well as other members of the superfamily Araneoidea) and by spiders like Jumping Spiders, House Spiders and Wolf Spiders (members of the “RTA-clade”) which are very diverse and frequent today. -
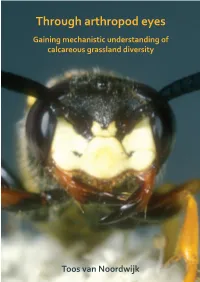
Through Arthropod Eyes Gaining Mechanistic Understanding of Calcareous Grassland Diversity
Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Toos van Noordwijk Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Van Noordwijk, C.G.E. 2014. Through arthropod eyes. Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity. Ph.D. thesis, Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Keywords: Biodiversity, chalk grassland, dispersal tactics, conservation management, ecosystem restoration, fragmentation, grazing, insect conservation, life‑history strategies, traits. ©2014, C.G.E. van Noordwijk ISBN: 978‑90‑77522‑06‑6 Printed by: Gildeprint ‑ Enschede Lay‑out: A.M. Antheunisse Cover photos: Aart Noordam (Bijenwolf, Philanthus triangulum) Toos van Noordwijk (Laamhei) The research presented in this thesis was financially spupported by and carried out at: 1) Bargerveen Foundation, Nijmegen, the Netherlands; 2) Department of Animal Ecology and Ecophysiology, Institute for Water and Wetland Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands; 3) Terrestrial Ecology Unit, Ghent University, Belgium. The research was in part commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation as part of the O+BN program (Development and Management of Nature Quality). Financial support from Radboud University for printing this thesis is gratefully acknowledged. Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann volgens besluit van het college van decanen en ter verkrijging van de graad van doctor in de biologie aan de Universiteit Gent op gezag van de rector prof. dr. Anne De Paepe, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 26 augustus 2014 om 10.30 uur precies door Catharina Gesina Elisabeth van Noordwijk geboren op 9 februari 1981 te Smithtown, USA Promotoren: Prof. -

Deeleman-Reinhold 1983 Histopona En.Pdf
~-,-------- ~------------- ~~~ I~(~' cJ~ tt---- f;;x.-&~ 325 THE GENUS fllSTOfliONA THORELL {J~raneae, t\gelen~dae) WITH DESCRIPTION OF T\NO NEVV CAVE-DWELLING SPECIES by Chrbt3 L. Dee!eman-Reinhold Sparrenlaan 8 Ossendrecht (Pays-Bas) The number of known species assigned to both Histopona Thorell and Roeweriana Kratochvil has in recent years been growing steadily. lvleanwhile, distinction between these genera is becoming vague, if existing at all. Thf genus Histopona was crea·:ed in 1869 for Tegenaria torpida (C.L. Koch), an epigean, agelenid spc('i(~s which, according to Thor·~ll (1 869) ·differs from other Tegenaria species by the slightly recurved posterior eye row and the distal ~ egment of the superior spinners longer than the basal segment. Later, T. /uxuriulls Kulczynski, T. conv,?nicns' KuJczynski, T. facta Kulczynski and T. sirlllata Kulczynski were added to Histopolla (Roewer, 19:)4; Lehtinen, 1967). Lehtinen also provided a diagno.;is of this genus. During the last decade, new species were assigned to Histopona by Brignoli (1976, 1977, J980) and Del tshev (1978). As the characters furnished by Thore!! do not always apply, many aut1Jor~ did not recogni ze the genus, among others Simon, Drensky, Bonnet, Wiehle and Loksa. Brignoli (1971 a) advocated the generic separation of H. torpida and related species from Tegenaria on the basis of the structure of the vulva: H. torpida is provided with an enlarged, membranous segment of the seminal duct, the «bursa copu!atrix», a conformation never found in any Tegenaria species and not unlike that found in the american genus Ageienopsis Giebel (Gering, 1953), but differing from t~Jat genus by the absence of " cOllpl:.ng cavity. -

Complex Genital System of a Haplogyne Spider (Arachnida, Araneae, Tetrablemmidae) Indicates Internal Fertilization and Full Female Control Over Transferred Sperm
JOURNAL OF MORPHOLOGY 267:166–186 (2006) Complex Genital System of a Haplogyne Spider (Arachnida, Araneae, Tetrablemmidae) Indicates Internal Fertilization and Full Female Control Over Transferred Sperm Matthias Burger,1* Peter Michalik,2 Werner Graber,3 Alain Jacob,4 Wolfgang Nentwig,5 and Christian Kropf1 1Natural History Museum, Department of Invertebrates, CH-3005 Bern, Switzerland 2Zoological Institute and Museum, Ernst-Moritz-Arndt-University, D-17489 Greifswald, Germany 3Institute of Anatomy, University of Bern, CH-3000 Bern, Switzerland 4Zoological Institute of the University of Bern, Conservation Biology, CH-3012 Bern, Switzerland and Natural History Museum, CH-3005 Bern, Switzerland 5Zoological Institute of the University of Bern, Community Ecology, CH-3012 Bern, Switzerland ABSTRACT The female genital organs of the tetrablemmid their external genitalia. Females without an exter- Indicoblemma lannaianum are astonishingly complex. The nal genital plate (epigynum) having separate open- copulatory orifice lies anterior to the opening of the uterus ings for the male’s sperm-transferring organs and externus and leads into a narrow insertion duct that ends in a males with comparatively simple palpi were placed genital cavity. The genital cavity continues laterally in paired in the Haplogynae. The characterization of the two tube-like copulatory ducts, which lead into paired, large, sac- like receptacula. Each receptaculum has a sclerotized pore groups was specified by considering the morphology plate with associated gland cells. Paired small fertilization of the internal female genital structures (Wiehle, ducts originate in the receptacula and take their curved course 1967; Austad, 1984; Coddington and Levi, 1991; inside the copulatory ducts. The fertilization ducts end in slit- Platnick et al., 1991; Uhl, 2002). -

Faunistic Diversity and Zoogeography of Cave
Advances in Arachnology and Developmental Biology. UDC 595.44(497):591.9:574/575(292.464) Papers dedicated to Prof. Dr. Božidar Ćurčić. S. E. Makarov & R. N. Dimitrijević (Eds.) 2008. Inst. Zool., Belgrade; BAS, Sofia; Fac. Life Sci., Vienna; SASA, Belgrade & UNESCO MAB Serbia. Vienna — Belgrade — Sofia, Monographs, 12, 327-348. FAUNISTIC DIVERSITY AND ZOOGEOGRAPHY OF CAVE-DWELLING SPIDERS ON THE BALKAN PENINSULA Christo Deltshev Institute of Zoology, Bulgarian Academy of Sciences, 1000 Sofia, Bulgaria Abstract — A total of 326 species from 115 genera and 31 families of Araneae have been established in caves of the Balkan Penisula so far. The species are distributed in different territories as follows: Bulgaria – 99; Greece (Mainland) – 72; Greece (Insular part) – 16; Crete – 44; Croatia – 63; Serbia – 59; Bosnia – 52; Macedonia – 44; Montenegro – 44; Slovenia – 43; Albania – 10; Turkey – eight; and Romania – four species. The largest number of troglobites are encountered in the Dinaric region – 113 (39 blind), Pindus region – 32 (eight blind), Thracian-Macedonian region – 18 (four blind), Balkanid region – 13 (two blind), Danubian region — one; and North Dobruja region — four (three blind) species. The extreme rich- ness of troglobitic spiders in these regions leads to the assumption that these were major centers of speciation and evolution of species. On the basis of their current distribution, the established 324 species can be classified into 17 zoogeographical categories, grouped into four complexes (widely distributed, European, Mediterranean, and Balkan endemics). The largest number of species belong to the group of Balkan endemics (56.5%), which are also the most characteristic and reflect the local character of the fauna. -

An Overview of the Cave and Interstitial Biota of Croatia
NAT. CROAT. VOL. 11 Suppl. 1 1¿112 ZAGREB December, 2002 AN OVERVIEW OF THE CAVE AND INTERSTITIAL BIOTA OF CROATIA Hrvatski prirodoslovni muzej Croatian Natural History Supplementum Museum PUBLISHED BY / NAKLADNIK CROATIAN NATURAL HISTORY MUSEUM / HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MU- ZEJ, HR-10000 Zagreb, Demetrova 1, Croatia / Hrvatska EDITOR IN CHIEF / GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Josip BALABANI] EDITORIAL BOARD / UREDNI[TVO Marta CRNJAKOVI],ZlataJURI[I]-POL[AK, Sre}ko LEINER,NikolaTVRTKOVI], Mirjana VRBEK EDITORIAL ADVISORY BOARD / UREDNI^KI SAVJET W. BÖHME (Bonn,D),I.GU[I] (Zagreb, HR), Lj. ILIJANI] (Zagreb, HR), F. KR[I- NI] (Dubrovnik, HR), M. ME[TROV (Zagreb, HR), G. RABEDER (Wien, A), K. SA- KA^ (Split, HR), W. SCHEDL (Innsbruck, A), H. SCHÜTT (Düsseldorf-Benrath, D), S. []AVNI^AR (Zagreb, HR), T. WRABER (Ljubljana, SLO), D. ZAVODNIK (Rovinj, HR) ADMINISTRATIVE SECRETARY / TAJNICA UREDNI[TVA Marijana VUKOVI] ADDRESS OF THE EDITORIAL BOARD / ADRESA UREDNI[TVA Hrvatski prirodoslovni muzej »Natura Croatica« HR-10000 ZAGREB, Demetrova 1, CROATIA / HRVATSKA Tel. 385-1-4851-700, Fax: 385-1-4851-644 E-mail: [email protected], www.hpm.hr/natura.htm Design / Oblikovanje @eljko KOVA^I], Dragan BUKOVEC Printedby/Tisak »LASER plus«, Zagreb According to the DIALOG Information Service this publication is included in the following secondary bases: Biological Abstracts ®, BIOSIS Previews ®, Zoological Record, Aquatic Sci. & Fish. ABS, Cab ABS, Cab Health, Geo- base (TM), Life Science Coll., Pollution ABS, Water Resources ABS, Adria- med ASFA. In secondary publication Referativniy @urnal (Moscow), too. The Journal appears in four numbers per annum (March, June, September, December) / Izlazi ~etiri puta godi{nje (o`ujak, lipanj, rujan, prosinac) NATURA CROATICA Vol. -

The Efficiency of Pitfall Traps As a Method of Sampling Epigeal Arthropods in Litter Rich Forest Habitats
Eur. J. Entomol. 111(1): 69–74, 2014 doi: 10.14411/eje.2014.008 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) The efficiency of pitfall traps as a method of sampling epigeal arthropods in litter rich forest habitats 1 2 3 JOHANNA SIEWERS , JENS SCHIRMEL and SASCHA BUCHHOLZ * 1 Biological Station Wesel, Freybergweg 9, 46483 Wesel, Germany; e-mail: [email protected] 2 Ecosystem Analysis, Institute of Environmental Science, University of Koblenz-Landau, Fortstraße 7, 76829 Landau, Germany; e-mail: [email protected] 3 Department of Ecology, TU Berlin, Rothenburgstr. 12, 12165 Berlin, Germany; e-mail: [email protected] Key words. Araneae, Carabidae, ground-dwelling arthropods, capture efficiency, deciduous forest, methodology Abstract. Pitfall trapping is an approved self-sampling method for capturing epigeal arthropods for ecological and faunistic studies. Capture efficiency of pitfall traps may be affected by external factors and the design of the trap. Pitfall traps set in forests are usually protected with covers or wire grids, but the effect of these constructions on sampling efficiency as well as their practicability and necessity have so far received little attention. During the present study pitfall traps of four different designs (covers, wire grids, litter exclosure, open) were tested in terms of their efficiency in capturing ground-dwelling arthropods (Acari, Araneae, Carabidae, Formi- cidae, Isopoda, Myriapoda, Opiliones) in order to gain a better understanding of the applicability and reliability of pitfall traps in for- ests. The study was carried out in an oak-beech forest in Northwest Germany using a total of 40 pitfall traps (ten replicates per trap design).